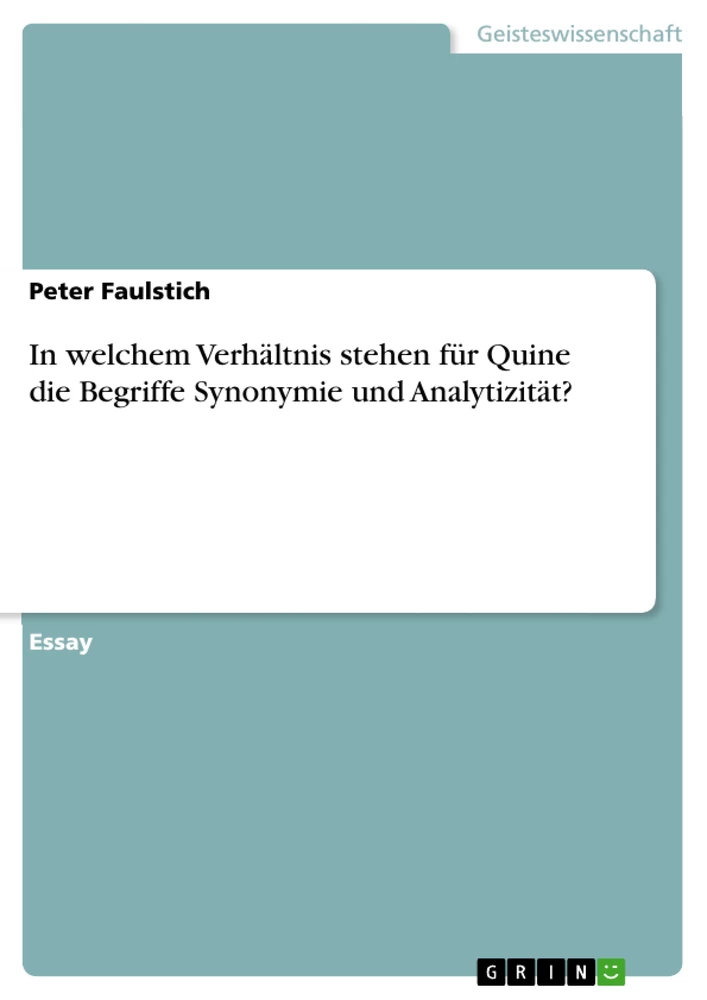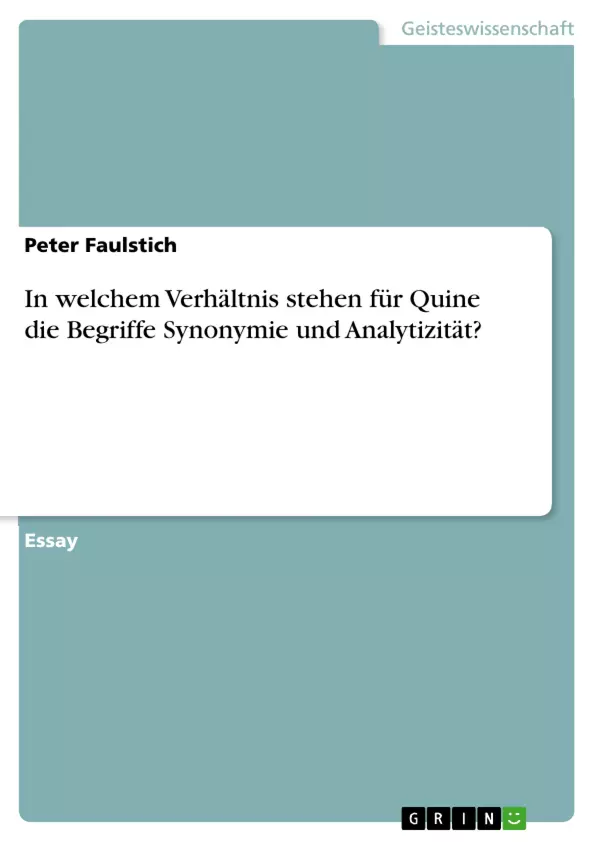In Quines Aufsatz „Two dogmas of empiricism“ stehen zwei zentrale Aspekte, wie dem Namen schon zu entnhemen ist, die den Empirismus der modernen Prägung (Wiener Kreis) in gewisser Hinsicht kritisieren. Das erste Dogma besteht darin, die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen strikt aufrechterhalten zu wollen, das zweite ist der Reduktionismus, also der Glaube, dass jede einzelne sinnvolle Aussage logisch äquivalent zu einer auf Erfahrung beruhenden Tatsache sei. Dem zweiten Dogma hält Quine entgegen, dass nicht einzelne Aussagen, sondern immer nur eine Menge von Aussagen verifiziert werden können.
Auch wenn beide Dogmen miteinander zusammenhängen, soll nun im weiteren Verlauf des Essays das erste Dogma im Mittelpunkt stehen. Quine behauptet, es gebe kein Kriterium, um eine genaue Unterscheidung von analytischen und synthetischen Aussagen vorzunehmen. Dazu erläutert er das geläufige Kriterium der Synonymie (Bedeutungstheorie), das die Analytizität erklären soll. Diese beruht auf drei Begriffen, nämlich (1) Definition, (2) Austauschbarkeit und (3) semantische Regel, auf die wir noch zurückkommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Sprachphilosophie
- Das erste Dogma: Analytische und synthetische Aussagen
- Das zweite Dogma: Reduktionismus
- Synonymie und Analytizität
- Definition
- Austauschbarkeit
- Semantische Regeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht das Verhältnis von Synonymie und Analytizität in Quines Aufsatz „Two dogmas of empiricism“. Quine kritisiert darin die traditionelle Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen sowie den Reduktionismus, der besagt, dass jede sinnvolle Aussage auf Erfahrung beruhend sein muss.
- Das erste Dogma des Empirismus: die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen
- Das Kriterium der Synonymie als Erklärung für Analytizität
- Quines Einwände gegen das Kriterium der Synonymie
- Die Rolle von Definition, Austauschbarkeit und semantischen Regeln
- Die Schwierigkeit, ein Kriterium für Analytizität zu finden, das nicht zirkulär ist
Zusammenfassung der Kapitel
- In diesem Essay wird zunächst das erste Dogma des Empirismus, die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen, vorgestellt. Quine argumentiert, dass es kein eindeutiges Kriterium für diese Unterscheidung gibt.
- Als nächstes wird das geläufige Kriterium der Synonymie, das die Analytizität erklären soll, erläutert. Quine greift auf drei Punkte zurück: Definition, Austauschbarkeit und semantische Regeln.
- Der Essay analysiert dann Quines Einwände gegen jedes dieser Kriterien. Er argumentiert, dass Definitionen selbst auf Synonymie beruhen, Austauschbarkeit nur für Sprachen mit intensionalen Ausdrücken gilt und semantische Regeln nicht eindeutig zeigen, was sie Ausdrücken zuschreiben.
- Der Essay führt aus, dass es schwierig ist, ein Kriterium für Analytizität zu finden, das eine stichhaltige Begründung liefert und nicht zirkulär ist.
Schlüsselwörter
Dieser Essay beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der Sprachphilosophie, insbesondere mit Analytizität, Synonymie, Definition, Austauschbarkeit, semantischen Regeln und dem ersten Dogma des Empirismus. Die Arbeit befasst sich mit Quines Kritik an der traditionellen Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen, sowie mit seinen Argumenten gegen das Kriterium der Synonymie als Erklärung für Analytizität. Weitere wichtige Themen sind die Rolle von intensionalen und extensionalen Ausdrücken, die Grenzen der semantischen Regeln und die Schwierigkeit, ein nicht-zirkuläres Kriterium für Analytizität zu finden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Zwei Dogmen des Empirismus"?
Quine kritisiert 1. die strikte Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen und 2. den Reduktionismus.
Was ist eine analytische Aussage?
Traditionell eine Aussage, die allein aufgrund der Bedeutung ihrer Begriffe wahr ist (z.B. "Alle Junggesellen sind unverheiratet").
Warum kritisiert Quine den Begriff der Synonymie?
Er argumentiert, dass Synonymie (Bedeutungsgleichheit) nicht ohne Rückgriff auf Analytizität erklärt werden kann, was zu einem Zirkelschluss führt.
Was bedeutet "Austauschbarkeit" (salva veritate)?
Zwei Ausdrücke sind synonym, wenn sie in allen Sätzen ausgetauscht werden können, ohne den Wahrheitswert des Satzes zu ändern.
Was ist Quines Fazit zur Analytizität?
Er behauptet, dass es keine scharfe Grenze zwischen analytischen (begrifflichen) und synthetischen (empirischen) Wahrheiten gibt.
- Quote paper
- Peter Faulstich (Author), 2002, In welchem Verhältnis stehen für Quine die Begriffe Synonymie und Analytizität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17850