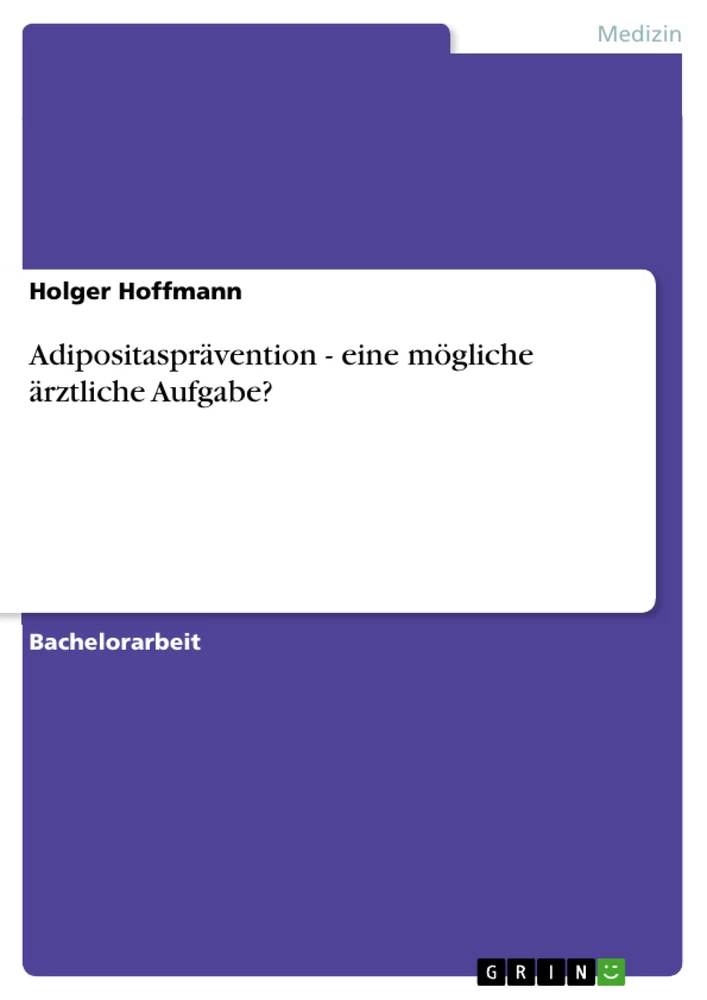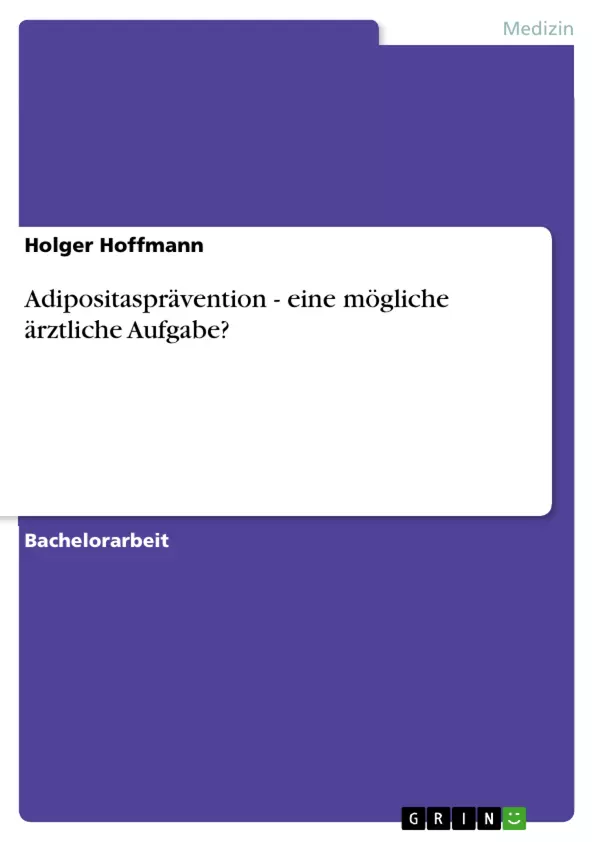Die aus Übergewicht und Adipositas resultierenden Folgeerkrankungen belegen tendenziell steigend immer mehr Kapazitäten im Gesundheitswesen (RKI 2005).
Wirth beziffert die Anzahl der übergewichtigen Bürger in Deutschland auf 30 Millionen und jene, die bereits adipös sind, auf 18 Millionen (Wirth 2008). Die WHO prognostizierte 2005 für das Jahr 2015, dass weltweit ca. 2,3 Milliarden Erwachsene stark übergewichtig und 700 Millionen adipös sein werden (WHO 2005).
Diese Zahlen beschränken sich nicht allein auf Erwachsene, der Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen im Alter von 3- bis 17 Jahren in Deutschland lag im Jahr 2006 bei 15 % (1,9 Millionen übergewichtig und ca. 800.000 adipös). Der Vergleich der Daten aus 1985 bis 1999 mit denen aus 2006 zeigt, dass sich die Prävalenz sowohl von Übergewicht als auch von Adipositas bei den 3- bis 17- jährigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland in diesem Zeitraum verdoppelt hat (Thamm 2007).
Übergewicht im Kindesalter korreliert mit Übergewicht im Erwachsenenalter, woraus sich nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale Probleme ergeben und die Leistungsfähigkeit in erheblichem Maß eingeschränkt wird. Präventionsmaßnahmen sind bereits im frühen Kindes- und Jugendalter notwendig und wichtig (Rauh-Pfeiffer und Koletzko 2007).
Die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen ist multifaktoriell bedingt und hängt mit familiärer Vorbelastung, ethnischer Zugehörigkeit, soziokulturellem Umfeld und dem sozialen Status zusammen. Bedeutsame Risikofaktoren für die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas sind neben einer energie- und fettreichen Ernährung von Kindern und Jugendlichen auch körperliche Inaktivität (Böhler et al. 2004).
Adipositas im Kindesalter geht häufig mit einem erhöhten Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf- Erkrankungen und vorzeitiger Sterblichkeit im Erwachsenenalter einher.
Zudem leiden Kinder und Jugendliche unter einer funktionellen sowie einer individuellen Einschränkung und sind häufig zusätzlichen psychosozialen Belastungen ausgesetzt (Czerwinski-Mast et al. 2003).
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Adipositas
- Klassifikation nach Gewicht-Längen-Indizes
- Adipositastypen
- Epidemiologie der Adipositas
- Ätiopathogenese
- Genetische Faktoren
- Soziokulturelle Faktoren
- Lebensstil und familiäre Einflüsse
- Neurohumorale Faktoren
- Folgen der Adipositas
- Medizinische Folgen
- Psychische und psychosoziale Folgen
- Prävention
- Gesetzliche Grundlagen
- Wege der Adipositasprävention
- Präventionsziele
- Prävention in der Arztpraxis
- Aufgabenspektrum
- Patientenerwartungen an den Arzt
- Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arzt-/ Patientenkommunikation
- Arzt-Patienten-Beziehungen
- Verhalten von Ärzten gegenüber Übergewichtigen/Adipösen
- Patientensicht
- Wandel der Fremd- zur Selbstverantwortung der Patienten
- Umsetzung der Prävention in der Praxis/mögliche Instrumente
- Patientenkontakte
- Motivierendes Interview
- Das 5-A-Konzept
- Shared-Decision-Making
- Gesamtfazit
- Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der Prävention
- Interventionsformen und Qualitätssicherung
- Gesamtfazit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis "Adipositasprävention - eine mögliche ärztliche Aufgabe?" befasst sich mit der Frage, ob Hausärzte und Pädiater die Prävention von Übergewicht und Adipositas als ihre Aufgabe ansehen und ihren Beitrag zur Bekämpfung der "Adipositasepidemie" leisten wollen und können. Die Arbeit analysiert die epidemiologischen Daten, die medizinischen, psychischen und psychosozialen Folgen der Adipositas sowie die Faktoren, die die Entwicklung einer Adipositas begünstigen und Gründe, die eine erfolgreiche Prävention verhindern.
- Epidemiologie und Verbreitung von Übergewicht und Adipositas
- Ursachen und Risikofaktoren für Adipositas
- Medizinische, psychische und psychosoziale Folgen der Adipositas
- Rolle der Ärzte und Patienten in der Adipositasprävention
- Mögliche Modelle für eine erfolgreiche Präventionskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Adipositasprävention dar und beleuchtet die steigende Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in der Bevölkerung. Das Kapitel "Definition der Adipositas" erläutert die Klassifikation nach Gewicht-Längen-Indizes und unterscheidet verschiedene Adipositastypen. Die "Epidemiologie der Adipositas" beleuchtet die weltweite Verbreitung und die Trends der Adipositasentwicklung. Das Kapitel "Ätiopathogenese" analysiert die genetischen, soziokulturellen, lebensstilbedingten und neurohumeralen Faktoren, die die Entstehung von Adipositas begünstigen. Die "Folgen der Adipositas" werden in medizinische und psychosoziale Folgen unterteilt und beleuchten die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen. Das Kapitel "Prävention" befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen, den Wegen der Adipositasprävention und den Präventionszielen. Das Kapitel "Prävention in der Arztpraxis" analysiert das Aufgabenspektrum der Ärzte und die Patientenerwartungen an den Arzt in Bezug auf Prävention. Das Kapitel "Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arzt-/ Patientenkommunikation" untersucht die Arzt-Patienten-Beziehung, das Verhalten von Ärzten gegenüber Übergewichtigen/Adipösen, die Patientensicht und den Wandel der Fremd- zur Selbstverantwortung der Patienten. Das Kapitel "Umsetzung der Prävention in der Praxis/mögliche Instrumente" stellt verschiedene Instrumente zur Umsetzung der Prävention in der Praxis vor, wie das motivierende Interview, das 5-A-Konzept und Shared-Decision-Making. Die "Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der Prävention" geben konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Adipositasprävention. Das Kapitel "Interventionsformen und Qualitätssicherung" beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Qualitätssicherung in der Adipositasprävention. Das Gesamtfazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenden präventiven Gesamtkonzepts.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Adipositasprävention, Übergewicht, Adipositas, Hausarzt, Pädiater, Prävention, Gesundheitsförderung, Patientenerwartungen, Arzt-Patienten-Kommunikation, motivierendes Interview, 5-A-Konzept, Shared-Decision-Making, Interventionsformen, Qualitätssicherung, Public-Health-Handlungszyklus, Gesundheitspolitik, sozioökonomischer Status, Risikofaktoren, Folgeerkrankungen, Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Gesundheitsbewusstsein, Selbstverantwortung, Patientenbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Adipositasprävention bei Kindern so wichtig?
Übergewicht im Kindesalter korreliert stark mit Übergewicht im Erwachsenenalter und führt frühzeitig zu Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Welche Rolle spielen Hausärzte bei der Prävention?
Ärzte sind zentrale Ansprechpartner, die durch Beratung, Motivation und Früherkennung maßgeblich zur Bekämpfung der Adipositasepidemie beitragen können.
Was ist das „5-A-Konzept“ in der ärztlichen Beratung?
Es ist ein strukturiertes Beratungsschema für Ärzte, um Patienten bei Verhaltensänderungen (z. B. Ernährung/Bewegung) professionell zu unterstützen.
Wie beeinflusst der sozioökonomische Status das Adipositasrisiko?
Studien zeigen, dass soziokulturelle Faktoren und das soziale Umfeld einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Übergewicht bei Kindern haben.
Was bedeutet „Shared-Decision-Making“?
Es beschreibt die gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient, was die Eigenverantwortung und Therapietreue des Patienten stärkt.
- Citation du texte
- Holger Hoffmann (Auteur), 2011, Adipositasprävention - eine mögliche ärztliche Aufgabe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178528