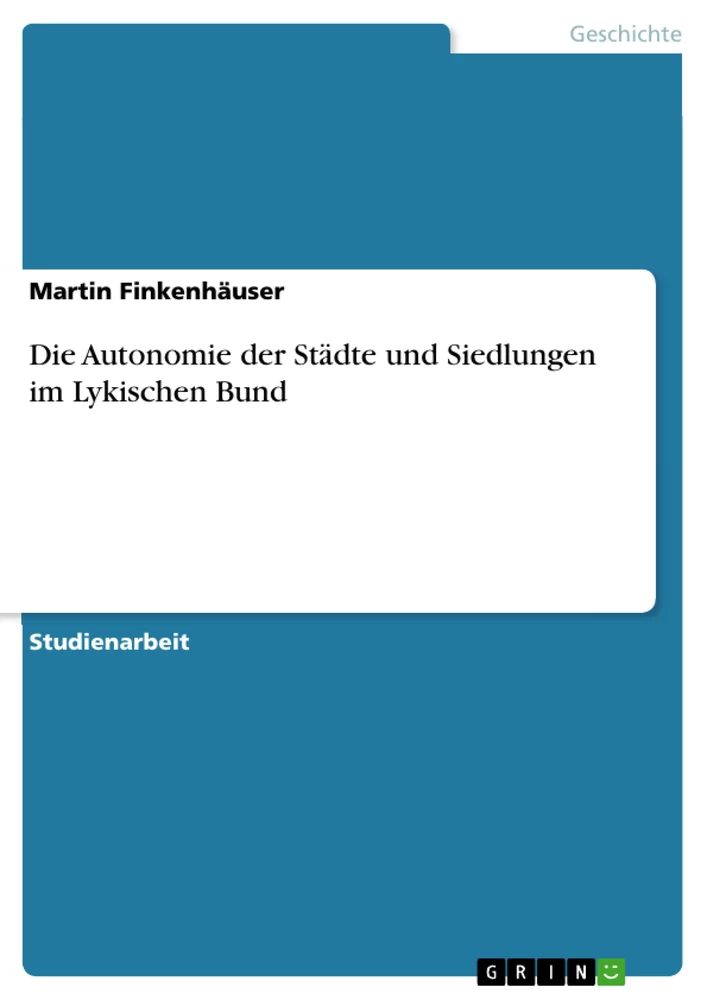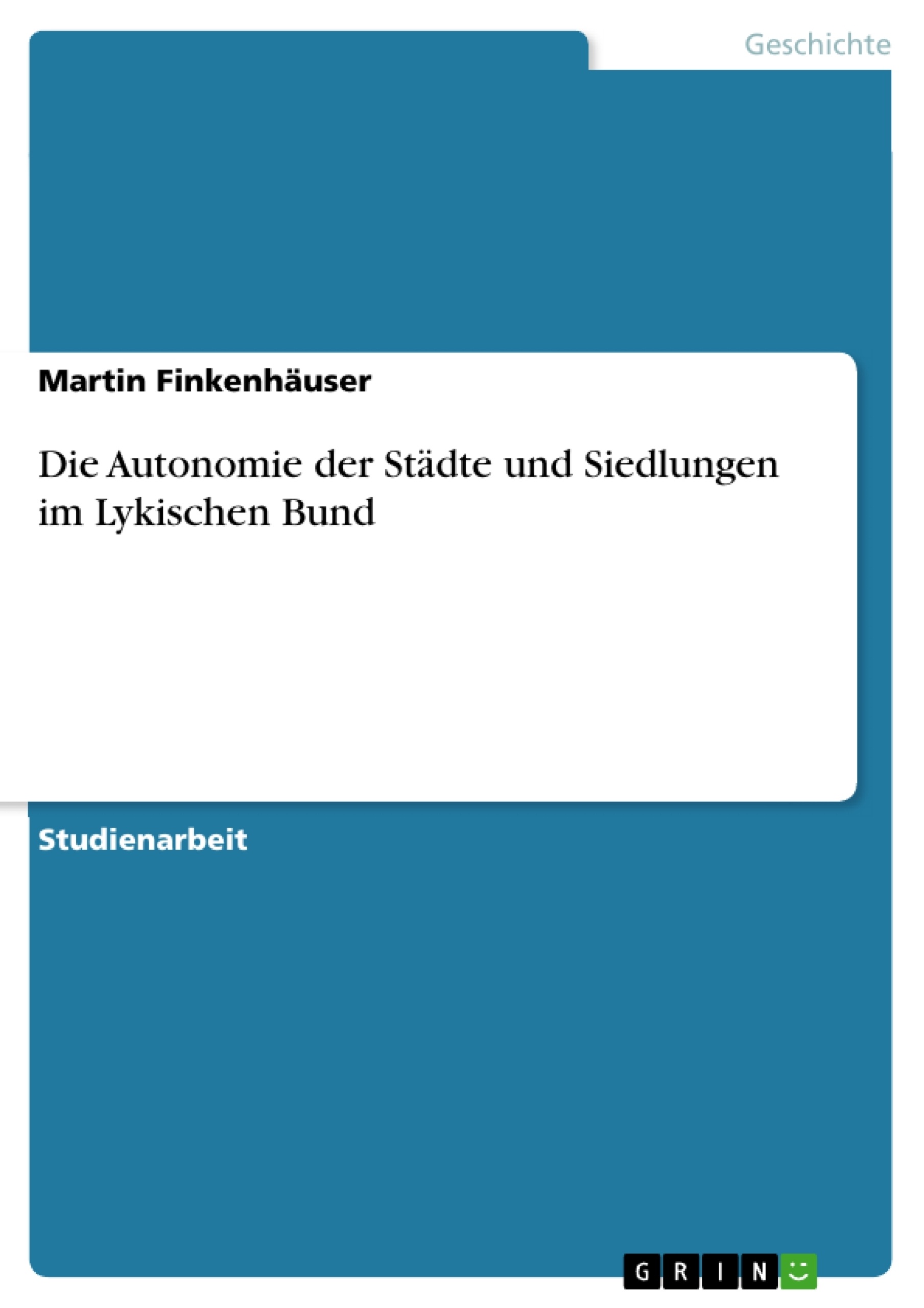Die Lykier haben sich trotz ständiger und ständig wechselnder Vorherrschaft durch andere stets weitestgehend selbst verwaltet, dabei schwankte zwar das Maß an Eigenständigkeit gerade zwischen der rhodischen Vorherrschaft und der Zeit danach beträchtlich, aber spätestens ab dem dritten Jahrhundert v. Chr. ist die πόλις in Lykien die entscheidende Institution. Zweitens kann man konstatieren, dass die πόλις die entscheidende Mittelebene in einer weitreichenden Verwaltungshierarchie, die ab 167 v. Chr. vom Gemeindevorsteher über
Stadt und Bund bis nach Rom reichte, war. In dieser Arbeit geht es um die Geschichte des Koinons der Lykier.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Λυκίων τὸ κοινὸν – Zur Struktur des Bundes
- 2.1. Die Vorgeschichte: Lykien bis zum 3. Jahrhundert
- 2.2. Gründung und Frühphase in hellenistischer Zeit
- 2.3. Lykien in der Kaiserzeit
- 2.4. Die Verfassung des Bundes
- 3. Gewahrte Autonomie?
- 3.1. Lykische Städte unter rhodischer Vorherrschaft
- 3.2. Lykische Städte in der römischen Provinz
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Lykischen Bund und das Verhältnis zwischen dem Bund und seinen Mitgliedsstädten. Die Zielsetzung ist die Rekonstruktion der Vorgeschichte des Bundes, die Analyse der Einbindung von κόμαι und πόλεις in die Strukturen des κοινόν und die Untersuchung des Grades der Autonomie der Städte innerhalb des Bundes. Kritisch wird dabei die These einer kontinuierlichen Fortsetzung föderaler Traditionen im Lykischen Bund beleuchtet.
- Die Vorgeschichte des Lykischen Bundes und die Entwicklung föderaler Strukturen in Lykien.
- Die Organisation und Verfassung des Lykischen Bundes.
- Die Rolle von Städten (πόλεις) und Gemeinden (κόμαι) im Lykischen Bund.
- Die Autonomie der lykischen Städte unter dem Einfluss des Bundes.
- Der Wandel des Lykischen Bundes durch die römische Provinzbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beleuchtet den Lykischen Bund als Beispiel für föderale Strukturen im antiken Griechenland und benennt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen dem Bund und seinen Mitgliedsstädten. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Vorgeschichte des Bundes, die Einbindung der Städte und Gemeinden in dessen Strukturen, sowie die Rekonstruktion der Verfassung umfasst. Kritisch wird die These einer kontinuierlichen Fortsetzung föderaler Traditionen im Lykischen Bund in Bezug auf die Arbeit von Ralf Behrwald diskutiert. Die Einleitung deutet auf ein Spannungsverhältnis zwischen der Autonomie der Städte und deren Einbindung in übergeordnete Strukturen hin, welches im Hauptteil vertieft werden soll.
2. Λυκίων τὸ κοινὸν – Zur Struktur des Bundes: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Struktur des Lykischen Bundes, beginnend mit seiner Vorgeschichte bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. Es wird herausgestellt, dass sich für das dritte Jahrhundert keine Anzeichen für föderale Organisationen finden lassen, im Gegensatz zum zweiten Jahrhundert. Die herrschende Struktur wird als System von Dynastenherrschaft beschrieben, mit Xanthos als zunächst führender Stadt. Die Eroberung durch die Perser und die darauffolgende Herrschaft persischer Aristokraten, die ihre Macht als βασιλεία ausübten, wird detailliert dargestellt. Der Abschnitt beleuchtet die Entwicklung unter den Hekatomniden und den Hellenisierungsprozess, der durch Alexanders Eroberung verstärkt wurde. Die unterschiedliche Rechtsstellung von Städten und Gemeinden wird anhand von Inschriften verdeutlicht, wobei die Abstufung von unselbständigen Ortschaften über Gemeinden mit partieller Selbstverwaltung hin zu griechischen πόλεις im Fokus steht. Die Zusammenfassung betont das Fehlen einer nachweisbaren Bundesorganisation vor dem 2. Jahrhundert v. Chr. und die Vorherrschaft dynastischer Strukturen in Verbindung mit einer zunehmenden Hellenisierung der Städte.
Schlüsselwörter
Lykischer Bund, Λυκίων τὸ κοινὸν, Autonomie, Föderalismus, πόλεις, κόμαι, Dynastenherrschaft, Hellenisierung, Römische Provinz, Verfassung, Institutionen, Ralf Behrwald.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über den Lykischen Bund
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Lykischen Bund (Λυκίων τὸ κοινὸν) und das Verhältnis zwischen dem Bund und seinen Mitgliedsstädten (πόλεις) und Gemeinden (κόμαι). Im Fokus steht die Rekonstruktion der Vorgeschichte des Bundes, die Analyse seiner Strukturen und der Grad der Autonomie der Städte innerhalb des Bundes. Kritisch wird dabei die These einer kontinuierlichen Fortsetzung föderaler Traditionen hinterfragt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Vorgeschichte des Lykischen Bundes und die Entwicklung föderaler Strukturen in Lykien, die Organisation und Verfassung des Bundes, die Rolle von Städten und Gemeinden im Bund, die Autonomie der lykischen Städte unter dem Einfluss des Bundes und den Wandel des Bundes durch die römische Provinzbildung. Es wird die Entwicklung von dynastischen Strukturen zur föderalen Organisation nachvollzogen und der Einfluss der Hellenisierung und der römischen Herrschaft analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Struktur des Lykischen Bundes (mit Unterkapiteln zur Vorgeschichte, Gründung, Kaiserzeit und Verfassung), ein Kapitel zur Autonomie der Städte (unter rhodischer und römischer Herrschaft) und ein Fazit. Die Einleitung definiert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Inhalte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Inschriften und anderen historischen Quellen, um die Struktur des Lykischen Bundes, die Rolle der Städte und Gemeinden und die Entwicklung des Bundes über die Zeit zu rekonstruieren. Die Arbeit bezieht sich kritisch auf die Forschung von Ralf Behrwald und dessen These zur kontinuierlichen Fortsetzung föderaler Traditionen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass es vor dem 2. Jahrhundert v. Chr. keine nachweisbare Bundesorganisation gab, sondern eine Vorherrschaft dynastischer Strukturen. Die Hellenisierung und die römische Provinzbildung hatten einen starken Einfluss auf den Lykischen Bund und die Autonomie seiner Mitglieder. Die These einer kontinuierlichen föderalen Tradition wird kritisch hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Lykischer Bund, Λυκίων τὸ κοινὸν, Autonomie, Föderalismus, πόλεις, κόμαι, Dynastenherrschaft, Hellenisierung, Römische Provinz, Verfassung, Institutionen, Ralf Behrwald.
- Citar trabajo
- Martin Finkenhäuser (Autor), 2010, Die Autonomie der Städte und Siedlungen im Lykischen Bund, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178546