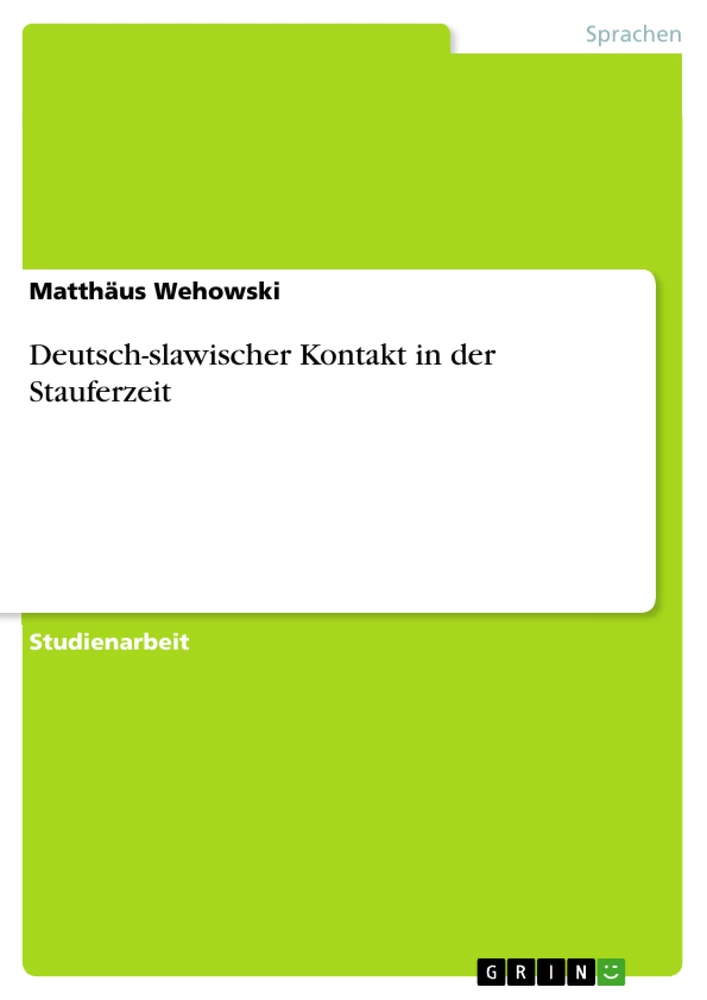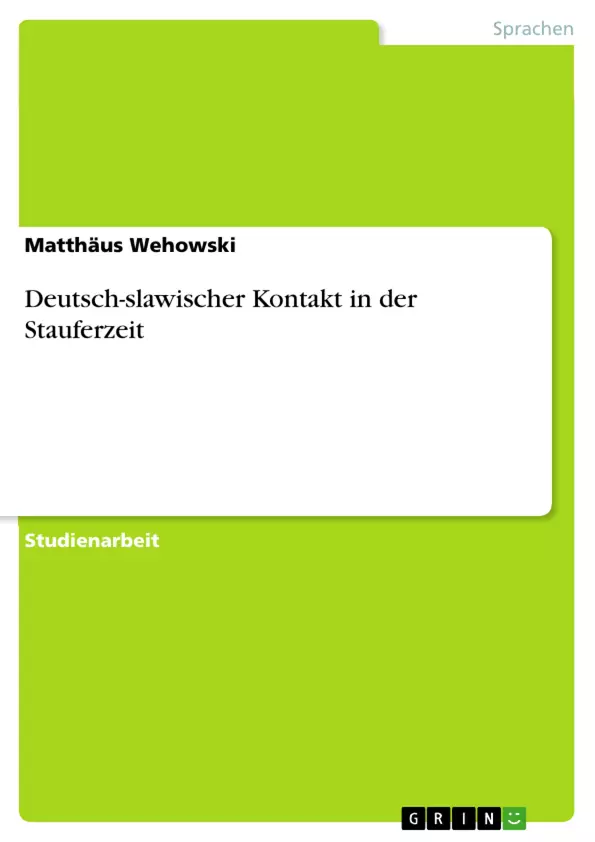Die Nationalsozialisten bezeichneten den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 als Fall
Barbarossa – im Geschichtsverständnis der NS-Zeit bedeutete der Angriff auf russisches
Gebiet eine Fortsetzung der staufischen Expansionspolitik nach Osten. Doch waren die
Staufer und vor allem Barbarossa tatsächlich nur an einer aggressiven Expansions- und
Kolonisationspolitik im Slawengebiet interessiert? In meiner Hausarbeit möchte ich darstellen
wie der Kontakt zwischen Slawen und Deutschen in der Zeit Barbarossas tatsächlich
abgelaufen ist und wie er sich in dieser Zeit verändert hat. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich
mich dabei vor allem auf die Elbslawen in der so genannten Germania Slavica, also dem
Gebiet zwischen der Elbe und der Oder und auf das Herzogtum Polen beschränken. Weitere
Kontakte mit slawischen Völkern werde ich aus Gründen des beschränkten Umfangs
auslassen. Ich habe mich für die Elbslawen und für Polen als Beispiel für den Kontakt mit den
Deutschen entschieden, da es sich hier um zwei Arten des Kontakts handelt: Zum einen die
heidnischen und in viele Stämme aufgeteilten Elbslawen und zum anderen das Herzogtum
Polen, das bereits im Jahr 966 christianisiert worden ist.
Ich werde mich vor allem auf die politische Ebene beschränken und daher wirtschaftliche
oder kulturelle Kontakte nur am Rand erwähnen. Ich werde in meiner Arbeit auch die Zeit des
Königtums Lothars III. und Konrads III. berücksichtigen, da bereits während ihrer Herrschaft
wichtige Ereignisse und Entwicklungen stattgefunden haben, die für die Königszeit
Barbarossas ab 1153 entscheidend sind.
In meiner Hausarbeit werde ich mich mit der Frage beschäftigen, in wie weit sich der
politische Kontakt zwischen den Deutschen und ihren slawischen Nachbarn in der Zeit
Barbarossas verändert hat und welche Gründe es dafür gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Veränderungen des Kontakts in der Germania Slavica
- Die Situation in der Germania Slavica bis zum Wendenkreuzzug
- Der Wendenkreuzzug von 1147
- Die Veränderung der politischen Beziehungen am Beispiel des Grafen Adolf 11. von Holstein und Albrechts des Bären
- Adolf 11. von Holstein
- Albrecht der Bär
- Fazit
- Der Kontakt mit Polen
- Überblick über die polnisch-deutschen Kontakte vor dem 12. Jahrhundert
- Boleslaw III. und das Senioratsherzogtum
- Wladyslaw der Vertriebene und die Staufer
- Albrecht der Bär und der Kontakt zu Polen
- Schluss
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Wandel im politischen Kontakt zwischen Deutschen und Slawen im 12. Jahrhundert während der Herrschaft Friedrich Barbarossas. Der Fokus liegt dabei auf den Elbslawen in der Germania Slavica und dem Herzogtum Polen. Die Arbeit analysiert die Situation vor dem Wendenkreuzzug von 1147, die Auswirkungen des Kreuzzuges auf die politischen Beziehungen und die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem deutsch-römischen Reich und Polen im 12. Jahrhundert.
- Die politische Situation in der Germania Slavica vor dem Wendenkreuzzug
- Die Folgen des Wendenkreuzzuges für die politischen Beziehungen zwischen Deutschen und Slawen
- Die Rolle der Diplomatie im Ausbau der deutschen Herrschaft im Slawengebiet
- Die Beziehungen zwischen dem deutsch-römischen Reich und Polen im 12. Jahrhundert
- Die Auswirkungen der politischen Instabilität in Polen auf die Beziehungen zu den Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Veränderungen im politischen Kontakt zwischen Deutschen und Slawen in der Zeit Barbarossas. Die Arbeit konzentriert sich auf die Elbslawen in der Germania Slavica und das Herzogtum Polen.
Das zweite Kapitel analysiert die Situation in der Germania Slavica bis zum Wendenkreuzzug. Es werden die slawischen Stämme, die politische Situation und die Entwicklungen im 10. und 11. Jahrhundert beschrieben. Der Fokus liegt auf den Obodriten und den Liutizen, die in dieser Zeit ihre Herrschaft in Nordosteuropa ausbauten.
Das dritte Kapitel behandelt den Wendenkreuzzug von 1147 und seine Folgen für die Beziehungen zwischen Deutschen und Slawen. Es werden die Ursachen des Kreuzzuges, die beteiligten Fürsten und die militärischen Ereignisse beschrieben. Die Arbeit untersucht auch die Auswirkungen des Kreuzzuges auf die Missionierung der slawischen Bevölkerung und die politischen Beziehungen zwischen den deutschen Fürsten und den slawischen Herrschern.
Das vierte Kapitel analysiert die politischen Beziehungen zwischen dem deutsch-römischen Reich und Polen im 12. Jahrhundert. Es werden die historischen Kontakte beider Staaten seit der polnischen Staatsgründung beschrieben, insbesondere die Rolle der Missionierung und die Herausforderungen der politischen Stabilität in Polen.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Bedeutung der politischen Beziehungen zwischen Deutschen und Slawen in der Zeit Barbarossas heraus. Es werden die Veränderungen im politischen Kontakt, die Rolle der Diplomatie und die Auswirkungen der politischen Instabilität in Polen auf die Beziehungen zu den Deutschen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den politischen Kontakt zwischen Deutschen und Slawen in der Stauferzeit, den Wendenkreuzzug von 1147, die Germania Slavica, das Herzogtum Polen, die Elbslawen, die Obodriten, die Liutizen, die politische Situation in der Germania Slavica vor dem Wendenkreuzzug, die Folgen des Kreuzzuges für die Beziehungen zwischen Deutschen und Slawen, die Rolle der Diplomatie im Ausbau der deutschen Herrschaft im Slawengebiet, die Beziehungen zwischen dem deutsch-römischen Reich und Polen im 12. Jahrhundert, die Auswirkungen der politischen Instabilität in Polen auf die Beziehungen zu den Deutschen, Friedrich Barbarossa, Albrecht der Bär, Adolf von Holstein, Boleslaw III., Wladyslaw der Vertriebene, Niklot, Pribislaw.
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Verhältnis zwischen Deutschen und Slawen in der Stauferzeit?
Der Kontakt war vielschichtig und wandelte sich im 12. Jahrhundert von einer rein aggressiven Expansionspolitik hin zu einer Phase, die auch durch diplomatische Beziehungen und Christianisierung geprägt war.
Was war der Wendenkreuzzug von 1147?
Dies war ein militärischer Feldzug deutscher und dänischer Fürsten gegen die elbslawischen Stämme (Wenden) mit dem Ziel der Unterwerfung und Missionierung.
Wer war Albrecht der Bär?
Albrecht der Bär war ein bedeutender deutscher Fürst, der maßgeblich an der Ausdehnung der deutschen Herrschaft im Slawengebiet beteiligt war und die Mark Brandenburg gründete.
Wie unterschied sich der Kontakt zu Polen von dem zu den Elbslawen?
Während die Elbslawen im 12. Jahrhundert noch heidnisch waren, war Polen bereits seit 966 christianisiert. Der Kontakt zu Polen war daher eher politisch-diplomatischer Natur zwischen zwei christlichen Mächten.
Was bedeutet der Begriff „Germania Slavica“?
Er bezeichnet das Gebiet zwischen Elbe und Oder, in dem im Mittelalter ein intensiver Kontakt und Siedlungsaustausch zwischen Deutschen und Slawen stattfand.
- Arbeit zitieren
- Matthäus Wehowski (Autor:in), 2010, Deutsch-slawischer Kontakt in der Stauferzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178554