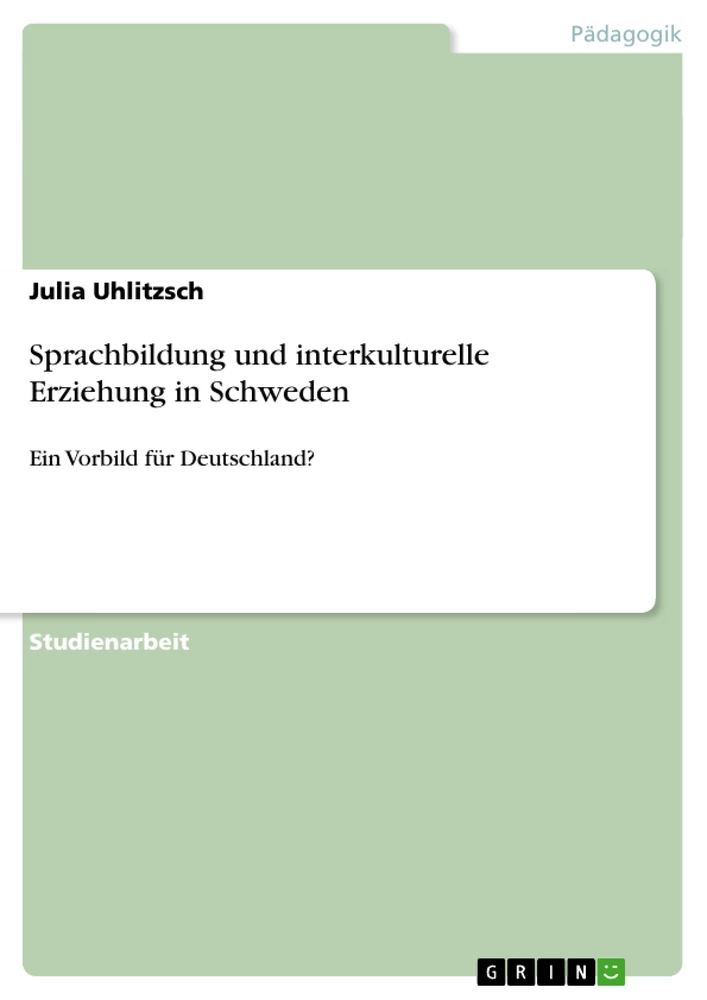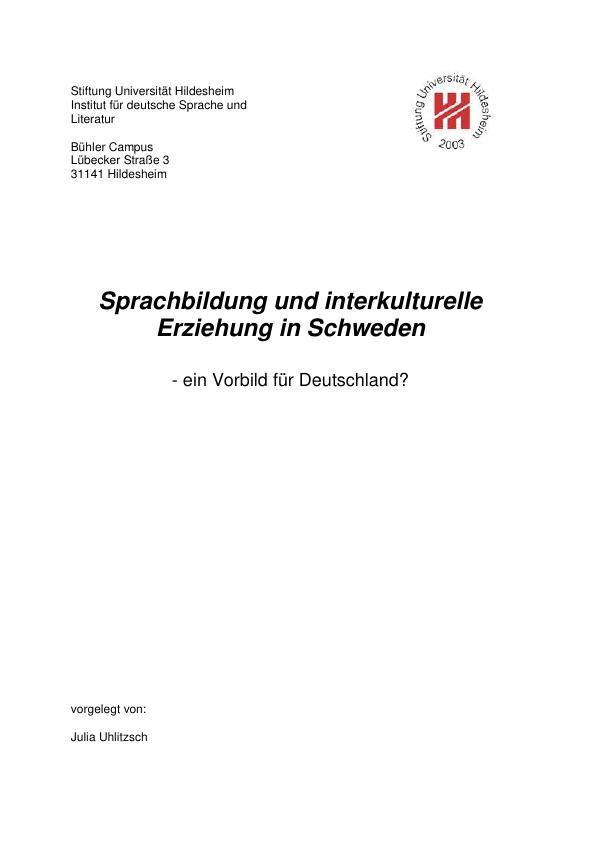„Wenn es um moderne Bildungssysteme geht, zählt Schweden zu den Vorbildern.“
(Strothmann, 2005, S. 5)
1. Einleitung
Das angeführte Zitat untermauert den Inhalt dieser Ausarbeitung, welche sich mit dem Referatsthema „Sprachbildung und interkulturelle Erziehung in Schweden“ auseinandersetzt. Dabei werden speziell drei Maßnahmen für Migranten und ihre Kinder näher erläutert und dafür notwendige Begriffsdefinitionen gegeben. Zunächst gibt die Arbeit jedoch einen kurzen Überblick über die Bevölkerung Schwedens und geht folglich näher auf das schwedische Sprachgesetz ein. Zusätzlich wird der Begriff interkulturelles Lernen herausgearbeitet und dessen Umsetzung in Schweden näher beleuchtet. Da sich diese Arbeit darüber hinaus mit der Fragestellung beschäftigt, ob Schweden ein Vorbild für Deutschland ist, wird schlussendlich genauer darauf eingegangen.
Grundlage für die Ausarbeitung des Referatthemas „Sprachbildung und interkulturelle Erziehung in Schweden“ bildet der Text von Sigrid Luchtenberg mit dem Titel „Bilinguale und Interkulturelle Erziehung in Schweden“. Zudem wurde mithilfe einschlägiger Literatur das Thema näher bearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Schweden — ein kleiner Überblick über die Bevölkerung
- Das schwedische Sprachgesetz
- Sprachbildung in Schweden — Maßnahmen für Migranten und ihre Kinder
- Begriffsdefinition Muttersprache
- Gründe für die Förderung der Muttersprache
- Maßnahme 1 - Muttersprachlicher Unterricht (MIJ) in Schweden
- Begriffsdefinition Zweitsprache
- Maßnahme 2 - Schwedisch als Zweitsprache
- Maßnahme 3 Unterricht in besonderen Klassenformen
- Interkulturelles Lernen
- Begriffsdefinition Interkulturelles Lernen
- Interkulturelles Lernen in Schweden
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Referatsthema „Sprachbildung und interkulturelle Erziehung in Schweden". Sie analysiert drei Maßnahmen für Migranten und ihre Kinder und erläutert die dazugehörigen Begriffsdefinitionen. Außerdem gibt die Arbeit einen Überblick über die Bevölkerung Schwedens und das schwedische Sprachgesetz. Der Begriff interkulturelles Lernen wird ebenfalls beleuchtet, sowie dessen Umsetzung in Schweden. Die Arbeit untersucht, ob Schweden ein Vorbild für Deutschland sein kann.
- Sprachbildungsmaßnahmen für Migranten und ihre Kinder
- Muttersprachlicher Unterricht (MIJ) in Schweden
- Schwedisch als Zweitsprache
- Interkulturelles Lernen in Schweden
- Vergleich mit Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Sprachbildung und interkulturelle Erziehung in Schweden" vor und erläutert den Fokus der Arbeit. Sie bezieht sich auf ein Zitat, das Schweden als Vorbild für moderne Bildungssysteme bezeichnet. Die Arbeit basiert auf dem Text „Bilinguale und Interkulturelle Erziehung in Schweden" von Sigrid Luchtenberg und weiterer einschlägiger Literatur.
Der Hauptteil beginnt mit einem Überblick über die Bevölkerung Schwedens, das sich als Einwanderungsland versteht. Die Migrantenquote beträgt 13,8%, wobei Finnen die größte Minderheit bilden. Die Zuwanderung ausländisch sprechender Menschen erfolgte erst ab dem Zweiten Weltkrieg und veränderte die Bevölkerungszusammensetzung sprunghaft. Die Gründe für die Einwanderung liegen vor allem in der Arbeitsmigration und der Flucht.
Im Anschluss wird das schwedische Sprachgesetz von 2005 behandelt, das Schwedisch als Hauptsprache definiert und Regelungen zu Minderheitssprachen, Zeichensprachen und Einwanderungssprachen enthält. Besonders relevant für diese Arbeit sind die Regelungen zu den Einwanderungssprachen, die den Zugang zur Sprache jedes Einzelnen betonen.
Der Abschnitt „Sprachbildung in Schweden — Maßnahmen für Migranten und ihre Kinder" beleuchtet die Maßnahmen für Migranten und ihre Kinder in Bezug auf die Sprachbildung. Diese Maßnahmen beinhalten das Erlernen der Muttersprache und der Zweitsprache Schwedisch sowie Unterricht in besonderen Klassenformen.
Die Begriffsdefinition Muttersprache wird zunächst geklärt. Die Muttersprache wird meist mit der Erstsprache gleichgesetzt, ist aber nicht immer identisch. Die Förderung der Muttersprache wird als wichtig für die kindliche Identität und den Erwerb der Zweitsprache angesehen.
Der Muttersprachliche Unterricht (MU) in Schweden wird als Maßnahme für die Förderung der Muttersprache vorgestellt. Bereits in den 70er Jahren wurde „aktiver Bilingualismus" als politisches Ziel der Erziehung von Migrantenkindern formuliert. 1977 wurde das Recht auf Muttersprachlichen Unterricht verankert. MU ist in Schweden freiwillig und steht allen Kindern mit mindestens einem nicht schwedisch sprechenden Elternteil zu. Der MU ist auf zwei Wochenstunden beschränkt, umfasst aber ein großes inhaltliches Spektrum. Neben der Sprachkompetenz soll der MU die Beschäftigung mit der Herkunftskultur beinhalten.
Die Begriffsdefinition Zweitsprache wird ebenfalls erläutert. Die Zweitsprache wird als jede Sprache definiert, die nach der Erstsprache erlernt wird. Sie ist lebensbedeutsam und existenziell notwendig, um sich in einer fremden Gesellschaft und Kultur zu verständigen.
Schwedisch als Zweitsprache wird als Maßnahme für die Integration von Migrantenkindern vorgestellt. Der Schwedischunterricht ist darauf ausgerichtet, die Schüler und Schülerinnen zur vollen Kompetenz in Schwedisch zu führen. Haben Schüler mit Migrationshintergrund keine dem Muttersprachenniveau entsprechenden Schwedischkenntnisse, erfolgt die Teilnahme am Schwedischunterricht als Zweitsprache.
Der Unterricht in besonderen Klassenformen wird als weitere Maßnahme für Migranten und ihre Kinder beschrieben. Diese Klassenformen umfassen Vorbereitungsklassen, Muttersprachenklassen und zusammengesetzte Klassen. Vorbereitungsklassen werden von Migrantenkindern besucht, deren Schwedischkenntnisse noch nicht zur Teilnahme am regulären Unterricht ausreichen. Muttersprachenklassen sind sprachhomogene Klassen, in denen zweisprachig nach dem schwedischen Lehrplan unterrichtet wird. Zusammengesetzte Klassen werden aus je zehn Kindern mit Schwedisch als Muttersprache und zehn Kindern mit einer anderen Muttersprache zusammengesetzt und von zwei Lehrkräften unterrichtet.
Der Abschnitt „Interkulturelles Lernen" beleuchtet die Bedeutung des Interkulturellen Lernens in Schweden. Im Lehrplan und in Gesprächen wird neben der Sprache immer wieder die Kulturvermittlung als bedeutsam angesprochen. Interkulturelles Lernen wird als das gemeinsame Lernen von Menschen unterschiedlicher nationaler bzw. ethnischer Herkunft definiert, das die Berücksichtigung der kulturell geprägten Erfahrungen sowohl im Herkunftsland als auch im Zielland einschließlich der sich entwickelnden Migrantenkultur beinhaltet.
Interkulturelles Lernen in Schweden ist nicht gesetzlich verankert, aber durch einen Reichstagsbeschluss von 1985 wird es als vergleichsweise wichtig genommen wie die muttersprachliche Erziehung. Die Implementierung von Interkultureller Erziehung in Schweden wird als ebenso wichtig genommen wie die der muttersprachlichen Erziehung. Beide Erziehungen bauen aufeinander auf. Der schwedische Lehrplan (Läroplan, 1980) enthält wesentliche Ansätze, die sich in Bezug auf ein interkulturelles Prinzip interpretieren lassen könnten. So wird zum Beispiel davon gesprochen, dass internationale Solidarität, Konflikte und Friedenserziehung berücksichtigt werden sollen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sprachbildung, interkulturelle Erziehung, Schweden, Migranten, Muttersprache, Zweitsprache, Schwedisch, Muttersprachlicher Unterricht (MIJ), Interkulturelles Lernen, Vergleich mit Deutschland, Bildungspolitik, Einwanderungsland, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das schwedische Sprachgesetz von 2005?
Es definiert Schwedisch als Hauptsprache, regelt aber auch den Schutz von Minderheitensprachen und den Zugang von Einwanderern zu ihrer eigenen Sprache.
Haben Migrantenkinder in Schweden ein Recht auf Muttersprachenunterricht?
Ja, seit 1977 ist das Recht auf freiwilligen Muttersprachenunterricht (MU) verankert, sofern mindestens ein Elternteil eine andere Muttersprache als Schwedisch spricht.
Was bedeutet „Schwedisch als Zweitsprache“ in der Schule?
Es ist ein spezielles Unterrichtsfach für Schüler mit Migrationshintergrund, das sie zur vollen Kompetenz in der Landessprache führen soll.
Wie wird interkulturelles Lernen in Schweden umgesetzt?
Obwohl nicht gesetzlich verankert, ist interkulturelle Erziehung seit 1985 ein wichtiges Prinzip, das internationale Solidarität und kulturelle Vielfalt im Lehrplan betont.
Was sind Vorbereitungsklassen in Schweden?
In diesen Klassen werden neu eingewanderte Kinder unterrichtet, deren Schwedischkenntnisse noch nicht für den regulären Unterricht ausreichen.
- Quote paper
- Julia Uhlitzsch (Author), 2011, Sprachbildung und interkulturelle Erziehung in Schweden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178616