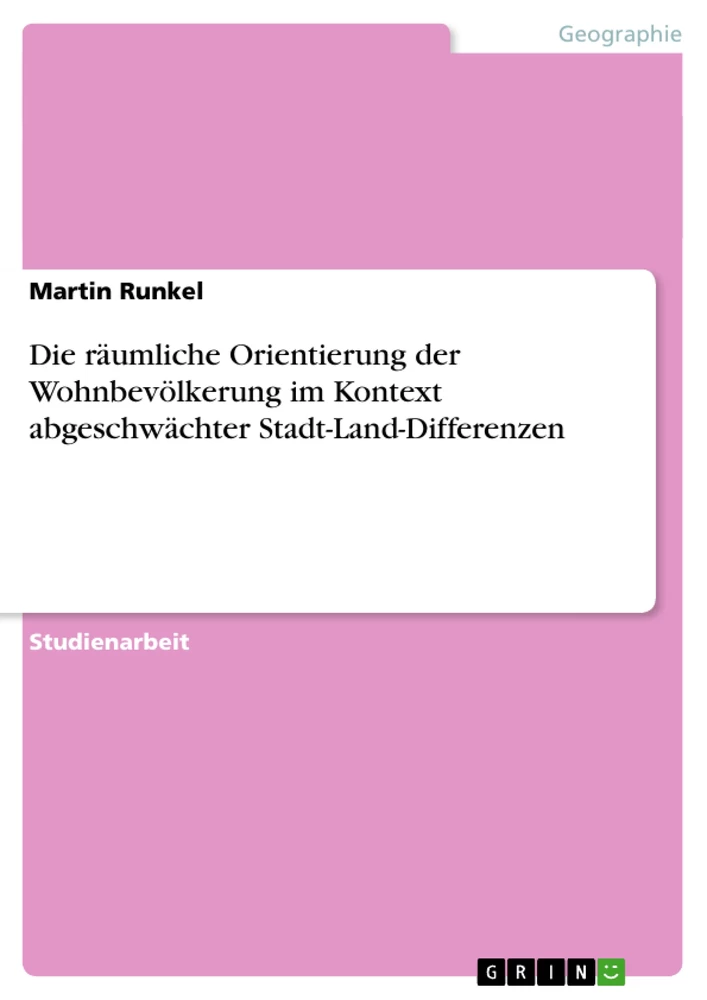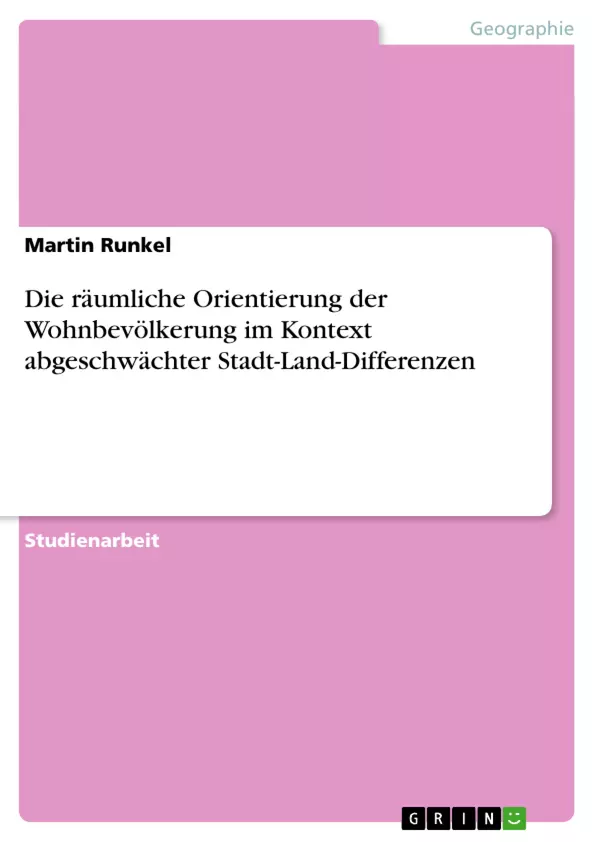Suburbanisierung lässt sich unter verschiedenen Aspekten betrachten. Unter dem empirischen
Gesichtspunkt stehen dabei vor allem der zeitliche Ablauf und die räumliche Ausprägung im
nationalen und globalen Kontext im Vordergrund. Der Blickwinkel richtet sich bei weiterer
Differenzierung auf die unterschiedlichen Landnutzungsformen, wie die Wohnsuburbanisierung,
die Einzelhandels- und Gewerbesuburbanisierung. Der vorliegende Aufsatz betont auf
dieser Betrachtungsebene die Suburbanisierung der Wohnstandorte, welche raumnutzungsbezogen
den Beginn des Entstädterungsprozesses einleitete.
Die quantitativ spärliche Literatur zum Thema Suburbanisierung untersucht die verschiedenen
Ausprägungsformen wesentlich im normativen Kontext, beschäftigt sich also mit den gesellschaftlichen
und räumlichen Konsequenzen des Prozesses.1 Zumeist wird dabei die negative
Seite der Suburbanisierung betont, also aus dem politisch-planerischen Blickwinkel werden
Kanalisierungs- und Eingrenzungspotentiale hervorgehoben, mit denen der räumlichdezentralistischen
Entwicklung Einhalt geboten werden kann. Die gewachsenen urbanen
Strukturen werden gedanklich - wenn auch nicht restituiert - zumindest konserviert. Von Seiten
der Stadtsoziologen wird die sozialräumliche Segregation mit der Suburbanisierung in
Verbindung gebracht und negativ bewertet:
„Since it is mainly the middle class that leaves the core city, the proportion of elderly, poor
people, singles, and immigrants increases in the core city creating severe financial problems
for the local authorities.”2
Doch können innerhalb eines demokratischen politischen Systems tragfähige Maßnahmen ergriffen
werden, um den Prozess zu stoppen? Bahrenberg bestreitet dies3.
Im Zentrum dieser Arbeit soll die kognitive Betrachtungsweise stehen, welche die bis dato vorangeschrittene
Abschwächung der Stadt-Land-Differenzen als gegeben hinnimmt, um so den
Blick auf die Hintergründe und Bezugsverflechtungen der räumlichen und gesellschaftlichen
Ausprägungen zu richten.
1 vgl. Brake, Dangschat, Herfert (Hrsg.), (2001)
2 Bahrenberg (c) (2003), S. 4
3 Bahrenberg (c) (2003), S. 5
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Von der Kernstadt zum Stadtland
- 2. Hintergründe der räumlichen Neuorientierung suburbaner Haushalte
- 3. Der politisch-administrative Umgang mit den Folgeerscheinungen einer mobilen Gesellschaft
- 4. Abschließende Betrachtung
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Aufsatz untersucht die räumliche Orientierung der Wohnbevölkerung im Kontext abgeschwächter Stadt-Land-Differenzen. Im Mittelpunkt steht die Wohnsuburbanisierung, ein Prozess, der seit den 1960er Jahren die Stadtentwicklung in Deutschland prägt. Der Aufsatz analysiert die Ursachen und Folgen der Suburbanisierung, beleuchtet den Umgang der Politik mit diesem Phänomen und setzt sich mit der Frage auseinander, ob und wie die Suburbanisierung beeinflusst werden kann.
- Die räumliche Ausprägung der Suburbanisierung
- Die Ursachen und Folgen der Wohnsuburbanisierung
- Der Einfluss der Suburbanisierung auf die Stadtentwicklung
- Der politisch-administrative Umgang mit der Suburbanisierung
- Möglichkeiten zur Steuerung der Suburbanisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Von der Kernstadt zum Stadtland
Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der Suburbanisierung nach und zeigt auf, wie sich die Stadt-Land-Differenzen im Zuge der Industrialisierung und der Motorisierung verändert haben. Es wird dargestellt, wie die Städte durch die Zuwanderung von Bevölkerung und Betrieben wuchsen und wie sich gleichzeitig die Suburbanisierung als Gegenbewegung zu dieser Entwicklung etablierte. Der Fokus liegt dabei auf der Wohnsuburbanisierung und ihren Auswirkungen auf die Stadtstrukturen.
2. Hintergründe der räumlichen Neuorientierung suburbaner Haushalte
Im zweiten Kapitel werden die Ursachen für die räumliche Neuorientierung suburbaner Haushalte untersucht. Es wird erläutert, welche Faktoren die Entscheidung für einen Umzug aus der Stadt ins Umland beeinflussen, beispielsweise die Suche nach mehr Wohnraum, die Verbesserung der Lebensqualität und die bessere Anbindung an die Natur. Zudem wird die Rolle des demografischen Wandels und der sozialen Mobilität in Bezug auf die Suburbanisierung beleuchtet.
3. Der politisch-administrative Umgang mit den Folgeerscheinungen einer mobilen Gesellschaft
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Suburbanisierung auf die Städte und das Umland. Es werden die Herausforderungen für die Stadtplanung und die Politik beschrieben, die durch den Prozess der Suburbanisierung entstehen. Dabei werden die Themen Verkehrsinfrastruktur, soziale Integration und die Folgen für die Finanzsituation der Städte und Gemeinden behandelt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Politik auf die Suburbanisierung reagieren kann, um negative Folgen zu vermeiden und die Entwicklung zu steuern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Suburbanisierung, Stadt-Land-Differenzen, Wohnsuburbanisierung, räumliche Orientierung, Stadtentwicklung, demografischer Wandel, soziale Mobilität, Stadtplanung, Politik, Verkehrsinfrastruktur, soziale Integration, Finanzsituation, Steuerung der Suburbanisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Wohnsuburbanisierung?
Wohnsuburbanisierung bezeichnet den Prozess, bei dem die Wohnbevölkerung aus der Kernstadt in das Umland abwandert, was oft den Beginn des Entstädterungsprozesses markiert.
Was sind die Hauptursachen für den Umzug ins Umland?
Wichtige Faktoren sind die Suche nach mehr Wohnraum, eine höhere Lebensqualität, die Nähe zur Natur sowie der demografische Wandel und soziale Mobilität.
Welche negativen Folgen hat die Suburbanisierung für Kernstädte?
Es kommt oft zur Segregation: Vor allem die Mittelschicht zieht weg, während in der Stadt ein höherer Anteil an einkommensschwachen oder älteren Menschen bleibt, was zu finanziellen Problemen der Kommunen führt.
Kann die Politik den Prozess der Suburbanisierung stoppen?
In einem demokratischen System ist dies schwierig. Die Arbeit diskutiert, ob planerische Maßnahmen zur Eingrenzung ausreichen oder ob die Entwicklung als Teil einer mobilen Gesellschaft hingenommen werden muss.
Was bedeutet „Stadtland“ in diesem Kontext?
„Stadtland“ beschreibt die Auflösung klarer Grenzen zwischen Stadt und Land hin zu einer großräumigen, dezentralen Siedlungsstruktur.
- Quote paper
- Martin Runkel (Author), 2003, Die räumliche Orientierung der Wohnbevölkerung im Kontext abgeschwächter Stadt-Land-Differenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17864