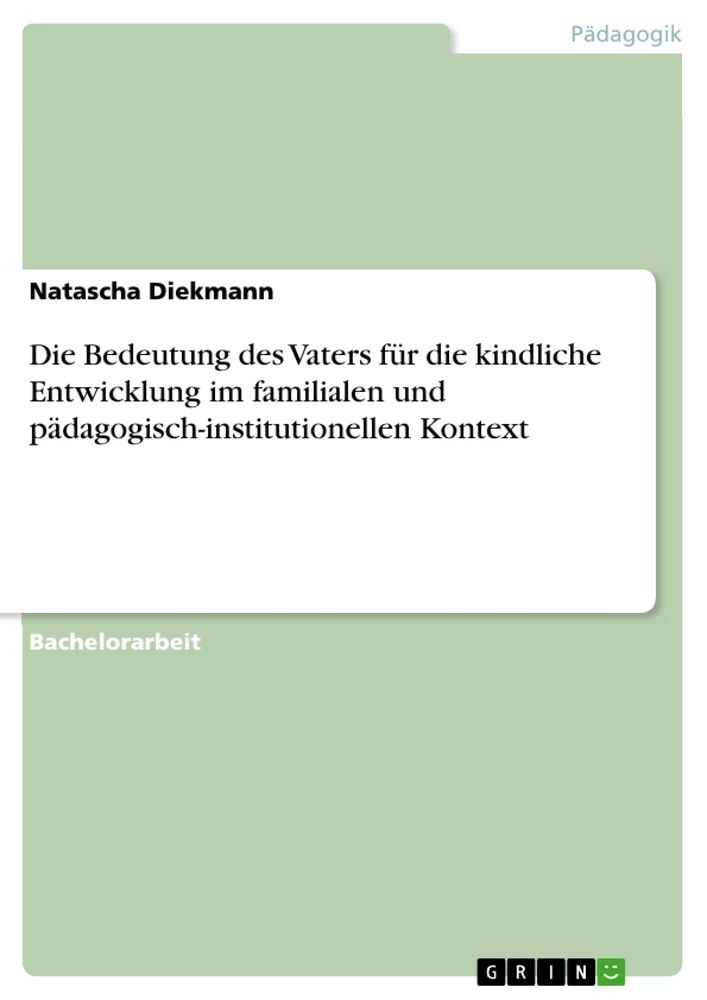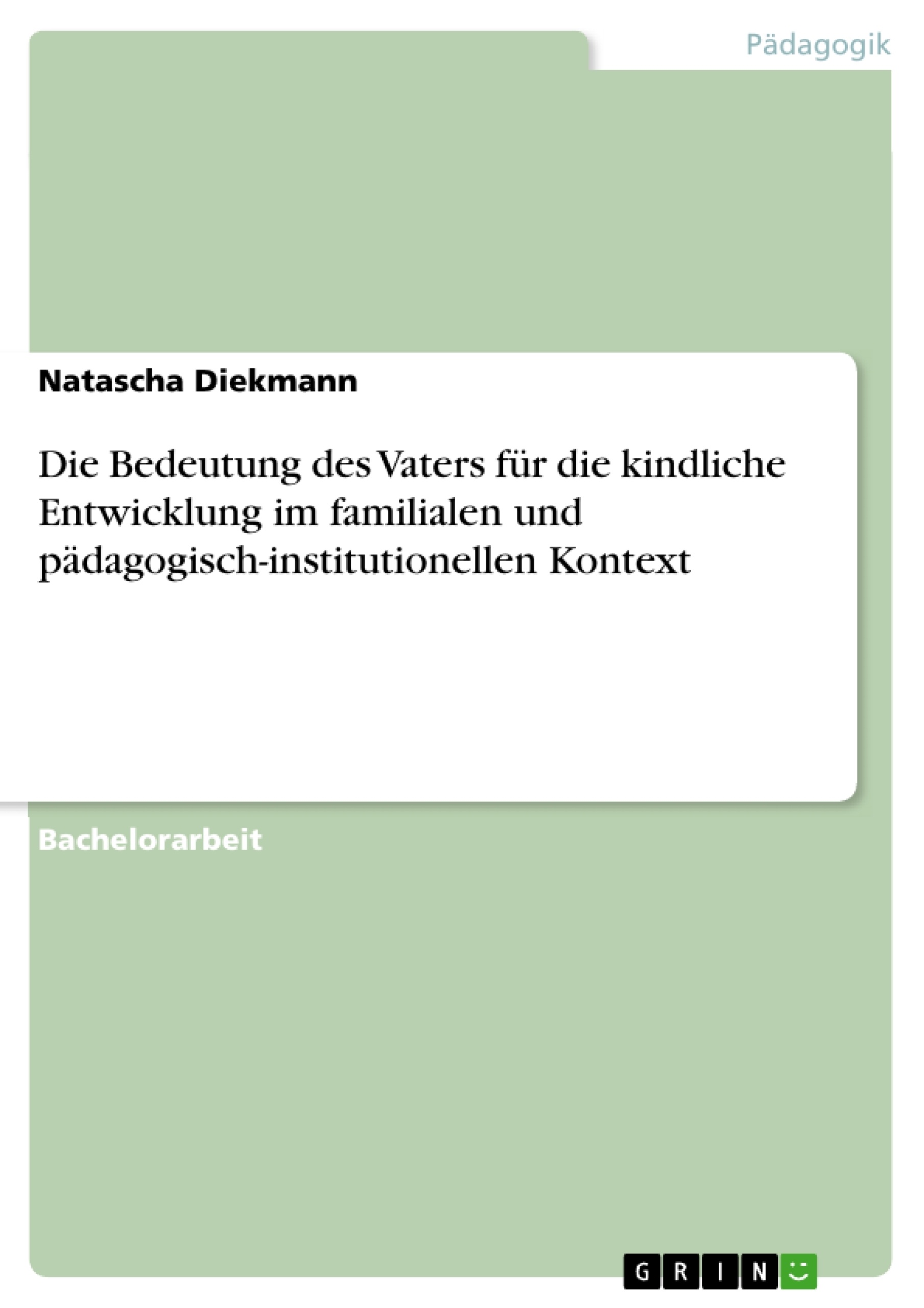Vaterschaft als soziales und familiales Phänomen gewann in der wissenschaftlichen Literatur im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung (vgl. Fthenakis 1999, S. 12).
Auch in der Öffentlichkeit gewinnt das Thema Vaterschaft an Aktualität. Das Interesse an der Thematik zeigt sich im Alltag sowie in den Massenmedien (vgl. Walter 2008, S. 8).
Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Wandel der Vaterrolle in den letzten Jahrzehnten skizziert. Ein historischer Überblick der Entwicklungen in Deutschland soll dabei den Ausgangspunkt bilden. Die weitere Basis für diese Arbeit stellen eine Begriffsklärung zum Thema Vaterschaft, die Darstellung des aktuellen Phänomens der neuen Väter sowie ein Umriss des aktuellen Forschungsstandes dar.
Der Hauptteil besteht aus zwei unterschiedlichen theoretischen Ansätzen, welche die Bedeu-tung des Vaters für die kindliche Entwicklung beinhalten. Zum einen wird Vaterschaft im Kontext der Bindungstheorie betrachtet.
Den zweiten Ansatz bildet die sozialisationstheoretische Perspektive auf Vaterschaft. Die im vorherigen Kapitel erläuterte Bindung bietet dabei die Basis für die Sozialisierbarkeit eines Kindes.
Nach dem theoretischen Hauptteil dieser Arbeit folgt eine Untersuchung der pädagogisch-institutionellen Reaktion auf den Wandel der Vaterrolle. Als Gegenstand dieser Betrachtung dient das Konzept des väterfreundlichen Kindergartens, welches zu Beginn rezipiert wird. Es folgt eine Verknüpfung der zuvor erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse mit dem vorgestell-ten Konzept. In dem letzten Abschnitt des Kapitels wird die Umsetzbarkeit des Konzeptes erörtert. Grundlage für diese Auseinandersetzung bilden die im Verlauf der Arbeit dargestell-ten kontextualen Bedingungen und der Wandel der Vaterschaft.
Diese Arbeit beschäftigt sich folglich mit der Frage, welche konkrete Bedeutung der Vater im familialen und institutionellen Bereich für die Entwicklung des Kindes hat und welche eventuellen Hindernisse vermehrtem väterlichem Engagement gegenüber stehen können.
In dem abschließenden Fazit wird das Thema Vaterschaft und der Wandel von Väterlichkeit vor dem Hintergrund dieser Arbeit diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vaterrolle im Wandel
- Historische Entwicklung der Vaterrolle in Deutschland
- Definitionen von Vaterschaft
- Neue Väter
- Forschungsstand
- Bindungstheoretische Perspektive
- Grundlagen der Bindungstheorie
- Merkmale der Vater-Kind-Bindung
- Die Fremde Situation als Instrument zur Erfassung der Vater-Kind-Bindung
- Die Spielbeziehung zwischen Vater und Kind
- Bedingungen der Vater-Kind-Bindung
- Multiple Bindungen
- Sozialisationstheoretische Perspektive
- Sozialisation in der Familie
- Direkte Sozialisation durch den Vater
- Beispiel: Geschlechtsrollenentwicklung
- Indirekte Sozialisation durch den Vater
- Beispiel: Paarbeziehung der Eltern
- Pädagogisch-institutionelle Reaktion auf den Wandel der Vaterrolle
- Der väterfreundliche Kindergarten
- Erster Schritt: Den Kindergarten „väterfreundlich" gestalten
- Zweiter Schritt: Männer aktivieren
- Dritter Schritt: Ein Programm für Väter zusammenstellen
- Vierter Schritt: Die Beteiligung der Väter aufrechterhalten
- Theoretische Betrachtung des Konzepts
- Kritische Reflexion zur Umsetzbarkeit
- Der väterfreundliche Kindergarten
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung im familialen und pädagogisch-institutionellen Kontext. Die Arbeit analysiert den Wandel der Vaterrolle in den letzten Jahrzehnten und beleuchtet die Auswirkungen von väterlichem Engagement auf die Bindungs- und Sozialisationsentwicklung von Kindern.
- Wandel der Vaterrolle in Deutschland
- Bindungstheoretische Perspektive auf die Vater-Kind-Beziehung
- Sozialisationstheoretische Perspektive auf die Rolle des Vaters
- Pädagogisch-institutionelle Ansätze zur Förderung väterlichen Engagements
- Kritische Analyse der Umsetzbarkeit von Konzepten wie dem väterfreundlichen Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel skizziert den Wandel der Vaterrolle in Deutschland seit den 1970er Jahren. Es werden historische Entwicklungen, Definitionen von Vaterschaft, das Phänomen der neuen Väter und der aktuelle Forschungsstand beleuchtet.
Kapitel 3 betrachtet die Bedeutung des Vaters aus bindungstheoretischer Perspektive. Es werden die Grundlagen der Bindungstheorie, Merkmale der Vater-Kind-Bindung, die Bedeutung der Spielbeziehung und die Bedingungen für eine sichere Vater-Kind-Bindung erläutert.
Kapitel 4 analysiert die Rolle des Vaters aus sozialisationstheoretischer Perspektive. Es werden die Sozialisation in der Familie, die direkte und indirekte Sozialisation durch den Vater und die Auswirkungen der Paarbeziehung der Eltern auf die kindliche Entwicklung behandelt.
Kapitel 5 untersucht die pädagogisch-institutionelle Reaktion auf den Wandel der Vaterrolle am Beispiel des väterfreundlichen Kindergartens. Es werden die Grundlagen des Konzepts, seine theoretische Einordnung und die kritische Reflexion zur Umsetzbarkeit dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Vaterrolle, die kindliche Entwicklung, Bindungstheorie, Sozialisationstheorie, Vater-Kind-Beziehung, Geschlechtsrollenentwicklung, väterliches Engagement, pädagogisch-institutionelle Ansätze, väterfreundlicher Kindergarten, Familienpolitik und gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Vaterrolle in Deutschland verändert?
Die Rolle wandelte sich vom traditionellen Ernährer hin zu den "neuen Vätern", die sich aktiv an Erziehung und Haushalt beteiligen möchten.
Was sagt die Bindungstheorie über die Vater-Kind-Beziehung?
Sie betont, dass Väter eigenständige Bindungsfiguren sind, wobei die Spielbeziehung oft ein zentrales Merkmal der Vater-Kind-Interaktion darstellt.
Was ist ein "väterfreundlicher Kindergarten"?
Es ist ein pädagogisches Konzept, das gezielt Maßnahmen ergreift, um Väter stärker in den Kita-Alltag einzubinden und Männer zu aktivieren.
Welchen Einfluss hat der Vater auf die Geschlechtsrollenentwicklung?
Der Vater fungiert als wichtiges Rollenvorbild und beeinflusst durch seine Interaktion direkt die Sozialisation und Identitätsbildung des Kindes.
Welche Hindernisse gibt es für aktives väterliches Engagement?
Diskutiert werden gesellschaftliche Erwartungen, berufliche Rahmenbedingungen und strukturelle Defizite in pädagogischen Institutionen.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Natascha Diekmann (Auteur), 2011, Die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung im familialen und pädagogisch-institutionellen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178656