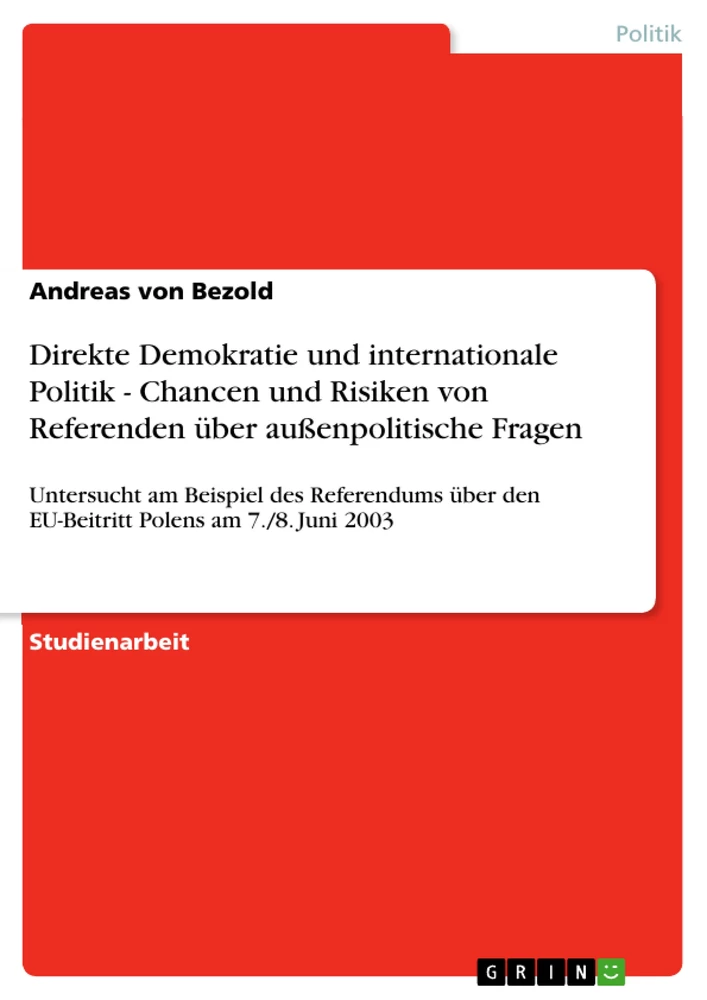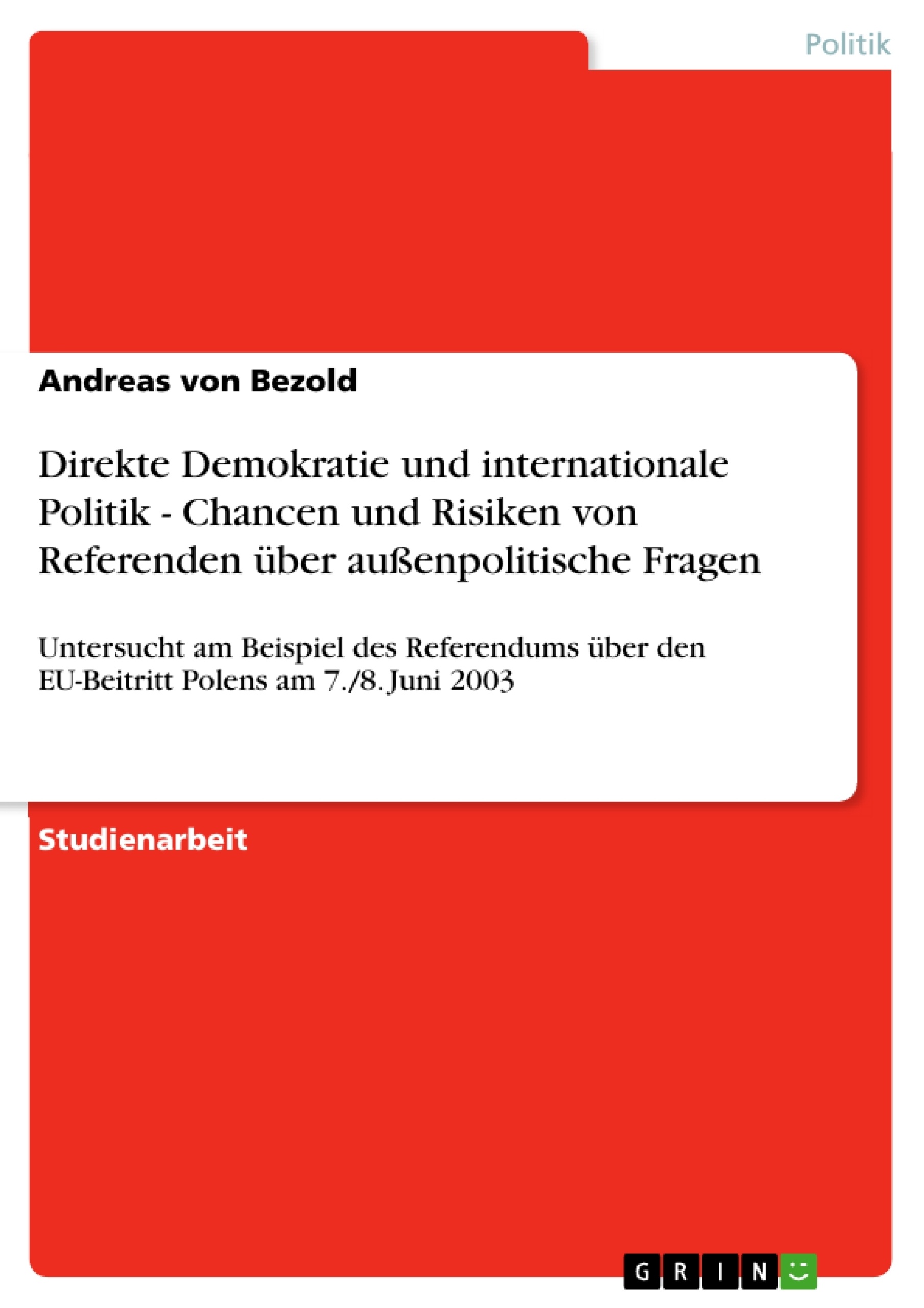Im Jahr 2003 finden neun Referenden in Ländern statt, die der Europäischen Union beitreten wollen. In jedem dieser Referenden ist die Zustimmung der Bürger der neun Länder zum von der jeweiligen Regierung gewünschten und mit den EU-Gremien ausgehandelten Beitritt zur Europäischen Union im Jahre 2004 gefragt. So ist im Jahr 2003 die Frage besonders aktuell: Ist der „Normalbürger“ fähig, verantwortlich über politische Fragen selber zu entscheiden, die Entscheidung nicht –oder nicht nur- seinen gewählten Repräsentanten zu überlassen, oder sollte sich das Maß der Demokratie auf die im Normalfall alle vier bzw. fünf Jahre stattfindenden Wahlen beschränken, da ansonsten Berechenbarkeit, Vernunft und Kontinuität in der Politik auf der Strecke bleiben? Diese Frage ist ein Dauerthema in der politischen Diskussion, und sie gewinnt noch an Brisanz, wenn die zur Entscheidung anstehenden Fragen die Außenpolitik, die Internationalen Beziehungen betreffen. Die Außenpolitik gilt als besonders sensibles Politikfeld, als das Reich der Diplomatie mit seinen ganz eigenen Spielregeln, die für den normalen Bürger nicht immer leicht zu durchschauen sind.
Und über Fragen der zwischenstaatlichen Beziehungen, internationaler Bündnisse, Verträge, ja sogar militärischer Kooperationen sollen nicht ausschließlich die Experten, sondern jeder wahlberechtigte Bürger entscheiden können? Das ist eine Frage, bei der die Meinungen weit auseinander gehen.
In dieser Arbeit möchte ich einen kurzen Überblick über die bisherige Geschichte von Referenden innerhalb Europas geben, die internationale Angelegenheiten im weitesten Sinne betreffen, und die wichtigsten politikwissenschaftlichen Theorien zu dieser Frage vorstellen.
Dazu werden die Positionen verschiedener Interessengruppen dargestellt sowie deren Versuche, auf den Ausgang des Referendums Einfluss zu nehmen. Anschließend werden die konkreten Ergebnisse vorgestellt und bewertet, im Hinblick auf den Erfolg bzw. Misserfolg der Wahlkampagnen der Interessengruppen und der Auswirkung des Ergebnisses auf die Politik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Historischer Überblick über bisherige Referenden in Europa zu internationalen Angelegenheiten
- 1.1. Referenden, die die Europäische Gemeinschaft bzw. Union betreffen
- 2. Demokratietheorien und Referenden über internationale Angelegenheiten
- 2.1. Realisten
- 2.2 Befürworter einer starken Demokratie (bei ansonsten weitgehender Beibehaltung der repräsentativen Demokratie)
- 2.3. Befürworter starker Demokratie (verbunden mit der Forderung, Elemente direkter Demokratie intensiv auszubauen, auf nationaler wie auch regionaler und kommunaler Ebene, um die Bevölkerung erst „reif“ für Referenden über außenpolitische Angelegenheiten zu machen)
- 3. Das Beispiel Polen
- 3.1 Rechtliche Grundlagen des Referendums
- 3.2 Einfluss verschiedener Interessengruppen auf Wahlbeteiligung und Wahlverhalten
- 3.2.1 Der Präsident
- 3.2.2 Die Regierung
- 3.2.3 Die Parteien³
- 3.2.4. Die Kirche
- 3.2.5 Die Wirtschaft
- 4. Die konkreten Ergebnisse des Referendums*
- 4.1 Das Abstimmungsergebnis.….…...….……………..
- 4.2 Politische Folgen des Referendums
- 5. Fazit
- 6. Anmerkungen
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von direkter Demokratie und internationaler Politik. Insbesondere untersucht sie die Chancen und Risiken von Referenden über außenpolitische Fragen am Beispiel des Referendums über den EU-Beitritt Polens im Jahr 2003.
- Die historische Entwicklung von Referenden in Europa im Kontext internationaler Angelegenheiten
- Die verschiedenen politikwissenschaftlichen Theorien zur Rolle von direkter Demokratie in der internationalen Politik
- Die Analyse des polnischen Referendums über den EU-Beitritt, einschließlich der Einflussfaktoren verschiedener Interessengruppen
- Die konkreten Ergebnisse des Referendums und deren politische Folgen
- Die Chancen und Risiken von Referenden in der internationalen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der politischen Diskussion über direkte Demokratie vor. Sie führt die zentrale Frage nach der Fähigkeit von „Normalbürgern“, eigenständig über komplexe außenpolitische Fragen zu entscheiden, ein. Anschließend werden die wichtigsten Inhalte und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
Kapitel 1 gibt einen historischen Überblick über Referenden in Europa, die internationale Angelegenheiten im weitesten Sinne betreffen. Dabei werden historische Beispiele von Referenden in Frankreich, Italien und der Schweiz präsentiert, die vor dem 20. Jahrhundert stattfanden.
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene politikwissenschaftliche Theorien zu Referenden und direkter Demokratie in der internationalen Politik. Hierbei wird das in Rourke/Hiskes/ Zirakzadeh 1992 entworfene Schema als Grundlage verwendet. Dieses Schema unterscheidet verschiedene Positionen von Realisten, Befürwortern einer starken Demokratie und Befürwortern von intensiverem Ausbau direkter Demokratie.
Kapitel 3 fokussiert auf das Beispiel des polnischen Referendums über den EU-Beitritt im Jahr 2003. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen des Referendums und untersucht den Einfluss verschiedener Interessengruppen auf Wahlbeteiligung und Wahlverhalten.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Referendum, Internationale Politik, Außenpolitik, EU-Beitritt, Polen, Interessengruppen, Wahlbeteiligung, Wahlverhalten, politische Folgen, Chancen, Risiken
Häufig gestellte Fragen
Sind Bürger fähig, über komplexe außenpolitische Fragen abzustimmen?
Dies ist ein Dauerthema der politischen Diskussion; Kritiker befürchten den Verlust von Berechenbarkeit, während Befürworter die demokratische Legitimation betonen.
Welches Beispiel für ein außenpolitisches Referendum wird untersucht?
Die Arbeit fokussiert auf das Referendum über den EU-Beitritt Polens im Jahr 2003.
Welche Interessengruppen beeinflussten das polnische Referendum?
Zu den einflussreichen Gruppen gehörten der Präsident, die Regierung, die politischen Parteien, die Kirche und Wirtschaftsverbände.
Was sagen "Realisten" zu Referenden über internationale Angelegenheiten?
Realisten stehen direkter Demokratie in der Außenpolitik oft skeptisch gegenüber, da sie die Diplomatie als Expertenfeld mit eigenen Spielregeln betrachten.
Welche Risiken bergen Referenden in der internationalen Politik?
Risiken sind mangelnde Kontinuität, mögliche populistische Beeinflussung und die Erschwerung langfristiger internationaler Bündnisse durch unvorhersehbare Bürgerentscheide.
- Quote paper
- Andreas von Bezold (Author), 2003, Direkte Demokratie und internationale Politik - Chancen und Risiken von Referenden über außenpolitische Fragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17867