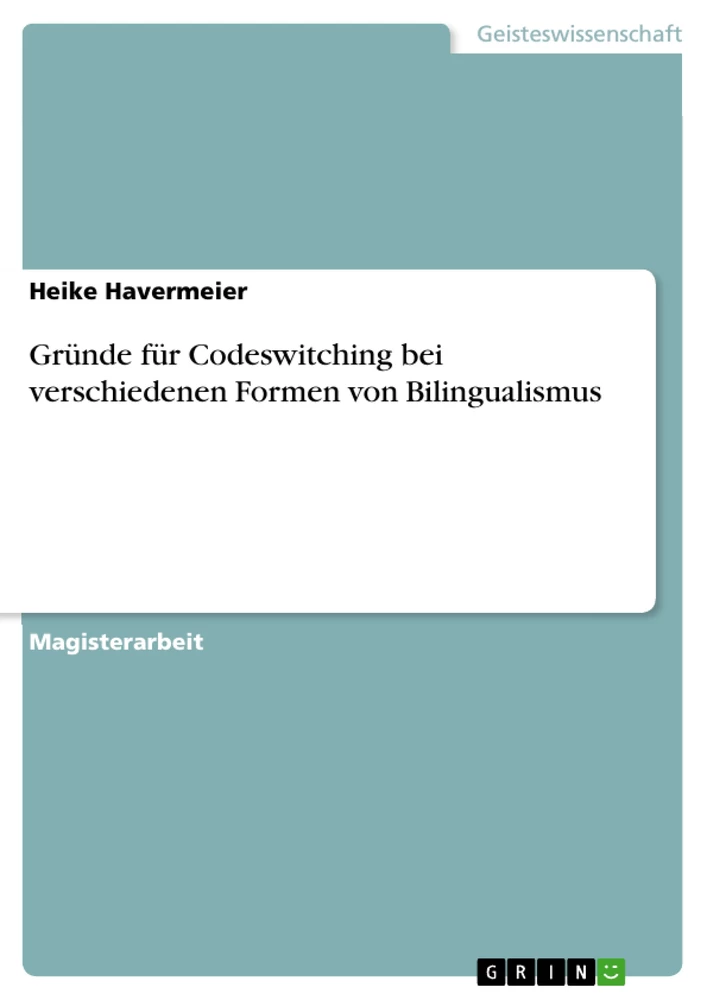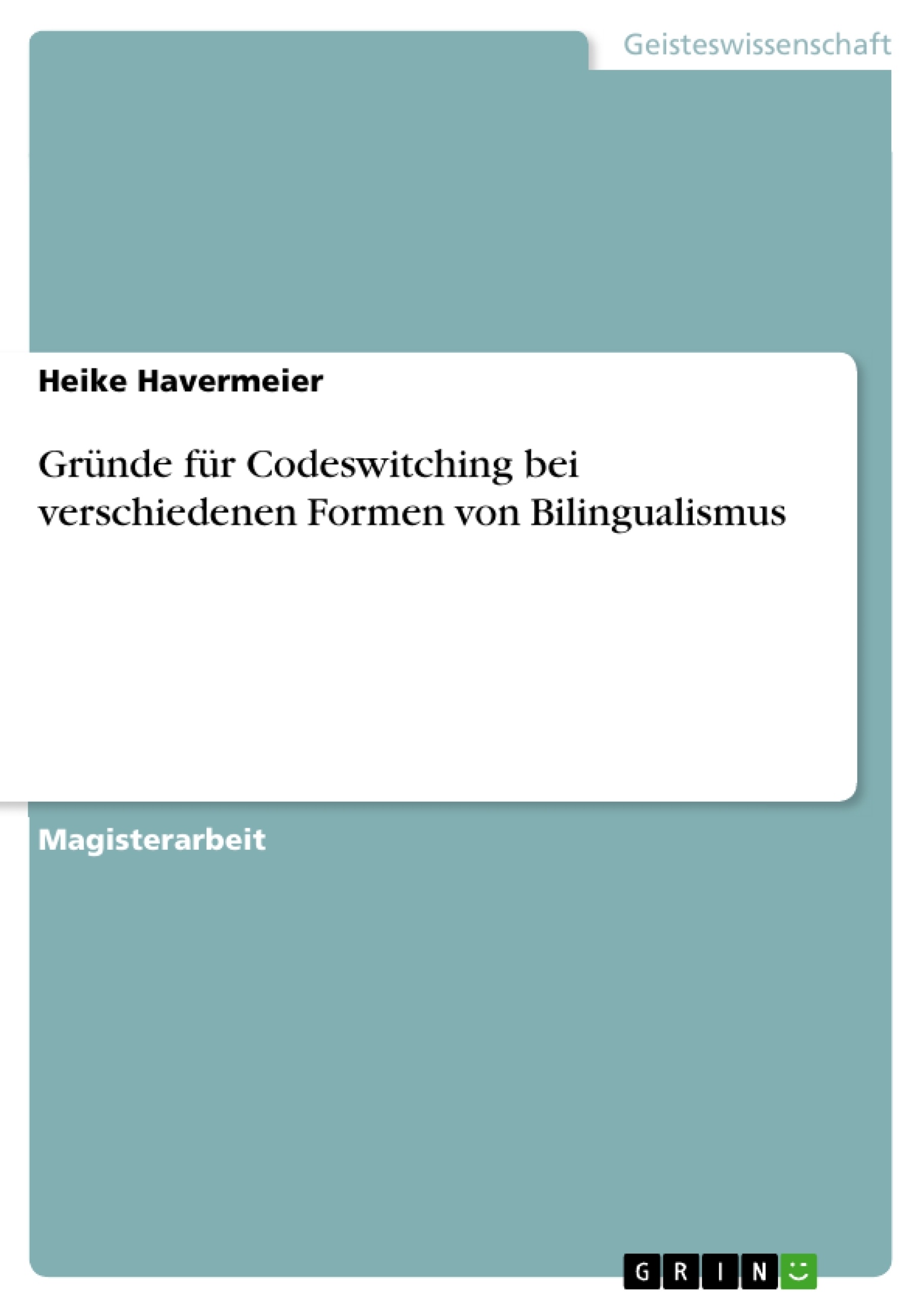Das Operieren mit mehr als einer Sprache ist ein Phänomen, das uns heutzutage in unserem Leben ständig und überall begegnet. Oft sind Leute gezwungen, andere Sprachen als ihre Muttersprache zu benutzen, und viele haben gar mehrere Muttersprachen. Auch, dass es beim Umgang mit mehreren Sprachen zu Vermischungen aus Elementen dieser verschiedenen Einzelsprachen kommt, begegnet uns im Alltag immer wieder. Es passiert oft, dass Menschen um uns herum in Gesprächen und Texten mehrere Sprachen wechseln oder mischen.
Man spricht in diesen Fällen von Codeswitching. Besonders oft tritt dieses Phänomen bei Immigranten auf, die eine andere Muttersprache haben als die übliche Umgangssprache des Landes, in dem sie leben, untereinander aber diese Muttersprache benutzen. Es gibt jedoch verschiedene Formen des Bilingualismus, etwa den Fall von Sprechern, die von ihrem Vater die eine und von ihrer Mutter die andere Sprache vermittelt bekommen haben, also mit zwei Muttersprachen aufgewachsen sind. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Formen der Zweisprachigkeit, die auf unterschiedliche Art und Weise zustande kommen können. Bei allen diesen Formen von Bilingualismus kann es zum Codeswitching kommen.
In der hier vorliegenden Arbeit soll es darum gehen, ob sich die Art des Erwerbs der verschiedenen Sprachen auf das Codeswitching-Verhalten auswirkt. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, wodurch Codeswitching ausgelöst wird, also aus welchen Gründen die Sprecher bei unterschiedlichen Formen von Bilingualismus die Sprache wechseln. Dazu wurden weisprachige Gespräche von drei Untersuchungsgruppen, deren Mitglieder auf unterschiedliche Arten bilingual sind, mit einer einheitlichen Methode festgehalten und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Definitionen
- Was ist Bilingualismus?
- Bilingualismus aus psycholinguistischer Sicht
- Verschiedene Formen von Bilingualismus
- Was ist Codeswitching?
- Beschreibungsmodelle zur Oberflächenstruktur
- Das Two-Constraints-Modell
- Das Matrix-Language-Frame-Modell
- Muyskens Code-mixing-Typologie
- Was ist ein Code?
- Die Abgrenzung von Codeswitching und Entlehnung
- Motive für Codeswitching
- Verschiedene Sprachen für verschiedene Domänen
- Codeswitching als Mittel der Gesprächsorganisation
- Die Klassifikation von Peter Auer
- Weitere Forschung zu Codeswitching zur Gesprächsorganisation
- Zwischen Domäne und Gesprächsstrategie: Das Markiertheitsmodell von Myers-Scotton
- Clynes Entdeckungen am Rande der Soziolinguistik: Triggering und Sprachökonomie
- Triggering als psycholinguistischer Auslöser für Codeswitching
- Sprachökonomie als Grund für Codeswitching
- Kindlicher Bilingualismus: Codeswitching aus Sicht der Spracherwerbsforschung
- Klassifikation der Gründe für Codeswitching
- Zusammenstellungen und Typologien in der bisherigen Literatur
- Eigene Einteilung
- Eigene Untersuchung
- Zielsetzung
- Methode
- Die untersuchten Personen
- Analyse
- Ermittlung des zugrunde liegenden Codes
- Die Zuordnung von Gründen
- Zuordnung von Echo-Verhalten
- Kongruente Lexikalisierung
- Probleme mit Codeswitching aufgrund eines Adressatenwechsels
- Analyse der einzelnen Personen
- Zusammenfassung: Die Untersuchungsgruppen im Vergleich
- Mögliche Kritikpunkte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Gründe für Codeswitching bei verschiedenen Formen von Bilingualismus. Sie stellt eine Pilotstudie dar, die aufzeigen soll, ob sich die Art des Erwerbs der verschiedenen Sprachen auf das Codeswitching-Verhalten auswirkt. Die Studie zielt darauf ab, die Auslöser für Codeswitching bei verschiedenen Formen von Bilingualismus zu erforschen, um zu ermitteln, ob sich charakteristische Muster für bestimmte Formen des Bilingualismus zeigen.
- Die verschiedenen Formen von Bilingualismus und ihre Auswirkungen auf das Codeswitching-Verhalten
- Die Auslöser für Codeswitching, die in der bisherigen Forschung identifiziert wurden
- Die Entwicklung einer Klassifikation von Gründen für Codeswitching
- Die Durchführung einer Pilotstudie, die verschiedene Formen von Bilingualismus und ihre Auslöser für Codeswitching vergleicht
- Die Bewertung der Ergebnisse der Pilotstudie und die Identifizierung von Forschungsbedarfen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 befasst sich mit den grundlegenden Definitionen von Bilingualismus und Codeswitching. Es wird ein Überblick über die Forschungsgeschichte und die Definitionen verschiedener Autoren gegeben. Außerdem werden die wichtigsten Beschreibungsmodelle zur Oberflächenstruktur von Codeswitching vorgestellt, darunter das Two-Constraints-Modell, das Matrix-Language-Frame-Modell und Muyskens Code-mixing-Typologie. Schließlich wird die Abgrenzung von Codeswitching und Entlehnung diskutiert.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die bisherige Forschung nach Gründen für Codeswitching. Es werden die beiden Hauptannahmen, Codeswitching aufgrund von Diglossie und Codeswitching als Diskursstrategie, erläutert. Die wichtigsten Werke der Forschungsgeschichte werden kurz wiedergegeben und die Gründe für Codeswitching, die darin genannt werden, näher betrachtet. Darüber hinaus werden die von Clyne dargestellten Gründe Triggering und Sprachökonomie sowie die Forschung zum bilingualen kindlichen Spracherwerb erläutert. Zum Abschluss werden einige Vorschläge für Übersichten und Typologien für Codeswitching-Motive vorgestellt und versucht, eine eigene sinnvolle Klassifizierung der in der bisherigen Literatur genannten Gründe zu erstellen.
Kapitel 4 stellt die eigene Untersuchung dar. Die empirische Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, zu erforschen, ob sich die Art des Erwerbs der verschiedenen Sprachen auf das Codeswitching-Verhalten auswirkt. Die Studie umfasst drei Gruppen von Untersuchungspersonen: klassische Bilinguale, die als Kinder nach dem Prinzip „eine Person — eine Sprache" erzogen wurden, Personen, die mit einer Sprache als der ihrer Familie und einer als der der Öffentlichkeit aufgewachsen sind, und Migranten, die als Erwachsene in ein Land gezogen sind, in dem nicht ihre Muttersprache gesprochen wird. Die Methode der Studie besteht aus einer Kombination von Korpusanalyse und gezielter Sprecherbefragung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bilingualismus, Codeswitching, die verschiedenen Formen des Bilingualismus, die Auslöser für Codeswitching, die Gesprächsorganisation, die Domänen des Sprachgebrauchs, Triggering, Sprachökonomie, die psycholinguistische Perspektive und die empirische Untersuchung von Codeswitching-Verhalten.
- Citation du texte
- Heike Havermeier (Auteur), 2008, Gründe für Codeswitching bei verschiedenen Formen von Bilingualismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178700