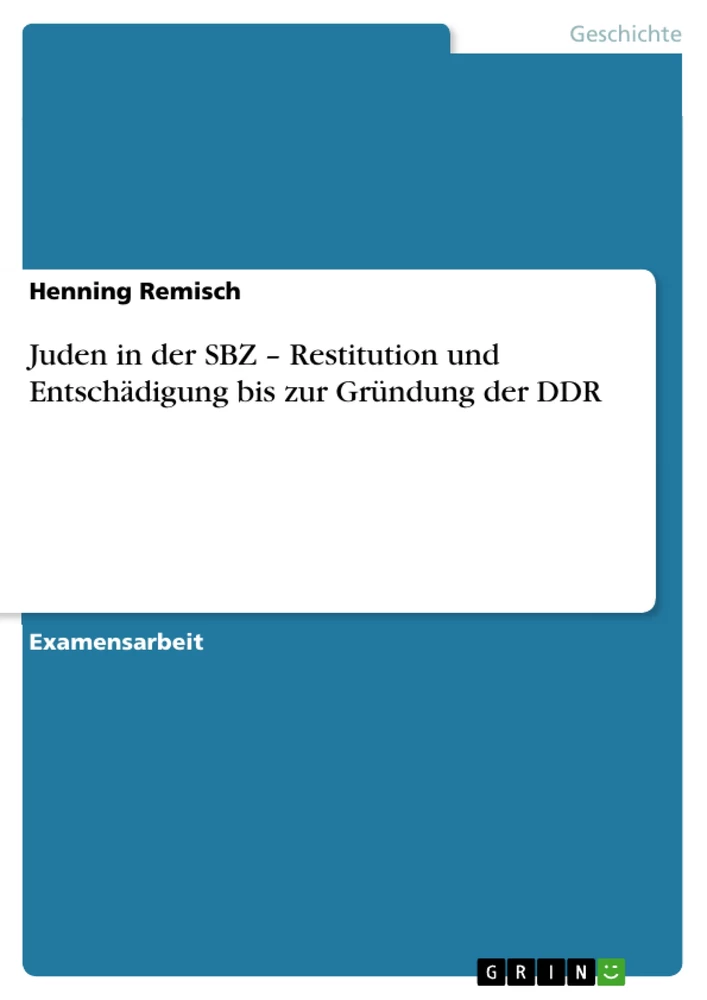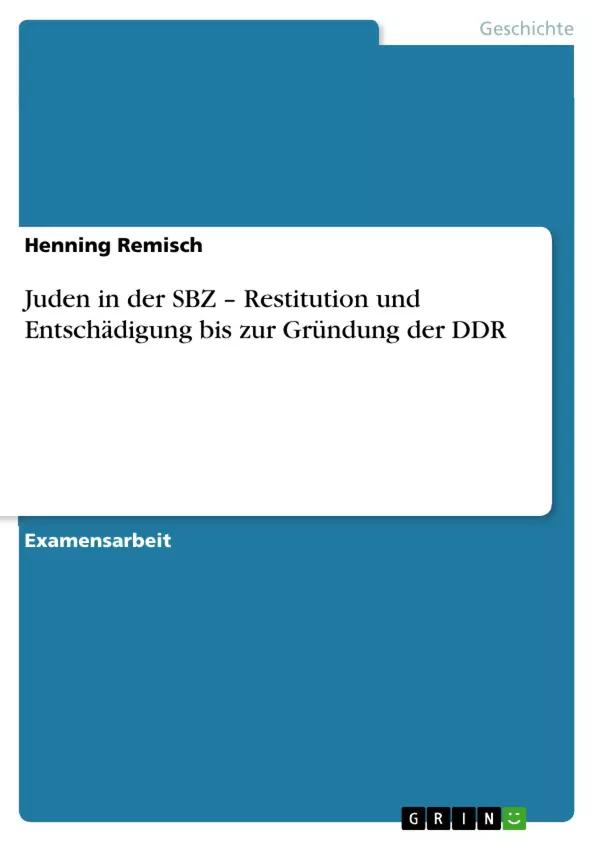[...] Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Schritt werden die im
Verhältnis zueinander stehenden ideologischen, wirtschaftlichen und
politischen Bedingungen beschrieben, welche sowohl die Konstitution als
auch den Verlauf der Wiedergutmachungspolitik mittelbar und unmittelbar
beeinflussten. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der
kommunistischen Auffassung des Faschismusbegriffes und den daraus
abgeleiteten Schlüssen zukommen. Anschließend werden die
wirtschaftlichen Voraussetzungen der SBZ geschildert, mit Fokus auf das
sogenannte Trilemma der Verteilungsgerechtigkeit: Die Gleichzeitigkeit
von Reparationszahlungen an die Sowjetunion, die allein die SBZ zu
tragen hatte, dem Wiederaufbau einer Wirtschaft und der
Wiedergutmachung gegenüber den Juden.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den konkreten
Wiedergutmachungsbemühungen innerhalb der SBZ. Zu einem besseren
Verständnis wird zunächst ein kurzer Abschnitt vorangestellt, der die
„Arisierungspolitik“ der Nazis umreißt. Danach gilt, neben der Schilderung
erster Hilfsmaßnahmen, und vereinzelten Wiedergutmachungsbemühungen
in den Ländern der SBZ, dem Thüringer
Wiedergutmachungsgesetz ein besonderes Interesse, da es das erste und
einzige Gesetz war, welches umfassendere Rückerstattungsbestimmungen
beinhaltete.
Von wesentlich größerer Tragweite für den weiteren Verlauf der
Wiedergutmachungspolitik war jedoch die so genannte VdN–Verordnung
(Anordnung zur Sicherung der rechtlichen Stellung der anerkannten Verfolgten des Naziregimes) vom 05. Oktober 1949. Die Probleme und
Schwierigkeiten, die, von den ersten Überlegungen eines
Wiedergutmachungsgesetzes bis hin zu seiner tatsächlichen
Zementierung, auftraten, rücken dabei ins Zentrum der Betrachtung. Mit
dem VdN-Gesetz war die Wiedergutmachungspolitik aus Sicht der DDRFührung
quasi beendet.
Der dritte und letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich daher mit den immer
wieder an die DDR herangetragenen Wiedergutmachungsforderungen
sowohl von Seiten des Staates Israel als auch seitens us-amerikanischer
Interessensvertreter jüdischer Restitutions- und
Entschädigungsansprüche. Dabei sollen Gründe und Begründungen
herausgearbeitet werden, mit denen es der DDR-Führung immer wieder
gelang, den an sie herangetragenen Forderungen auszuweichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik
- Forschungsstand
- Interpretationsrahmen für Restitution und Entschädigung
- Der kommunistische Faschismusbegriff
- Die ideologische Hierarchisierung
- Die sowjetischen Reparationen
- Entschädigung und Restitution in der SBZ
- Die Nationalsozialistische Enteignung jüdischen Besitzes
- Unmittelbare Fürsorgemaßnahmen
- Bemühungen in den Ländern der SBZ
- Das Wiedergutmachungsgesetz in Thüringen
- Ansätze in den restlichen Ländern
- Die Rückgabe von Gemeindeeigentum
- Streit um Wiedergutmachung
- Debatten in der SED
- Das VdN-Gesetz
- Konsequenzen und antisemitische Wellen
- Ideologische Dogmen und konsequente Verweigerung
- Israelische Forderungen
- Verhandlungen mit den USA
- Ende und Neubeginn
- Résumee
- Bibliographie
- Quellen
- Literatur
- Anhang
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit analysiert die Behandlung der Wiedergutmachungsfrage für jüdische Überlebende des Holocaust in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der späteren DDR. Die Arbeit untersucht die spezifischen Bedingungen, unter denen Restitution und Entschädigung stattfanden, und beleuchtet die ideologischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die die Wiedergutmachungspolitik der DDR prägten.
- Die kommunistische Interpretation des Faschismus und ihre Auswirkungen auf die Opferhierarchie
- Die Rolle der sowjetischen Reparationsforderungen und die daraus resultierende wirtschaftliche Belastung der SBZ/DDR
- Die konkreten Bemühungen um Restitution und Entschädigung in der SBZ, insbesondere das Thüringer Wiedergutmachungsgesetz
- Die ideologischen und politischen Hindernisse, die eine umfassende Wiedergutmachung in der DDR verhinderten
- Die Reaktion der DDR auf israelische Forderungen und die Verhandlungen mit den USA über Wiedergutmachungszahlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den Forschungsstand zum Verhältnis zwischen SBZ/DDR und den in ihr lebenden Juden. Das zweite Kapitel beleuchtet den Interpretationsrahmen für Restitution und Entschädigung in der SBZ. Es analysiert den kommunistischen Faschismusbegriff, die daraus resultierende ideologische Hierarchisierung der NS-Verfolgten und die Bedeutung der sowjetischen Reparationsforderungen für die Wiedergutmachungspolitik.
Das dritte Kapitel widmet sich der Entschädigung und Restitution in der SBZ. Es beschreibt die Enteignung jüdischen Besitzes durch die Nazis, die unmittelbaren Fürsorgemaßnahmen in der SBZ und die Bemühungen in den einzelnen Ländern, insbesondere das Thüringer Wiedergutmachungsgesetz. Weiterhin werden die Versuche einer zonenweiten Regelung der Wiedergutmachungsfrage und die Verabschiedung des VdN-Gesetzes im Jahr 1949 beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert den Streit um die Wiedergutmachung in der DDR. Es untersucht die Debatten innerhalb der SED, die israelischen Forderungen und die Verhandlungen mit den USA über Entschädigungszahlungen. Das Kapitel beleuchtet die ideologischen und politischen Hindernisse, die eine umfassende Wiedergutmachung verhinderten, und die Reaktion der DDR auf die internationalen Forderungen.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt, dass die Behandlung der Wiedergutmachungsfrage in der SBZ/DDR von einem komplexen Gefüge ideologischer, wirtschaftlicher und politischer Faktoren geprägt war. Die Arbeit verdeutlicht, wie die kommunistische Interpretation des Faschismus und die sowjetischen Reparationsforderungen die Wiedergutmachungspolitik der DDR prägten und eine umfassende Restitution und Entschädigung verhinderten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wiedergutmachung, Restitution, Entschädigung, Juden, Holocaust, SBZ, DDR, Kommunismus, Faschismus, Reparationen, Opferhierarchie, Thüringer Wiedergutmachungsgesetz, VdN-Gesetz, Israel, USA, Claims Conference, antisemitische Politik, und die deutsche Wiedervereinigung. Die Arbeit untersucht die ideologischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die die Behandlung der Wiedergutmachungsfrage in der SBZ/DDR prägten.
Häufig gestellte Fragen
Wie ging die SBZ mit jüdischen Entschädigungsansprüchen um?
Die Politik war von einer ideologischen Hierarchisierung geprägt, bei der "Kämpfer gegen den Faschismus" gegenüber "Opfern des Faschismus" (darunter Juden) bevorzugt wurden.
Was war das Thüringer Wiedergutmachungsgesetz?
Es war das erste und einzige Gesetz in der SBZ, das umfassendere Rückerstattungsbestimmungen für NS-Verfolgte enthielt, bevor die SED-Führung den Kurs änderte.
Welche Rolle spielten sowjetische Reparationen?
Die hohen Reparationslasten führten zu einem Verteilungstrilemma zwischen Wiederaufbau, Reparationen und Wiedergutmachung, wobei letztere oft vernachlässigt wurde.
Warum verweigerte die DDR später Zahlungen an Israel?
Die DDR-Führung argumentierte ideologisch, dass sie als antifaschistischer Staat nicht für die Verbrechen des NS-Regimes haftbar sei und sah in Israel einen "Agenten des US-Imperialismus".
Was regelte die VdN-Verordnung von 1949?
Die Verordnung sicherte die rechtliche Stellung anerkannter Verfolgter, zementierte aber gleichzeitig die Benachteiligung rein rassisch Verfolgter gegenüber politischen Widerstandskämpfern.
- Citar trabajo
- Henning Remisch (Autor), 2008, Juden in der SBZ – Restitution und Entschädigung bis zur Gründung der DDR, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178720