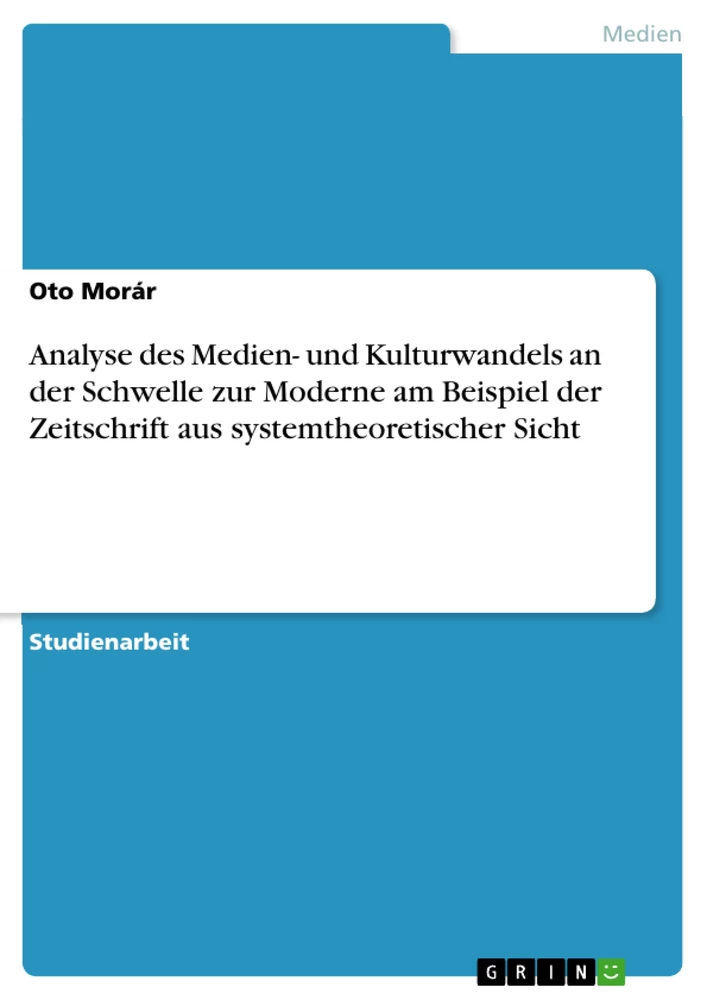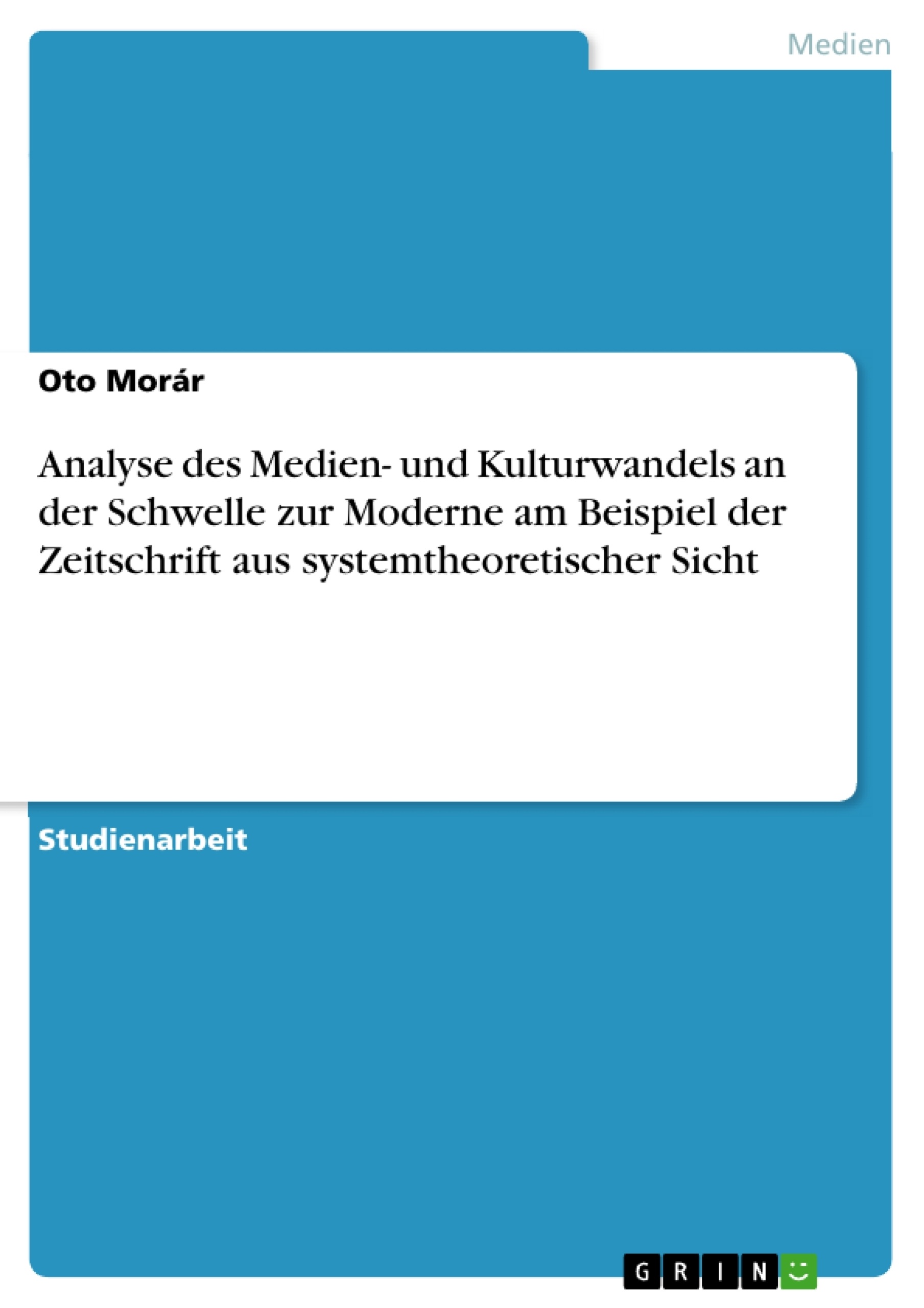Der Zusammenhang zwischen Kultur- und Mediengeschichte ist unstrittig. Neuere medientheoretische Ansätze gehen davon aus, dass gesellschaftliche Wirklichkeiten durch Medien konstituiert werden. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Sichtweise hat der Soziologe Niklas Luhmann geliefert. In seiner Systemtheorie stellt er die Verbindung zwischen Kommunikation und Gesellschaft als ein zirkuläres Verhältnis in laufender Evolution her. Er unterscheidet drei Phasen der kommunikativen und gesellschaftlichen Evolution, wobei der Phasenübergang zwischen den Gesellschaftsformen durch eine Änderung in der Kommunikation begleitet wird. Der zeitlich jüngste Übergang führte zu einer funktionalen Differenzierung der Gesell-schaft mit autonomen Teilsystemen wie Politik, Recht, Wirtschaft, Kunst oder Wissenschaft. Seiner Meinung nach geht die Ausbildung der Massenmedien, welche selbst als eigenständiges Funktionssystem der modernen Gesellschaft zu betrachten sind, mit dieser Ausdifferenzierung einher.
In dem Zeitraum um 1800 entfalten neue literarische Gattungen ihre Form. Sowohl die Blüte der Briefkultur, als auch die Verbreitung des Romans kann in das 18. Jahrhundert verortet werden. Auf der anderen Seite entwickeln im Bereich der publizistischen Printmedien neben der Zeitung auch das Intelligenzblatt und die Zeitschrift ihre Wirkungen, die im gesellschaftlichen Alltag direkt spürbar werden. Das aufgeklärte, moderne Individuum beginnt durch die Printmedien die Welt aus einer neuen Perspektive zu erfahren.
Diese Harbeit behandelt die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen Medien- und Kulturwandel am Beispiel der Zeitschrift systemtheoretisch begründet werden kann und wie sich dieser darstellt. Für die Beantwortung der Frage soll die gesellschaftliche Prägekraft der Zeitschrift aufgezeigt werden. Im Zentrum der Argumentation wird die Wirkung des Mediums Zeitschrift auf den Strukturwandel der Gesellschaft stehen. Die medientheoretischen und sozialhistorischen Zusammenhänge werden anhand ausgewählter systemtheoretischer Aspekte untersucht. Herangezogen werden dazu drei im 18. Jahrhundert sich entwickelnde Phänomene der modernen Gesellschaft. Betrachtet werden erstens die Beziehung zwischen den Differenzierungsprozessen gesellschaftlicher Teilsysteme und der Ausdifferenzierung von Medien, insbesondere in der Form von Zeitschriftentypologien, zweitens die „Beobachter-Haltung“ der Moderne und drittens die Entstehung einer medialen Öffentlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SYSTEMTHEORETISCHER KONTEXT
- Kommunikation und Massenmedien
- Ausdifferenzierung, Beobachtung und Öffentlichkeit
- MEDIEN- UND KULTURWANDEL ZUR MODERNE
- Medienwandel: Entwicklung der Zeitschrift
- Kulturwandel: gesellschaftliche Auswirkungen aus systemtheoretischer Sicht
- Ausdifferenzierung
- Beobachtung der Moderne
- Öffentlichkeit
- ZUSAMMENFASSUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Medien- und Kulturwandel an der Schwelle zur Moderne anhand des Beispiels der Zeitschrift aus systemtheoretischer Sicht. Sie untersucht, ob und wie ein Zusammenhang zwischen Medien- und Kulturwandel systemtheoretisch begründet werden kann und welche Auswirkungen die Zeitschrift auf den Strukturwandel der Gesellschaft hatte.
- Die Ausdifferenzierung von Gesellschaft und Medien im 18. Jahrhundert
- Die Entstehung der „Beobachter-Haltung" in der Moderne
- Die Herausbildung einer medialen Öffentlichkeit
- Die Rolle der Zeitschrift als zentrales Massenmedium der Aufklärung
- Die Wechselwirkungen zwischen Medienevolution und Kulturentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Kultur- und Mediengeschichte dar und führt den systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann ein. Sie erläutert die Bedeutung der Massenmedien für die moderne Gesellschaft und die drei Phänomene der Ausdifferenzierung, Beobachtung und Öffentlichkeit, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden.
Kapitel 2 skizziert den systemtheoretischen Kontext und definiert die zentralen Begriffe der funktionalen Ausdifferenzierung, der Beobachtung und der medialen Öffentlichkeit.
Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung der Zeitschrift vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Es werden die wichtigsten medialen Meilensteine, die typologische Vielfalt und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Zeitschriftenentwicklung dargestellt.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beurteilt, ob und inwieweit die Zeitschrift als ein geeignetes Beispiel für den Nachweis herangezogen werden kann, dass Medien gesellschaftliche Wirklichkeiten konstituieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Zeitschrift, Medienwandel, Kulturwandel, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung, Beobachtung, Öffentlichkeit, Aufklärung, Moderne, bürgerliche Gesellschaft, Medienrevolution.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Medien- und Kulturwandel laut Niklas Luhmann zusammen?
Luhmann sieht ein zirkuläres Verhältnis: Gesellschaftliche Wirklichkeiten werden durch Kommunikation und Medien konstituiert, während Medienevolutionen den Strukturwandel der Gesellschaft begleiten.
Warum ist die Zeitschrift ein wichtiges Beispiel für diesen Wandel?
Die Zeitschrift entwickelte sich im 18. Jahrhundert zu einem zentralen Massenmedium der Aufklärung, das die funktionale Differenzierung der Gesellschaft widerspiegelte und förderte.
Was bedeutet "funktionale Differenzierung" in der Moderne?
Es bezeichnet die Aufteilung der Gesellschaft in autonome Teilsysteme wie Politik, Wirtschaft, Recht, Kunst und Wissenschaft, die jeweils eigene Logiken verfolgen.
Welche Rolle spielt die "Beobachter-Haltung" der Moderne?
Durch Printmedien wie Zeitschriften lernt das moderne Individuum, die Welt aus neuen Perspektiven zu erfahren und gesellschaftliche Prozesse kritisch zu beobachten.
Was ist die mediale Öffentlichkeit laut dieser Arbeit?
Es ist ein durch Massenmedien geschaffener Raum, in dem gesellschaftliche Themen verhandelt werden und der untrennbar mit der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft verbunden ist.
- Citation du texte
- Oto Morár (Auteur), 2011, Analyse des Medien- und Kulturwandels an der Schwelle zur Moderne am Beispiel der Zeitschrift aus systemtheoretischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178726