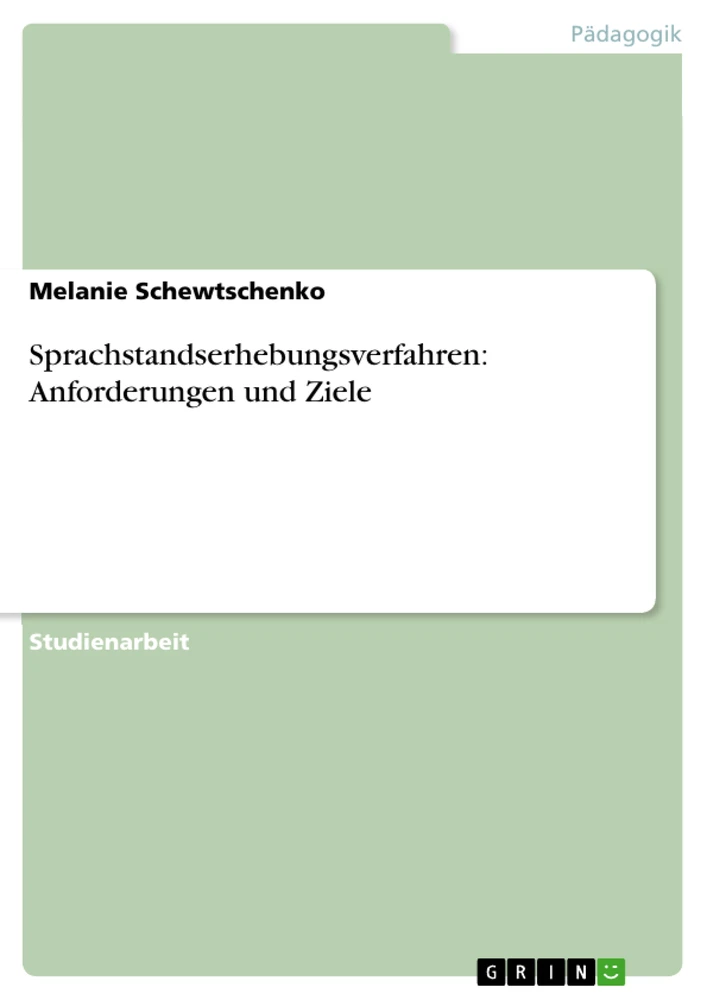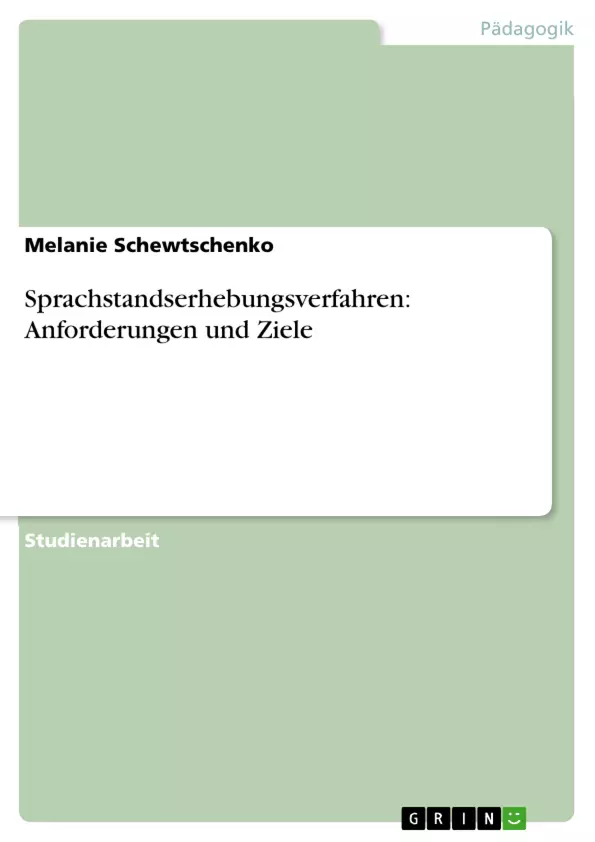Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Sprachstandserhebungs-verfahren“. Nach Fried (2007) ist „Sprache die Grundlage oder auch der Schlüssel für Bildung, da sie eng mit anderen Entwicklungsbereichen wie zum Beispiel der sozialen und emotionalen Kompetenz oder auch der kognitiven Entwicklung zusammen hängt.“ Dank der schlechten Ergebnisse der PISA-Studie wurde Sprachförderung als vorrangiges Ziel erkannt. Da in den letzten Jahren bei den Schulanfängern immer wieder sprachliche Defizite festgestellt wurden, sollte das Ziel der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten sein, alle Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung so zu fördern, dass sie bei Schuleintritt dem Unterricht folgen und sich aktiv mit ihrer Sprache beteiligen können. Besonders in der frühen Kindheit ist eine Sprachförderung sehr effektiv, da Defizite noch vor dem Schuleintritt bewältigt werden können. (vgl. q1) Diese Tatsache nehme ich zum Anlass, dieses Thema näher zu betrachten und aufzuzeigen, was Forschungen ergeben haben. Ich möchte in dieser Hausarbeit außerdem aufzeigen, wie wichtig diese Kenntnisse für das spätere Arbeitsfeld einer Pädagogin sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprache
- Sematik-Lexikon
- Morphologie-Syntax
- Anforderungen und Ziele von Sprachstandserhebungsverfahren
- Diagnostische Methoden
- Beobachtungen
- Befragungen
- Elizitationsverfahren
- Beispiel: Delfin 4
- Durchführung und Auswertung
- Beurteilung/Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema „Sprachstandserhebungsverfahren“ und untersucht die Bedeutung der Sprache als Grundlage für Bildung sowie die Identifizierung und Bewältigung sprachlicher Defizite bei Kindern. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Aspekte der Sprache, insbesondere die sematisch-lexikalische und morphologische-syntaktische Ebene, und erläutert die Anforderungen und Ziele von Sprachstandserhebungsverfahren. Darüber hinaus werden verschiedene diagnostische Methoden vorgestellt und am Beispiel von Delfin 4 illustriert.
- Die Bedeutung der Sprache für Bildung und Entwicklung
- Die Erkennung und Bewältigung sprachlicher Defizite bei Kindern
- Die verschiedenen Ebenen der Sprache (Semantik-Lexikon, Morphologie-Syntax)
- Anforderungen und Ziele von Sprachstandserhebungsverfahren
- Diagnostische Methoden und deren Einsatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sprachstandserhebungsverfahren ein und beleuchtet die Bedeutung der Sprachförderung in der frühen Kindheit. Das Kapitel „Die Sprache“ erläutert die Komplexität der Sprache und geht detailliert auf die sematisch-lexikalische und die morphologische-syntaktische Ebene ein. Der Abschnitt „Anforderungen und Ziele von Sprachstandserhebungsverfahren“ beleuchtet die Bedeutung von Verfahren zur Erfassung des Sprachstandes von Kindern. Das Kapitel „Diagnostische Methoden“ stellt verschiedene Methoden zur Erhebung des Sprachstandes vor, darunter Beobachtungen, Befragungen und Elizitationsverfahren. Im Kapitel „Beispiel: Delfin 4“ wird ein konkretes Verfahren zur Sprachstandserhebung vorgestellt und dessen Durchführung und Auswertung erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Sprachstandserhebungsverfahren, Sprachförderung, Semantik, Lexikon, Morphologie, Syntax, Diagnostische Methoden, Elizitationsverfahren, Delfin 4, Sprachentwicklung, Kindergrammatik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Sprachstandserhebungsverfahren?
Ziel ist es, sprachliche Defizite bei Kindern frühzeitig (vor dem Schuleintritt) zu erkennen, um eine gezielte Förderung zu ermöglichen.
Was wird beim Verfahren "Delfin 4" genau gemacht?
Delfin 4 ist ein standardisiertes Verfahren, das den Sprachstand von Vierjährigen spielerisch überprüft, um Förderbedarf in Bereichen wie Wortschatz und Grammatik zu ermitteln.
Welche Ebenen der Sprache werden diagnostisch untersucht?
Wichtige Ebenen sind das Semantik-Lexikon (Wortbedeutung/Wortschatz) sowie die Morphologie-Syntax (Wortformung und Satzbau).
Was sind Elizitationsverfahren?
Das sind Methoden, bei denen das Kind gezielt dazu angeregt wird, bestimmte sprachliche Strukturen zu produzieren, um diese bewerten zu können.
Warum ist Sprachförderung in der frühen Kindheit so wichtig?
Weil Sprache der Schlüssel zu Bildung und sozialer Kompetenz ist und Defizite in dieser Phase noch effektiv vor dem Schuleintritt ausgeglichen werden können.
- Citar trabajo
- Melanie Schewtschenko (Autor), 2011, Sprachstandserhebungsverfahren: Anforderungen und Ziele, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178773