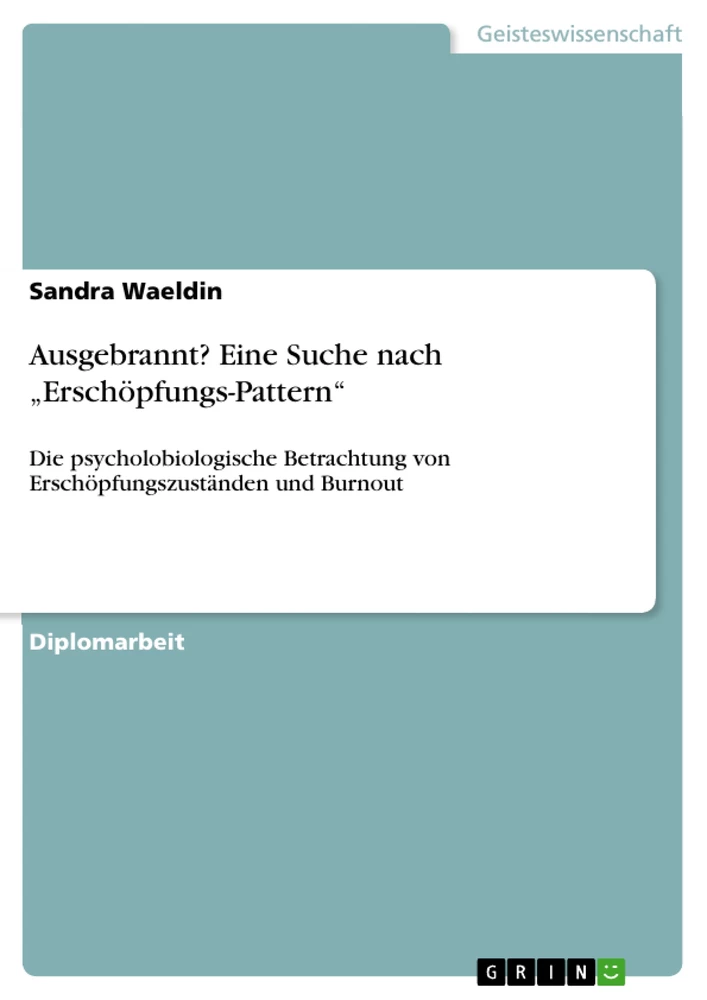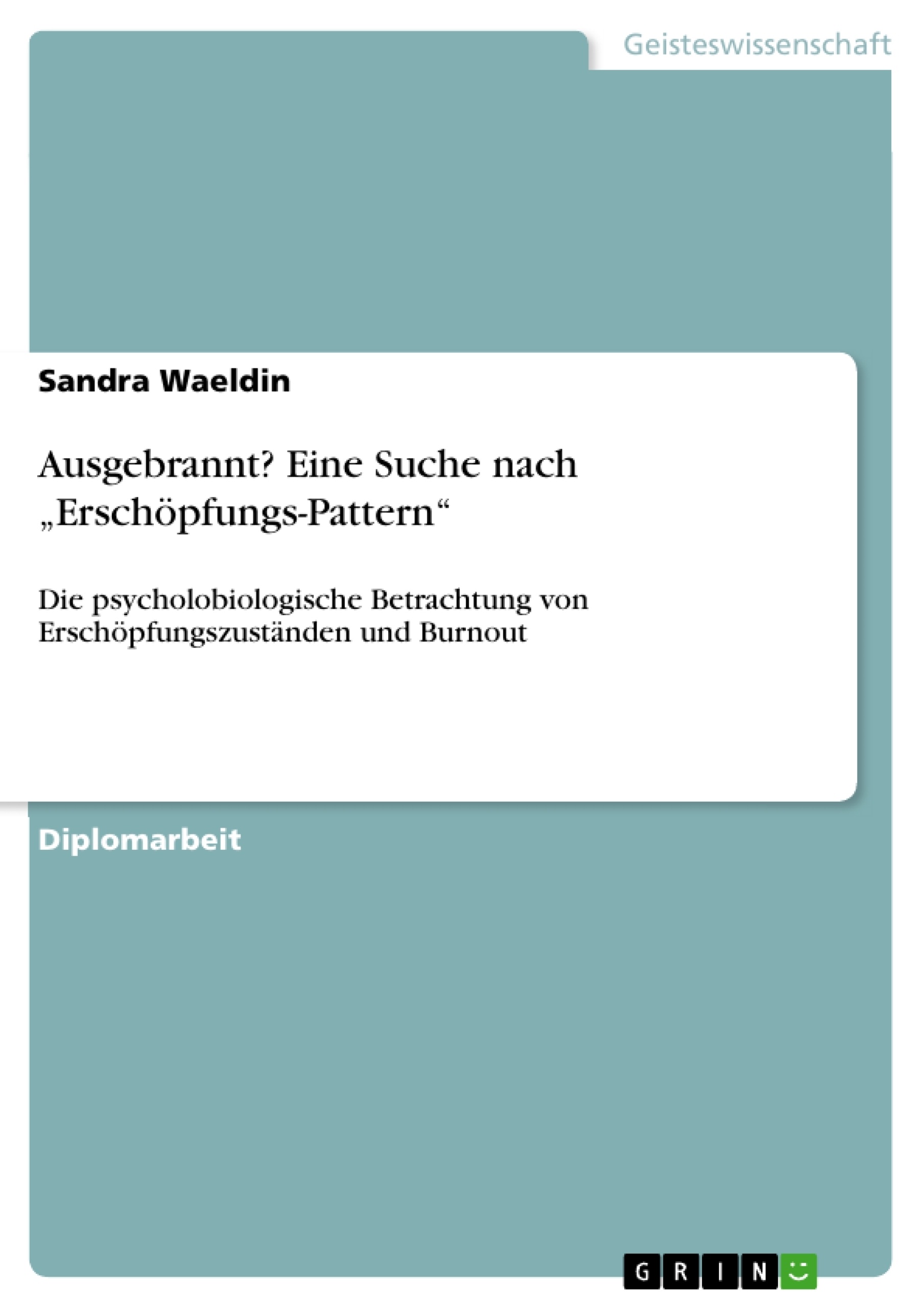THEMA: Burnout hat eine hohe Prävalenzrate und ist begleitet von vielfältigen Einbußen in der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Das öffentliche Interesse an diesem Phänomen ist hoch(...)
METHODE: Die vorliegende Arbeit hat das Ziel psychologische, biologische und somatische Merkmale erschöpfter Patienten zu erfassen. Hierzu wurden 343 psychisch oder psychosomatisch erkrankte stationäre und ambulante Patienten mit der Neuropattern™-Diagnostik untersucht (Altersdurchschnitt 45,5 Jahre, 65.3% weiblich). Über die Neuropattern-Questionnaires sowie dem Patient-Health-Questionnaire werden somatische und psychische Symptome, darunter das Erschöpfungsausmaß, erfasst. Die Patienten messen über eine Elektrokardiogramm-Aufzeichnung die Herzratenvariabilität und sammeln an zwei Tagen je sechs Speichelproben zur Cortisolbestimmung (0, 30, 45 und 60 Minuten nach dem Erwachen sowie um 15 und 20 Uhr). Vier weitere Speichelproben werden nach der Einnahme von 0,25 mg Dexamethason erhoben (ultra-low-dose Dexamethasonhemmtest).
ERGEBNISSE: Aus den Ergebnissen dieser Arbeit wird die Bedeutung von chronischem Stress am Arbeitsplatz für ein erhöhtes Erschöpfungsausmaß ersichtlich. In gleicher Weise spielen mangelnde soziale und emotionale Unterstützung, traumatische Ereignisse, familiäre Konflikte, Arbeitslosigkeit und eine niedrige Arbeitsposition eine Rolle. Erschöpfte Personen leiden vor allem an mentaler und körperlicher Müdigkeit sowie Niedergeschlagenheit. Zusätzlich ist ihre Symptomatik jedoch durch Anspannung, Angst, Nervosität, Reizbarkeit und einem ausgeprägtem Gefühl des Krankseins bestimmt. Somatisch imponieren Schmerzen, Magen-Darm-Probleme, kardiovaskuläre Beschwerden und eine Reihe von Symptomen, die erst nach Stressphasen auftreten. Trotz einer hohen Überschneidung scheint es über sympathisch und noradrenerg geprägte Symptome möglich, erschöpfte von depressiven Personen zu unterscheiden. Das Erschöpfungsausmaß scheint mit einer reduzierten autonomen Regulationsfähigkeit einher zu gehen. Zwar gibt es kaum Belege für eine generell erniedrigte Cortisolkonzentration bei Erschöpften, allerdings zeigt sich bei hoch erschöpften Patienten ein deutlich negativer Zusammenhang zwischen dem Erschöpfungsausmaß und der Cortisolkonzentration und -Aufwachreaktion (CAR, AUCg).
DISKUSSION: Die Ergebnisse sollten in weiteren Studien überpüft werden. Überdies sind eine einheitliche Konzeptualisierung von Burnout und eine Validierung seiner Messinstrumente erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Burnout
- 2.1.1. Begriffsentwicklung
- 2.1.2. Verlauf und Symptome
- 2.1.3. Definition und Diagnose
- 2.1.4. Differentialdiagnose
- 2.1.5. Häufigkeit und Relevanz
- 2.1.6. Ätiologie und Risikofaktoren
- 2.2. Neuropattern™
- 2.2.1. Was ist Neuropattern™?
- 2.2.2. Kovarianz- und Heterogenitätsproblem
- 2.2.3. HHNA-Biomarker
- 2.2.4. Sympatho-adrenerge Biomarker
- 2.3. Fragestellung
- 2.3.1. Hypothesen zur Messung von Erschöpfung
- 2.3.2. Hypothesen der Unterscheidbarkeit von erschöpften Subgruppen
- 2.3.3. Hypothesen über die Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung
- 2.3.4. Hypothesen über Symptome erschöpfter Personen
- 2.3.5. Hypothesen über biologische Marker von Erschöpfung
- 3. Methode
- 3.1. Studienablauf und -design, -setting
- 3.1.1. Studiensetting und -ziel
- 3.1.2. Ablauf
- 3.1.3. Stichprobenbeschreibung und Aus- und Einschlusskriterien
- 3.1.4. Zusätzliche Stichprobe
- 3.2. Untersuchungsmethoden
- 3.2.1. Bestimmung von Cortisol im Speichel
- 3.2.2. Dexamethasonhemmungstest
- 3.2.3. Herzratenvariabilitätsmessung
- 3.2.4. NPQ-A
- 3.2.5. NPQ-S
- 3.2.6. NPQ-P
- 3.2.7. PHQ-D
- 3.2.8. Weitere Datenerfassungen
- 3.3. Statistische Methoden
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Deskriptive Beschreibung
- 4.2. Datenanalyse
- 4.2.1. Ergebnisse zu den Erschöpfungsmaßen
- 4.2.2. Ergebnisse zu erschöpften Subgruppen
- 4.2.3. Ergebnisse zur Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung
- 4.2.4. Ergebnisse über Merkmale und Symptome erschöpfter Personen
- 4.2.5. Ergebnisse zu biologischen Merkmalen erschöpfter Personen
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht psychologische, biologische und somatische Merkmale von Erschöpfung bei psychisch oder psychosomatisch erkrankten Patienten. Ziel ist die Erfassung von Erschöpfungsmustern und deren Abgrenzung von Depression. Die Studie analysiert die Zusammenhänge zwischen Erschöpfung und verschiedenen Faktoren wie Stress, sozialer Unterstützung und biologischen Markern wie Cortisol.
- Erfassung von Erschöpfungsmustern bei psychisch und psychosomatisch erkrankten Patienten
- Untersuchung biologischer Korrelate von Erschöpfung (z.B. Cortisol)
- Differentialdiagnostische Abgrenzung von Erschöpfung und Depression
- Analyse von Risikofaktoren für Erschöpfung (Stress, soziale Unterstützung etc.)
- Entwicklung eines besseren Verständnisses der komplexen Zusammenhänge von Erschöpfung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Burnout und Erschöpfung ein und beschreibt die Relevanz der Forschung zu diesem weit verbreiteten Phänomen. Sie betont den Mangel an validen Messinstrumenten und die Herausforderungen bei der differenzialdiagnostischen Abgrenzung von Burnout und Depression. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtung psychologischer, biologischer und somatischer Aspekte von Erschöpfung.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beleuchtet den Begriff Burnout, seine Entwicklung, Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose im Vergleich zu Depression. Weiterhin wird das Neuropattern™-Modell detailliert erläutert, inklusive der verwendeten Biomarker. Die Kapitel skizziert die Fragestellung der Arbeit und formuliert Hypothesen zur Messung von Erschöpfung, der Unterscheidung erschöpfter Subgruppen, der Abgrenzung von Depression und Erschöpfung sowie zu Symptomen und biologischen Markern von Erschöpfung. Es stellt ein umfassendes theoretisches Gerüst für die empirische Untersuchung bereit.
3. Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, inklusive des Studiendesigns, des Ablaufs, der Stichprobenbeschreibung (343 Patienten), der Aus- und Einschlusskriterien und der angewandten Untersuchungsmethoden. Die Erhebung der Daten umfasste die Neuropattern™-Diagnostik (NPQ), den Patient Health Questionnaire (PHQ), elektrokardiographische Messungen der Herzratenvariabilität und die Bestimmung der Cortisolkonzentration im Speichel mittels eines ultra-low-dose Dexamethasonhemmungstests. Das Kapitel spezifiziert die statistischen Methoden, die zur Analyse der erhobenen Daten verwendet wurden.
4. Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es beginnt mit einer deskriptiven Beschreibung der Stichprobe und geht dann detailliert auf die Ergebnisse der Datenanalyse ein. Die Ergebnisse betreffen die Erschöpfungsmaße, die erschöpften Subgruppen, die Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung, die Merkmale und Symptome erschöpfter Personen sowie deren biologische Merkmale. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Abbildungen anschaulich dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Burnout, Erschöpfung, Depression, Neuropattern™, Cortisol, Herzratenvariabilität, Stress, soziale Unterstützung, Differentialdiagnose, psychobiologische Betrachtung, somatische Symptome.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Psychologische, biologische und somatische Merkmale von Erschöpfung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht psychologische, biologische und somatische Merkmale von Erschöpfung bei psychisch oder psychosomatisch erkrankten Patienten. Ein zentrales Ziel ist die Erfassung von Erschöpfungsmustern und deren Abgrenzung von Depression. Die Studie analysiert die Zusammenhänge zwischen Erschöpfung und verschiedenen Faktoren wie Stress, sozialer Unterstützung und biologischen Markern wie Cortisol.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erfassung von Erschöpfungsmustern, die Untersuchung biologischer Korrelate (wie Cortisol), die Differentialdiagnose von Erschöpfung und Depression, die Analyse von Risikofaktoren (Stress, soziale Unterstützung etc.) und die Entwicklung eines besseren Verständnisses der komplexen Zusammenhänge von Erschöpfung.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie umfasste ein quantitatives Design mit 343 Patienten. Es wurden verschiedene Untersuchungsmethoden eingesetzt, darunter die Neuropattern™-Diagnostik (NPQ), der Patient Health Questionnaire (PHQ), elektrokardiographische Messungen der Herzratenvariabilität und die Bestimmung der Cortisolkonzentration im Speichel mittels eines ultra-low-dose Dexamethasonhemmungstests. Die Datenanalyse erfolgte mittels statistischer Methoden, die im Detail im Methodenkapitel beschrieben werden.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Verständnis von Burnout und dessen Entwicklung, Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose im Vergleich zu Depression. Das Neuropattern™-Modell wird detailliert erläutert, inklusive der verwendeten Biomarker. Die Fragestellung wird durch Hypothesen zur Messung von Erschöpfung, zur Unterscheidung erschöpfter Subgruppen, zur Abgrenzung von Depression und Erschöpfung sowie zu Symptomen und biologischen Markern von Erschöpfung konkretisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Methode, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung führt in das Thema ein, die Theoretischen Grundlagen legen den theoretischen Rahmen fest, das Methodenkapitel beschreibt den Studiendesign und die angewandten Methoden, das Ergebniskapitel präsentiert die Datenanalyse und die Diskussion interpretiert die Ergebnisse und setzt sie in den Kontext der Literatur.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Ergebniskapitel präsentiert deskriptive Daten der Stichprobe und detaillierte Ergebnisse der Datenanalyse zu den Erschöpfungsmaßen, erschöpften Subgruppen, der Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung, den Merkmalen und Symptomen erschöpfter Personen sowie deren biologischen Merkmalen. Die Ergebnisse werden durch Tabellen und Abbildungen veranschaulicht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Burnout, Erschöpfung, Depression, Neuropattern™, Cortisol, Herzratenvariabilität, Stress, soziale Unterstützung, Differentialdiagnose, psychobiologische Betrachtung, somatische Symptome.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Kliniker und alle Interessierten, die sich mit Burnout, Erschöpfung und deren Abgrenzung von Depression beschäftigen. Die Ergebnisse können zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Erschöpfung beitragen.
- Citation du texte
- Sandra Waeldin (Auteur), 2011, Ausgebrannt? Eine Suche nach „Erschöpfungs-Pattern“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178784