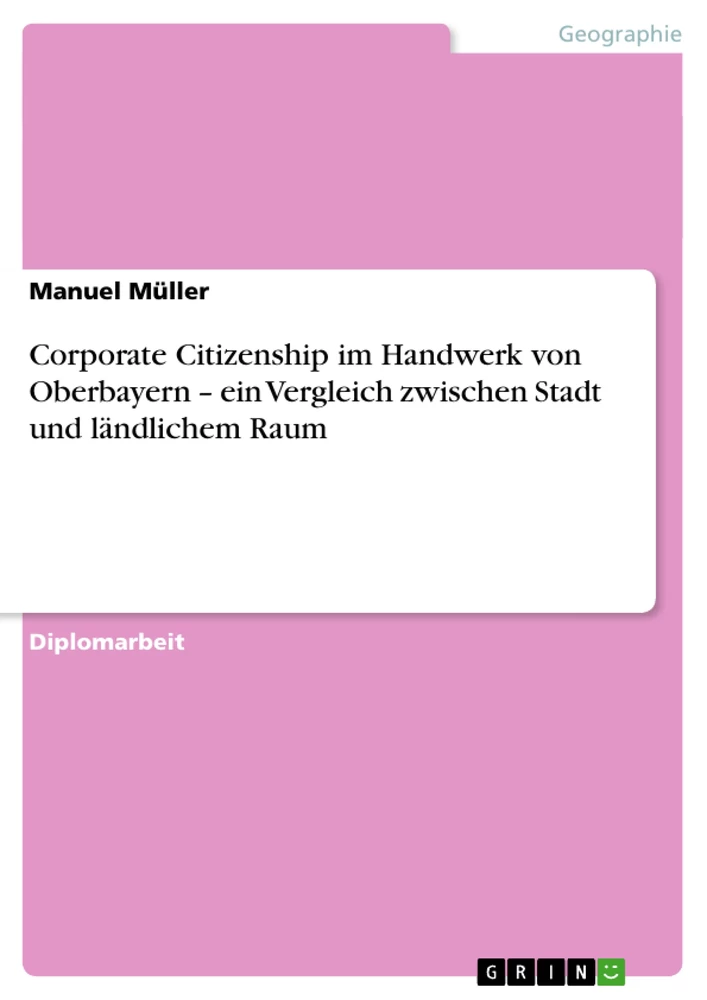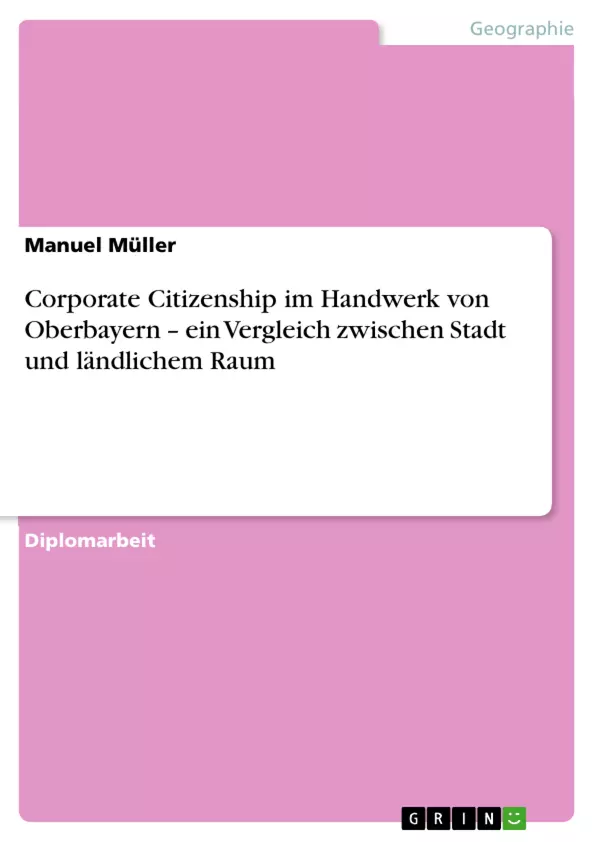Der Begriff des Corporate Citizenship – zählt zu den „schillernde[n] Phänomenen“ in der
wirtschaftsethischen Diskussion um die Stellung von Unternehmen in unserer heutigen
Gesellschaft. Im Fokus des deutschen Diskurses standen anfänglich Großunternehmen.
Zu der Gesamtheit aller auf dem deutschen Markt tätigen Firmen zählen in erster Linie
aber kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einem Anteil von 99,7 Prozent. Diese
sind es auch, die neuerdings ins Blickfeld der Europäischen Union (EU) geraten, und sich
zu ihrem Engagement durch Dokumentation bekennen sollen. Jenes Engagement findet
bisher eher im Stillen statt und wird aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus
praktiziert. Wie beispielsweise die Ergebnisse einer Studie des
Meinungsforschungsinstituts „Forsa“ verdeutlichen, ist jedoch die Bereitschaft von kleinen
Betrieben, für wohltätige Zwecke einzutreten, um ein Vielfaches höher als die von
Großkonzernen. Bei Betrieben mit einem Umsatz von 100.000 Euro im
Jahresdurchschnitt liegen die freiwillig gespendeten Beträge bei 3,1 Prozent ihres
Jahresumsatzes. Großkonzerne geben lediglich etwa 0,1 Prozent für wohltätige Zwecke
aus.
Im Jahr 2004 lagen noch keine anhand von Branche, Unternehmensgröße und Region
differenzierenden Analysen zu Corporate Citizenship-Aktivitäten in Deutschland vor.
Nach Kenntnis des Verfassers trifft der Mangel an umfangreichen Arbeiten über das
Corporate Citizenship nach wie vor auf Handwerksbetriebe zu. Da diese jedoch etwa ein
Viertel in der Größenkategorie der KMU ausmachen, stellen die Handwerksbetriebe einen
bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland dar. Über die Bedeutung des Handwerks
äußerte sich auch der ehemalige Bundeskanzler Ludwig Erhard. Seine besondere
Verbundenheit zum Handwerk sah er nicht nur darin begründet, dass diese „die Bürger
mit Wurst, Bier und Brötchen versorgen“, sondern ihn beeindruckten vielmehr deren
selbstverantwortliches Handeln und persönliches Engagement. Er sah im Handwerk ein
"soziologisch und politisch stabilisierende[s] Element". Dementsprechend soll die
vorliegende Arbeit durch ihre ausschließliche Konzentration auf das Corporate Citizenship
im Handwerk dazubeitragen, den Mangel an Informationen, der bisher über diese
Berufsgruppe vorherrscht, zu reduzieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Kartenverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einführung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Inhaltliche Vorgehensweise
- 2. Das Handwerk im gesamtwirtschaftlichen Kontext
- 2.1 KMU Definition und Merkmale
- 2.2 Abgrenzung von Handwerk und Industrie
- 2.3 Zustandsbeschreibung des Handwerks im gesamtwirtschaftlichen Kontext
- 2.4 Das Handwerk in der Stadt und ländlichem Raum
- 3. Corporate Citizenship
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Abgrenzung zu Corporate Social Responsibility
- 3.3 Konzepte des Corporate Citizenship
- 3.3_1 Corporate Giving
- 3.3_2 Das Konzept des Voluntarismus
- 3.4 Gründe für Corporate Citizenship
- 4. Theoretische Argumente für Corporate Citizenship
- 4.1 Raumbezogene Identität
- 4.1_1 Versuch einer Begriffsklärung
- 4.1_2 Funktionen raumbezogener Identität
- 4.1_3 Maßstabsfragen
- 4.2 Raum und Handeln
- 4.2_1 Von der raum- zur handlungsorientierten Perspektive
- 4.2_2 Handlungstheorien
- 5. Corporate Citizenship im Handwerk von Oberbayern — ein Vergleich zwischen Stadt und ländlichem Raum
- 5.1 Untersuchungsgebiet Oberbayern
- 5.1_1 Allgemeine Charakteristika des Regierungsbezirkes und der Handwerksorganisation in Oberbayern
- 5.1_2 Kennzahlen des Handwerks in Oberbayern
- 5.2 Empirische Befragung der Handwerksbetriebe in Oberbayern
- 5.2_1 Hinführung
- 5.2_2 Methodische Vorgehensweise der Erhebung
- 5.2_3 Aufbau des Fragebogens und des Gesprächsleitfadens
- 5.3 Empirische Ergebnisse
- 5.3_1 Charakteristika der antwortenden Unternehmen
- 5.3_2 Räumliche Verteilung der antwortenden Unternehmen
- 5.3_3 Maßnahmen und Bereiche des Corporate Citizenship
- 5.3_3_1 Häufigkeit und Art der Maßnahmen
- 5.3_3_2 Bereiche
- 5.3_4 Zeitliche Auslegung des ehrenamtlichen Engagements
- 5.3_5 Räumliche Verortung des Corporate Citizenship
- 5.3_6 Bekanntmachung des Corporate Citizenship
- 5.3_7 Gründe für Corporate Citizenship
- 5.3_8 Zukünftige Ausübung von Corporate Citizenship
- 6. Schluss — Bedeutung des Handwerks für die Gesellschaft
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem gesellschaftlichen Engagement von Handwerksbetrieben in Oberbayern, insbesondere mit dem Vergleich zwischen Stadt und ländlichem Raum. Ziel ist es, das Engagement von Handwerksbetrieben in Bezug auf Bereiche, Ausprägungen und Gründe zu untersuchen und die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Betrieben zu analysieren.
- Räumliche Dimension des Engagements von Handwerksbetrieben
- Vergleich des Engagements zwischen Stadt und ländlichem Raum
- Bedeutung der räumlichen Identität für das Engagement von Handwerksbetrieben
- Analyse der Handlungstheorien im Kontext des Engagements
- Empirische Untersuchung des Engagements von Handwerksbetrieben in Oberbayern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Corporate Citizenship im Handwerk ein und stellt die Fragestellung sowie die inhaltliche Vorgehensweise der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet das Handwerk im gesamtwirtschaftlichen Kontext, definiert KMU und grenzt das Handwerk von der Industrie ab. Es wird die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks für Deutschland und die Entwicklung des Handwerks von der Ansiedelung in Städten bis zur heutigen Zeit dargestellt. Im dritten Kapitel wird der Begriff Corporate Citizenship geklärt und von Corporate Social Responsibility abgegrenzt. Es werden die Konzepte des Corporate Giving und des Voluntarismus sowie die Gründe für Corporate Citizenship vorgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich den theoretischen Argumenten für Corporate Citizenship, insbesondere der raumbezogenen Identität und den Handlungstheorien. Das fünfte Kapitel untersucht das Corporate Citizenship im Handwerk von Oberbayern empirisch. Es werden allgemeine Charakteristika des Regierungsbezirks und der Handwerksorganisation in Oberbayern sowie die Ergebnisse einer Befragung von 193 Handwerksbetrieben vorgestellt. Das Kapitel analysiert die Engagementmaßnahmen, Bereiche, Häufigkeit, Gründe und die zukünftige Ausübung des Engagements. Es werden die Unterschiede zwischen Stadt und ländlichem Raum im Detail dargestellt. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Bedeutung des Handwerks für die Gesellschaft heraus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Corporate Citizenship, Handwerk, Oberbayern, Stadt, ländlicher Raum, räumliche Identität, Handlungstheorien, Engagement, Wirtschaft, Gesellschaft, Vergleich, Empirie, Befragung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Corporate Citizenship im Handwerk?
Es bezeichnet das bürgerschaftliche Engagement von Betrieben, die über ihre eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus soziale Verantwortung übernehmen, etwa durch Spenden oder ehrenamtliche Arbeit.
Gibt es Unterschiede beim Engagement zwischen Stadt und Land?
Die Arbeit untersucht, ob Handwerksbetriebe im ländlichen Raum aufgrund einer stärkeren raumbezogenen Identität und engerer sozialer Bindungen anders engagiert sind als städtische Betriebe.
Wie viel spenden kleine Handwerksbetriebe im Vergleich zu Großkonzernen?
Laut Studien spenden kleine Betriebe oft einen deutlich höheren Prozentsatz ihres Umsatzes (ca. 3,1 %) für wohltätige Zwecke als Großkonzerne (ca. 0,1 %).
Was motiviert Handwerker zu gesellschaftlichem Engagement?
Neben ethischen Überzeugungen spielen oft die Verwurzelung in der Region, die Stärkung des lokalen Netzwerks und ein Gefühl der Selbstverständlichkeit eine Rolle.
Welche Rolle spielt die „raumbezogene Identität“?
Die Identifikation mit dem eigenen Ort oder der Region (z.B. Oberbayern) ist ein starker Treiber für Betriebe, sich vor Ort für Vereine, Schulen oder soziale Projekte einzusetzen.
- Citar trabajo
- Manuel Müller (Autor), 2009, Corporate Citizenship im Handwerk von Oberbayern – ein Vergleich zwischen Stadt und ländlichem Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178813