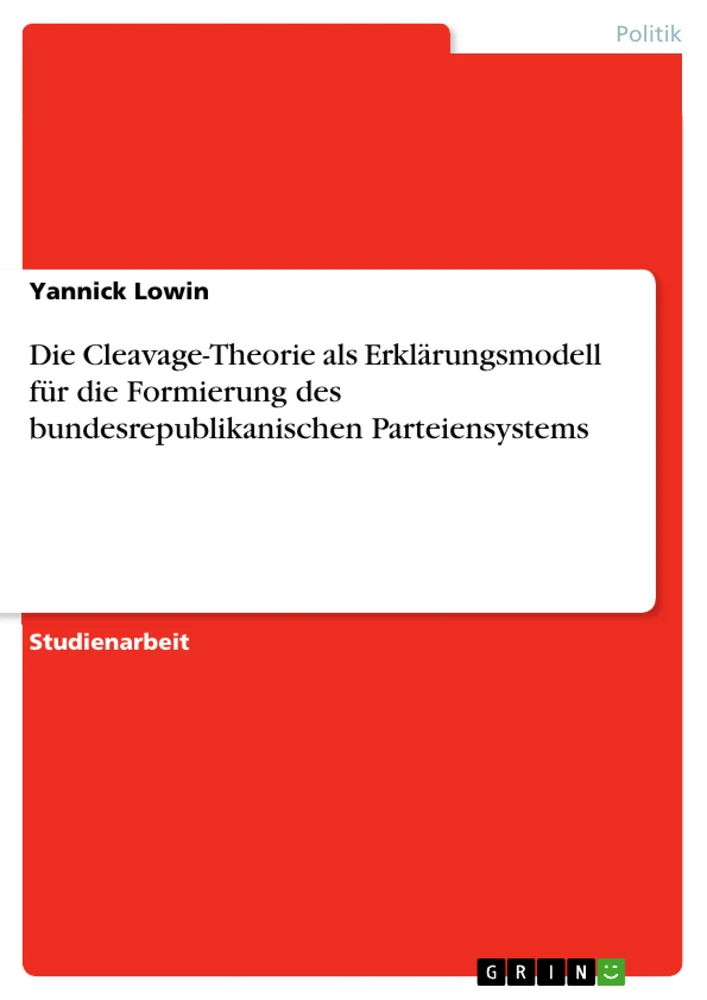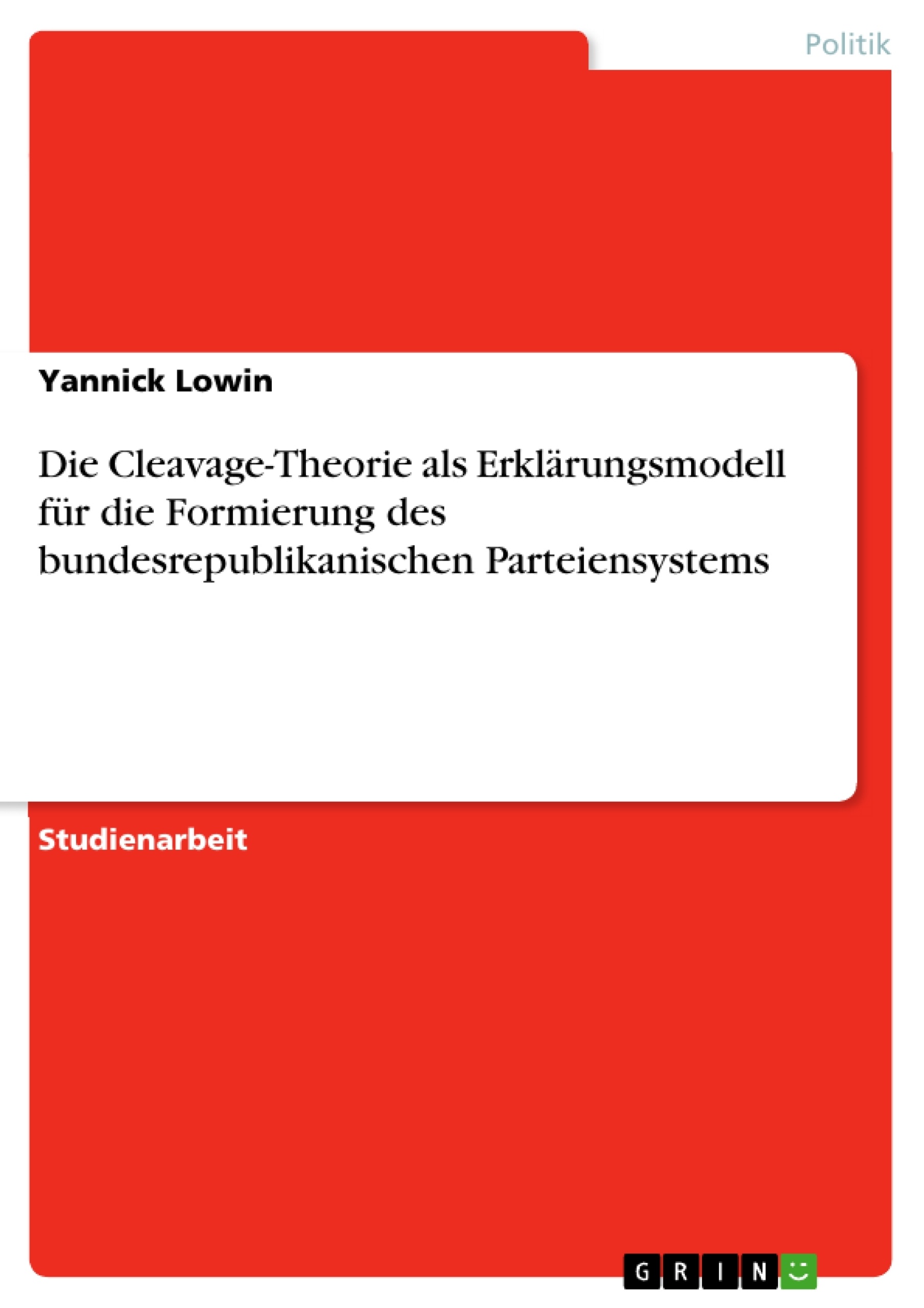Parteien existieren in Deutschland bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Von einer Erfolgsgeschichte der politischen Vertretungen kann man im deutschen Kontext allerdings nicht sprechen. So wurde ihnen im Kaiserreich nur eine marginale Bedeutung beigemessen. Nach dem Niedergang der Weimarer Republik machte man sie gar für das Scheitern des Demokratieversuchs verantwortlich. Und schließlich wurden sie während des Nazi-Regimes ganz verboten. Eine Renaissance erlebten die politischen Vertretungen erst in der Bundesrepublik. Nach einer von 1949 bis etwa 1961 andauernden Konsolidierungsphase, die im Zentrum meiner Arbeit stehen soll, haben sie sich jedoch, und damit das Parteiensystem in Deutschland an sich, als sehr stabil erwiesen.
Doch warum entstehen überhaupt Parteien und wie bildet sich ein stabiles Parteiensystem heraus? Um diese Fragen zu beantworten ist es sinnvoll, zu einer Theorie des Wahlverhaltens zu kommen. Denn im „Parteienstaat“ der Bundesrepublik werden die gewählten Repräsentanten im parlamentarischen System fast ausschließlich von Parteien entsendet.
In Punkt 2 werde ich daher die zentralen Wahltheorien vorstellen. Aus der Sicht von Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan waren diese Erklärungskonzepte jedoch zu einseitig, weshalb sie mit ihrer Cleavage-Theorie 1967 versuchten, sie zusammenzuführen. Ihre Annahmen werde ich in Punkt 3 zusammenfassend darstellen.
Anschließend gebe ich einen kurzen Abriss über die Entwicklung des bundesrepublikanischen Parteiensystems von 1949 bis 1961 (Punkt 4), um dann in einem fünften Schritt die Cleavage-Theorie auf diese Entwicklung anzuwenden und die beiden aus meiner Sicht für die junge Bundesrepublik Deutschland entscheidenden Cleavages zu benennen und ihren Einfluss auf die Formierung des Drei-Parteiensystems darzustellen. Dabei konzentriere ich mich in erster Linie auf die beiden, für die Anfangsphase der BRD entscheidenden Parteien, CDU und SPD.
Zentral für meine Ausführungen werden neben der Publikation von Lipset und Rokkan die Sekundärwerke zur Cleavage-Theorie von Wilhelm Bürklin und Markus Klein sowie Wolfgang Müller sein. Bei meinen Ausführungen zur Entwicklung des Parteiensystems stütze ich mich vor allem auf die Kompaktdarstellungen von Ulrich von Alemann und Eckhard Jesse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien des Wahlverhaltens
- Die Annahmen der Cleavage-Theorie
- Abriss der Entwicklung des Parteiensystems der BRD zwischen 1945 und 1961
- Die Konfliktlinien in der BRD
- Die Klassen-Konfliktlinie
- Die religiös-konfessionelle Konfliktlinie
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Formierung des bundesrepublikanischen Parteiensystems zwischen 1945 und 1961 anhand der Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan. Ziel ist es, die Entstehung und Stabilität des Parteiensystems zu erklären und den Einfluss gesellschaftlicher Konfliktlinien aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des Parteiensystems der BRD von 1945 bis 1961
- Die Cleavage-Theorie als Erklärungsmodell
- Die Rolle gesellschaftlicher Konfliktlinien (Klassen und Konfession)
- Theorien des Wahlverhaltens
- Das Drei-Parteiensystem und die Parteien CDU und SPD
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Entstehung und Stabilität des bundesrepublikanischen Parteiensystems ein. Sie hebt die besondere Bedeutung der Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg hervor und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen für die Herausbildung eines stabilen Parteiensystems. Die Arbeit kündigt die Anwendung der Cleavage-Theorie als Erklärungsmodell an und skizziert den methodischen Ansatz, der auf den Analysen von Lipset/Rokkan, Bürklin/Klein, Müller, von Alemann und Jesse beruht.
Theorien des Wahlverhaltens: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Theorien des Wahlverhaltens. Es werden das stratifikationstheoretische Modell, der institutionelle Ansatz und die Theorie des "rationalen Wählers" nach Anthony Downs vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die verschiedenen Ansätze werden in ihrem Bezug zur Erklärung von Stabilität und Wandel im Wahlverhalten diskutiert, um den Kontext für die anschließende Betrachtung der Cleavage-Theorie zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Darstellung des individuellen Entscheidungsprozesses und den Einflussfaktoren, die diesen bestimmen.
Die Annahmen der Cleavage-Theorie: Dieses Kapitel präsentiert die zentralen Annahmen der Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan. Der Schwerpunkt liegt auf dem Konzept der "Repräsentation" und der Rolle von Parteien als Träger gesellschaftlicher Interessen. Es wird erläutert, wie gesellschaftliche Konflikte durch Parteien polarisiert und im Parteiensystem abgebildet werden. Die Entstehung von "Repräsentationskoalitionen" zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien steht im Mittelpunkt. Der Text hebt die Bedeutung der Funktionsweise der repräsentativen Demokratie hervor und diskutiert die Rolle von Parteien im Gesetzgebungsprozess.
Abriss der Entwicklung des Parteiensystems der BRD zwischen 1945 und 1961: (Dieses Kapitel fehlt im bereitgestellten Text und muss aus dem eigentlichen Text entnommen oder rekonstruiert werden. Die Zusammenfassung müsste hier den historischen Verlauf des Parteiensystems der BRD im genannten Zeitraum darstellen, einschliesslich wichtiger Meilensteine und Entwicklungen.)
Die Konfliktlinien in der BRD: Dieses Kapitel (basierend auf dem kurzen Einblick im Ausgangstext) analysiert die zentralen Konfliktlinien im jungen bundesdeutschen Parteiensystem. Die Zusammenfassung muss die Klassen- und die religiös-konfessionelle Konfliktlinie detailliert beschreiben, ihre Ausprägung im Kontext der BRD analysieren und ihren Einfluss auf die Formierung des Parteiensystems beleuchten. Die Bedeutung der jeweiligen Konfliktlinien für die Positionierung und den Erfolg bestimmter Parteien, insbesondere der CDU und SPD, sollte hier im Detail herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Cleavage-Theorie, Parteiensystem, Bundesrepublik Deutschland, Wahlverhalten, Konfliktlinien, Klassenkonflikt, religiös-konfessionelle Konfliktlinie, CDU, SPD, Repräsentation, Lipset, Rokkan.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des bundesrepublikanischen Parteiensystems 1945-1961
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Stabilität des bundesrepublikanischen Parteiensystems zwischen 1945 und 1961. Sie analysiert die Rolle gesellschaftlicher Konfliktlinien und verwendet die Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan als Erklärungsmodell.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien des Wahlverhaltens, darunter das stratifikationstheoretische Modell, den institutionellen Ansatz und die Theorie des rationalen Wählers. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Was waren die Ursachen für die Herausbildung eines stabilen Parteiensystems in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1961?
Welche Rolle spielt die Cleavage-Theorie?
Die Cleavage-Theorie dient als Erklärungsmodell für die Entstehung und Stabilität des Parteiensystems. Sie untersucht, wie gesellschaftliche Konflikte (Cleavages) durch Parteien repräsentiert und im Parteiensystem abgebildet werden.
Welche gesellschaftlichen Konfliktlinien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Klassen- und die religiös-konfessionelle Konfliktlinie in der Bundesrepublik Deutschland und deren Einfluss auf die Formierung des Parteiensystems. Insbesondere wird der Einfluss auf die Positionierung und den Erfolg der CDU und SPD untersucht.
Welche Parteien werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die CDU und die SPD, da diese im untersuchten Zeitraum die dominierenden Parteien waren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Theorien des Wahlverhaltens, den Annahmen der Cleavage-Theorie, einem Abriss der Entwicklung des Parteiensystems der BRD zwischen 1945 und 1961, den Konfliktlinien in der BRD (Klassen- und Konfessionskonflikt) und einem Fazit/Ausblick.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Analysen von Lipset/Rokkan, Bürklin/Klein, Müller, von Alemann und Jesse. Die genaue Methodik wird im Text detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cleavage-Theorie, Parteiensystem, Bundesrepublik Deutschland, Wahlverhalten, Konfliktlinien, Klassenkonflikt, religiös-konfessionelle Konfliktlinie, CDU, SPD, Repräsentation, Lipset, Rokkan.
Wo finde ich den Abriss der Entwicklung des Parteiensystems der BRD zwischen 1945 und 1961?
Dieser Abschnitt fehlt im bereitgestellten Textfragment und muss aus dem vollständigen Text entnommen werden.
- Citar trabajo
- Yannick Lowin (Autor), 2010, Die Cleavage-Theorie als Erklärungsmodell für die Formierung des bundesrepublikanischen Parteiensystems, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178821