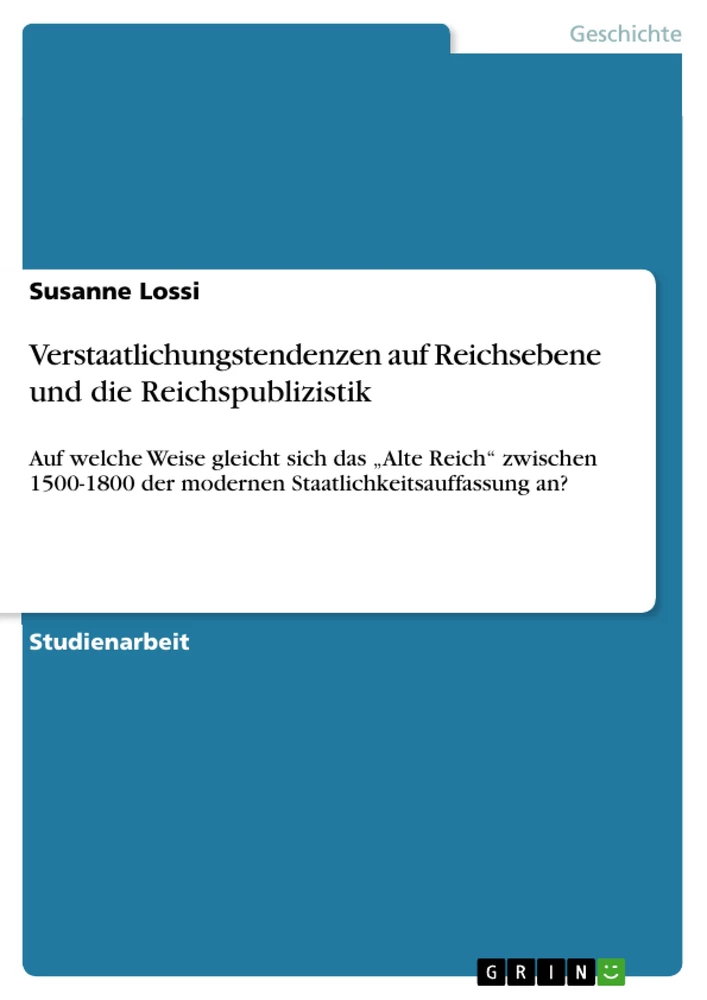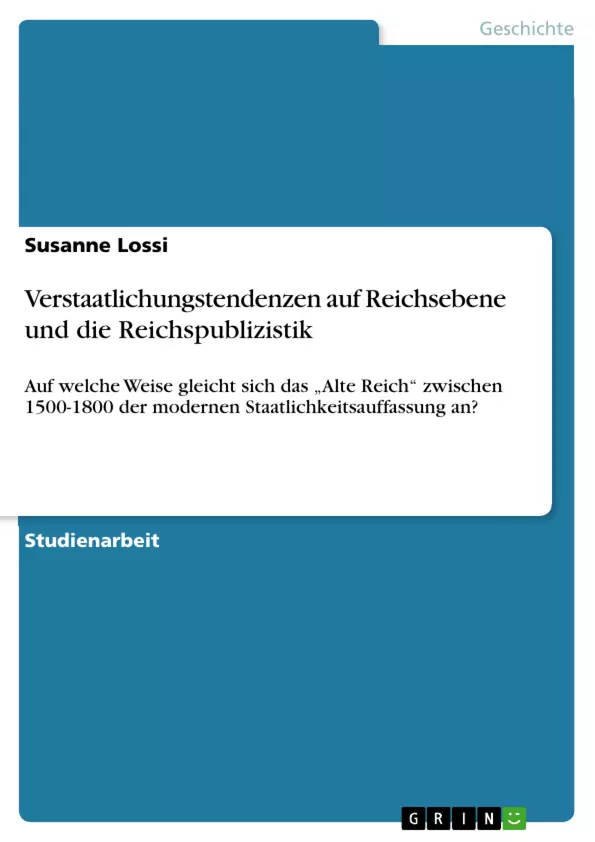„Es lebte im Reich nur mehr ein schwaches nationalpolitisches Gesamtbewußtsein und ein schwacher Lebenswille der Gesamtheit.“ 1
Die Problematik, inwiefern das deutsche Reich in den Jahren 1500-1800 ein System komplementärer Staatlichkeit versinnbildlichte und somit der modernen Staatlichkeitsauffassung gerecht wurde, steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen.
Die Begrifflichkeit des „Alten Reiches“ symbolisiert in diesem Zeitraum ein politisches Ordnungssystem im deutschsprachigen Raum der Frühen Neuzeit, welches auf der Grundlage von gemeinsamer Sprache, Kultur und Abstammung der deutschen Gemeinschaft jene Sicherheit gewährte, um eine nationale Einheit auszubilden und an dessen Spitze das Reichsoberhaupt, in Form von König oder Kaiser stand. Ein charakteristisches Merkmal des „Alten Reiches“ wird durch den Dualismus zwischen der Krone und den Reichsständen versinnbildlicht. Die Reichsstände vereinen sowohl die Fürsten, als auch die einzelnen Territorialherren, welche über die souveräne und unabhängige Hoheitsgewalt in ihrem Gebiet verfügen. Jedoch wird das Reichsoberhaupt, in Gestalt von König bzw. Kaiser als übergeordnete Zentralmacht anerkannt. Innerhalb dieses politischen Machtgefüges kommt es im 15. Jahrhundert zur Reichsreform, dessen Zielsetzung durch die Schaffung einer Verfassungsordnung im „Alten Reich“, welche den Ansprüchen und Bedürfnissen eines frühmodernen Staates entspricht, symbolisiert wird. Auf diese Weise sollten die essentiellen Souveränitätsrechte im gesamten Reichsstaat, entweder unter ständischer oder kaiserlicher Führung vereint werden. Die Reichsreform sollte somit dem stetigen machtpolitischen Antagonismus zwischen König und Ständen entgegenwirken. Die Thematik, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen wird, ist die Fragestellung auf welche Art und Weise sich der Reichsstaat zwischen 1500-1800 einer modernen Staatlichkeitsauffassung angleicht. Im Folgenden werden die Verstaatlichungstendenzen auf der Reichsebene, anhand der Entstehung der Reichspublizistik, der Herausbildung des Steuerwesens, am Beispiel des Gemeinen Pfennigs und der Entwicklung einer gemeinsamen Rechtssprechung, am Beispiel des Reichskammergerichtes, dargelegt. Insbesondere werden die Ansichten und Auffassungen des Historikers Georg Schmidt, im Hinblick auf die Entwicklung des „Alten Reiches“ hin zu einem System komplementärer Staatlichkeit, kritisch erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Das „Alte Reich" — Vom Kaiser geführt, von den Reichsständen bestimmt
- Das „Alte Reich"
- Das „Alte Reich"
- Das „Alte Reich"
- Die Entwicklung deutscher Gesamtstaatlichkeit
- Die Reichspublizistik und die Entwicklung der Staatsrechtslehre im „Alten Reich"
- Die Entwicklungsgeschichte der Reichspublizistik
- Die Reichspublizistik —Ein Garant für die Entwicklung komplementärer Staatlichkeit?
- Der Gemeine Pfennig — Eine allgemeine Reichssteuer im „Alten Reich"
- Der Gemeine Pfennig und sein Einfluss auf die staatlichen Entwicklungstendenzen
- Das Reichskammergericht — Verstaatlichungstendenz oder Sinnbild der alten Ordnung?
- Die Entwicklungsgeschichte und die Funktionen des Reichskammergerichtes
- Das Reichskammergericht — Rechtssprechung im Spannungsfeld zwischen Krone und Reichsständen
- Die Entwicklungsgeschichte des „Alten Reiches" — Die Grundlage einer modernen Staatlichkeit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung der Staatlichkeit im „Alten Reich" zwischen 1500 und 1800, mit dem Fokus auf die Frage, inwiefern sich das Reich der modernen Staatlichkeitsauffassung annäherte. Die Arbeit analysiert die Verstaatlichungstendenzen auf Reichsebene, insbesondere die Entwicklung der Reichspublizistik, die Herausbildung des Steuerwesens am Beispiel des Gemeinen Pfennigs und die Entwicklung einer gemeinsamen Rechtssprechung am Beispiel des Reichskammergerichtes.
- Entwicklung eines Systems komplementärer Staatlichkeit im „Alten Reich"
- Die Rolle der Reichspublizistik in der Entwicklung der Staatsrechtslehre
- Der Einfluss des Gemeinen Pfennigs auf die staatlichen Entwicklungstendenzen
- Das Reichskammergericht als Instrument der Verstaatlichung oder Bewahrer der alten Ordnung
- Die Angleichung des Reichsstaates an die moderne Staatlichkeitsauffassung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die politische Situation im „Alten Reich" zu Beginn des 15. Jahrhunderts, geprägt durch den Dualismus zwischen Kaiser und Reichsständen. Die Reichsreform von 1495, die den Versuch einer Konzentration der Hoheitsgewalt und Souveränitätsrechte auf eine Machtposition im Reich symbolisiert, wird als Ausgangspunkt für die Betrachtung der Verstaatlichungstendenzen im „Alten Reich" dargestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung eines Systems komplementärer Staatlichkeit im „Alten Reich", basierend auf den Ansichten des Historikers Georg Schmidt. Es wird untersucht, inwieweit die Entwicklung der Reichspublizistik, die Herausbildung des Gemeinen Pfennigs und die Entwicklung des Reichskammergerichtes die These von der komplementären Staatlichkeit im „Alten Reich" stützen oder widerlegen.
Das dritte Kapitel analysiert die Reichspublizistik und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Staatsrechtslehre im „Alten Reich". Es wird die Entstehung und Entwicklung des Faches „Ius Publicum" betrachtet und die Frage diskutiert, inwiefern die Reichspublizistik als Garant für die Entwicklung komplementärer Staatlichkeit im Reich fungierte.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Einführung und der Entwicklungsgeschichte des Gemeinen Pfennigs, einer allgemeinen Reichssteuer. Es wird der Einfluss des Gemeinen Pfennigs auf die staatlichen Entwicklungstendenzen im „Alten Reich" analysiert und die Frage erörtert, ob der Gemeine Pfennig zu einer Entwicklung komplementärer Staatlichkeit beigetragen hat.
Das fünfte Kapitel untersucht das Reichskammergericht als ein zentrales Element der Rechtssprechung im „Alten Reich". Es werden die Entwicklungsgeschichte und die Funktionen des Reichskammergerichtes beleuchtet, sowie die Frage erörtert, inwiefern das Reichskammergericht eine Verstaatlichungstendenz im „Alten Reich" darstellte oder ein Sinnbild der alten Ordnung blieb.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das „Alte Reich", die Reichsreform, die komplementäre Staatlichkeit, die Reichspublizistik, die Staatsrechtslehre, der Gemeine Pfennig, das Reichskammergericht und die Verstaatlichungstendenzen im deutschen Reich zwischen 1500 und 1800. Die Arbeit analysiert die Entwicklung eines Systems komplementärer Staatlichkeit im „Alten Reich" und untersucht, inwiefern sich das Reich der modernen Staatlichkeitsauffassung annäherte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem 'Alten Reich'?
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation (1500-1800) war ein politisches System, geprägt durch den Dualismus zwischen Kaiser und den souveränen Reichsständen.
Was ist 'komplementäre Staatlichkeit'?
Ein vom Historiker Georg Schmidt geprägter Begriff, der beschreibt, wie Reichsebene und Territorien gemeinsam staatliche Funktionen erfüllten.
Welche Rolle spielte das Reichskammergericht?
Es war ein zentrales Justizorgan, das zur Verrechtlichung von Konflikten beitrug und eine wichtige Verstaatlichungstendenz auf Reichsebene darstellte.
Was war der 'Gemeine Pfennig'?
Der Gemeine Pfennig war der Versuch einer allgemeinen Reichssteuer (1495), um dem Reich eine eigenständige finanzielle Basis zu geben.
Was ist die Reichspublizistik?
Die Reichspublizistik war die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Staatsrecht des Reiches, die zur Entwicklung einer modernen Staatlichkeitsauffassung beitrug.
- Quote paper
- Susanne Lossi (Author), 2008, Verstaatlichungstendenzen auf Reichsebene und die Reichspublizistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178850