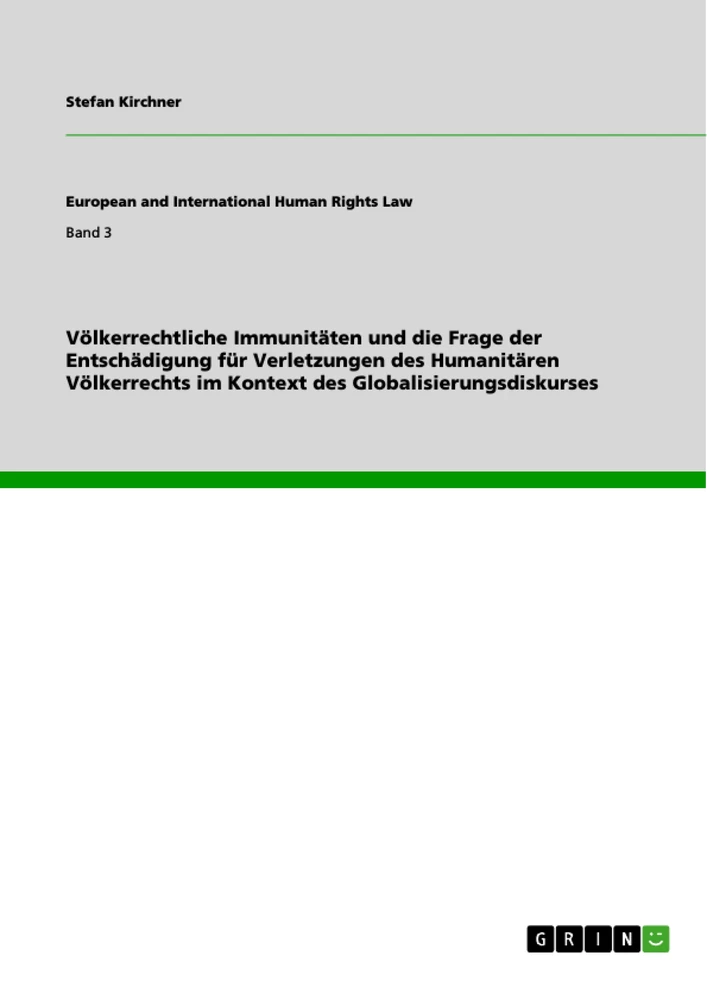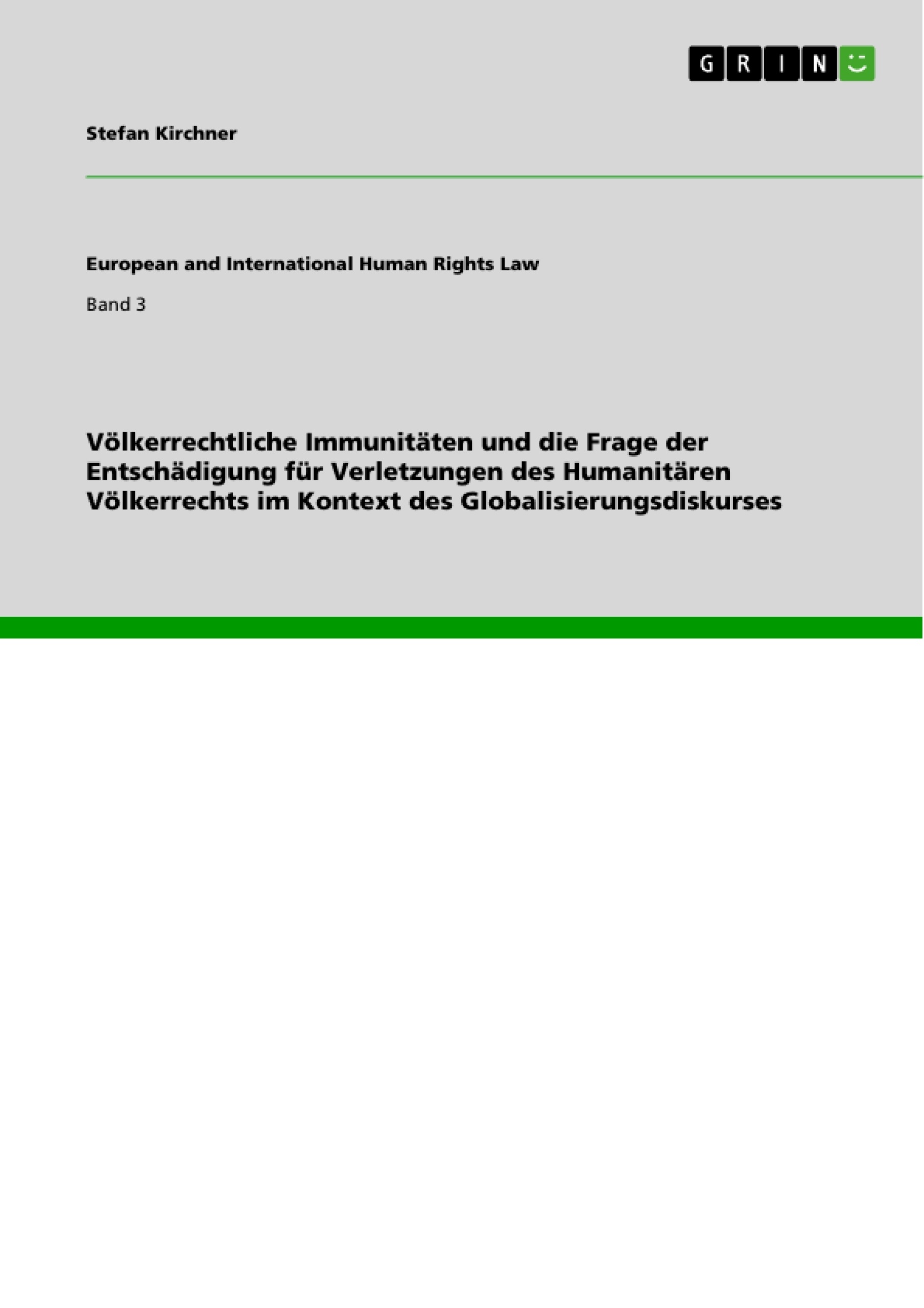Insbesondere in Postkonfliktsituationen ist die Frage nach einem möglichst gerechten Ausgleich zwischen Tätern und Opfern von Kriegsverbrechen wesentlicher Bestandteil des Fundaments einer zukünftigen Friedensordnung. Dieser Ausgleich darf sich nicht nur in zwischenstaatlichen Ausgleichsleistungen erschöpfen sondern muss den einzelnen Men-schen, also auch die einzelnen Opfer von Kriegsverbrechen und gegebenenfalls auch deren Nachkommen, berücksichti-gen. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben das humanitäre Völkerrecht und das Völkerstrafrecht, hervorgerufen durch den Schock des Jugoslawienkrieges, zu einem Zeitpunkt an dem der große Ost-West-Konflikt beigelegt war, und der damit verbundenen Grausamkeiten, erneute Aufmerksamkeit erfahren.
Der Schutz von Zivilpersonen ist eine der Hauptanliegen des modernen humanitären Völkerrechts. Dieses ius in bello ist in seiner Anwendbarkeit unabhängig vom ius ad bellum , wel-ches die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Gewaltanwen-dung in zwischenstaatlichen Beziehungen im allgemeinen re-gelt, also das „Ob“ militärischer Gewaltanwendung, während das ius in bello das „Wie“ der Gewaltanwendung limitiert.
Die wesentliche Frage, die sich uns stellt ist aber nicht nur die Frage nach dem Schutz durch das Recht sondern nach der Entschädigung für die Fälle, in denen der rechtlich geforderte Schutz nicht gegeben war. Aufgrund der mit der Globalisierung einhergehenden Fragmentierung des Völkerrechts erscheint es durchaus möglich, dass spezielle haftungsrechtliche Regelungssysteme entstanden sind, welche sich bereits vom Korpus der allgemeinen völkerrechtlichen Haftungsregeln herausgelöst haben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entschädigung für Verletzungen des humanitären Völkerrechts unter Globalisierungsbedingungen. Hierzu wird insbesondere auf die Behandlung des Distomo-Massakers durch deutsche und griechische Gerichts sowie durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingegangen.
Der Verfasser ist Rechtsanwalt und insbesondere im Bereich des Rechts der Europäischen Menschenrechtskonvention tätig (www.humanrightslawyer.eu).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Distomo-Fall
- Auswirkungen der Globalisierung auf den völkerrechtlichen Entschädigungsdiskurs
- Schlussfolgerungen
- Literaturverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Entschädigung für Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Kontext des Globalisierungsdiskurses. Sie untersucht die völkerrechtlichen Immunitäten und die Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von Kriegsverbrechen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Völkerrechts im Kontext der Globalisierung und die Herausforderungen, die sich aus der gestiegenen Bedeutung nicht-staatlicher Akteure ergeben.
- Völkerrechtliche Immunitäten und ihre Einschränkungen
- Entschädigungsansprüche im humanitären Völkerrecht
- Die Rolle der Globalisierung im Völkerrecht
- Die Herausforderungen der Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen
- Die Bedeutung der Rechtssicherheit im Völkerrecht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Entschädigung für Opfer von Kriegsverbrechen und die Entwicklung des humanitären Völkerrechts seit dem Ende des Kalten Krieges. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar und skizziert die verschiedenen Aspekte, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
- Der Distomo-Fall: Dieses Kapitel analysiert den Distomo-Fall, in dem Angehörige und Nachkommen der Opfer eines Massakers an der Zivilbevölkerung des griechischen Ortes Distomo die Bundesrepublik Deutschland auf Schadensersatz verklagten. Der BGH, der sich mit der Angelegenheit befasste, musste sich mit den völkerrechtlichen Grundsätzen der Staatenimmunität und des intertemporalen Völkerrechts auseinandersetzen. Die Entscheidung des BGH verdeutlicht die schwierige Situation, in der sich Opfer von Kriegsverbrechen befinden, wenn es um die Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen geht.
- Auswirkungen der Globalisierung auf den völkerrechtlichen Entschädigungsdiskurs: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf den völkerrechtlichen Entschädigungsdiskurs. Es wird dargelegt, dass die Globalisierung einerseits den Druck auf Staaten erhöht, Entschädigungen zu leisten, andererseits aber auch zu einer Aufweichung der Grundsätze des intertemporalen Völkerrechts führen kann. Der Fall Ferrini gegen die Bundesrepublik Deutschland, der vor italienischen Gerichten verhandelt wurde, wird als Beispiel für eine mögliche Durchbrechung des intertemporalen Völkerrechts im Kontext von Kriegsverbrechen herangezogen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das humanitäre Völkerrecht, Entschädigungsansprüche, Kriegsverbrechen, Völkerrechtliche Immunitäten, Staatenimmunität, Globalisierung, intertemporales Völkerrecht, Zivilgesellschaft, nicht-staatliche Akteure, Rechtssicherheit und Friedensordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Distomo-Fall?
Der Distomo-Fall betrifft Klagen von Opfern eines deutschen Kriegsverbrechens in Griechenland (1944) auf Entschädigung, wobei die Frage der Staatenimmunität eine zentrale Rolle spielte.
Was bedeutet Staatenimmunität im Völkerrecht?
Staatenimmunität besagt, dass ein Staat nicht vor den Gerichten eines anderen Staates verklagt werden kann. Die Arbeit untersucht, ob dies auch bei schweren Menschenrechtsverletzungen gilt.
Wie beeinflusst die Globalisierung das Völkerrecht?
Die Globalisierung führt zu einer Fragmentierung des Rechts und erhöht den Druck, individuelle Entschädigungsansprüche gegenüber rein zwischenstaatlichen Leistungen zu stärken.
Was ist der Unterschied zwischen ius ad bellum und ius in bello?
Ius ad bellum regelt die Rechtmäßigkeit der Gewaltanwendung an sich, während das ius in bello (humanitäres Völkerrecht) festlegt, wie Gewalt im Krieg limitiert werden muss (z. B. Schutz von Zivilisten).
Gibt es Hoffnung auf Entschädigung für Opfer von Kriegsverbrechen?
Die Arbeit analysiert neuere Tendenzen in der Rechtsprechung, die versuchen, die starren Regeln der Immunität bei schweren Verbrechen zu durchbrechen.
- Quote paper
- Rechtsanwalt Stefan Kirchner (Author), 2011, Völkerrechtliche Immunitäten und die Frage der Entschädigung für Verletzungen des Humanitären Völkerrechts im Kontext des Globalisierungsdiskurses , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178900