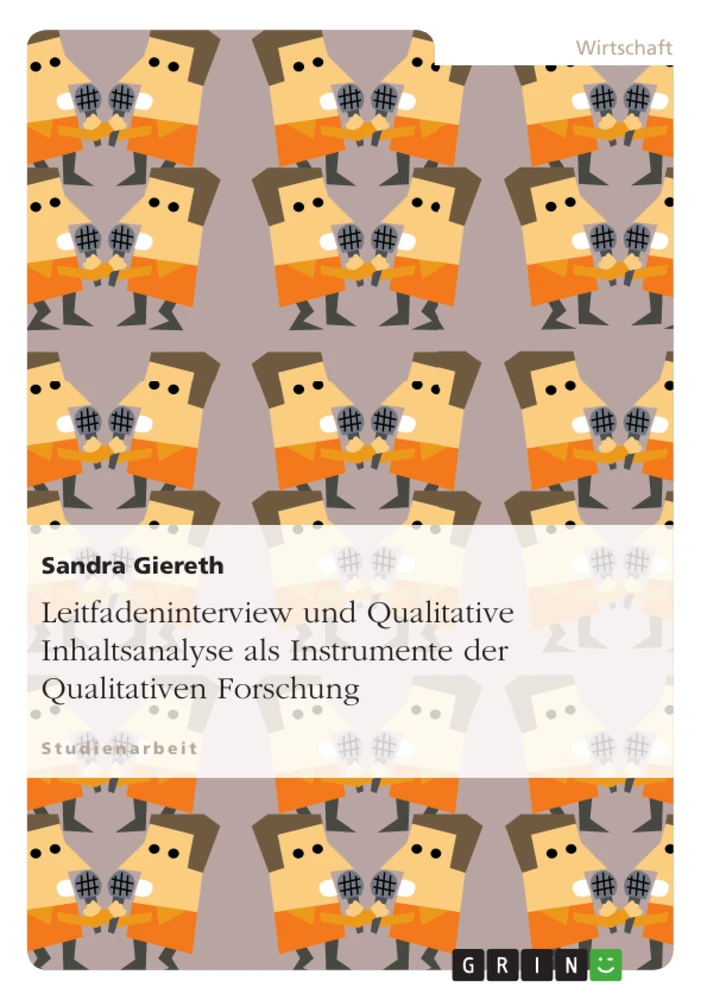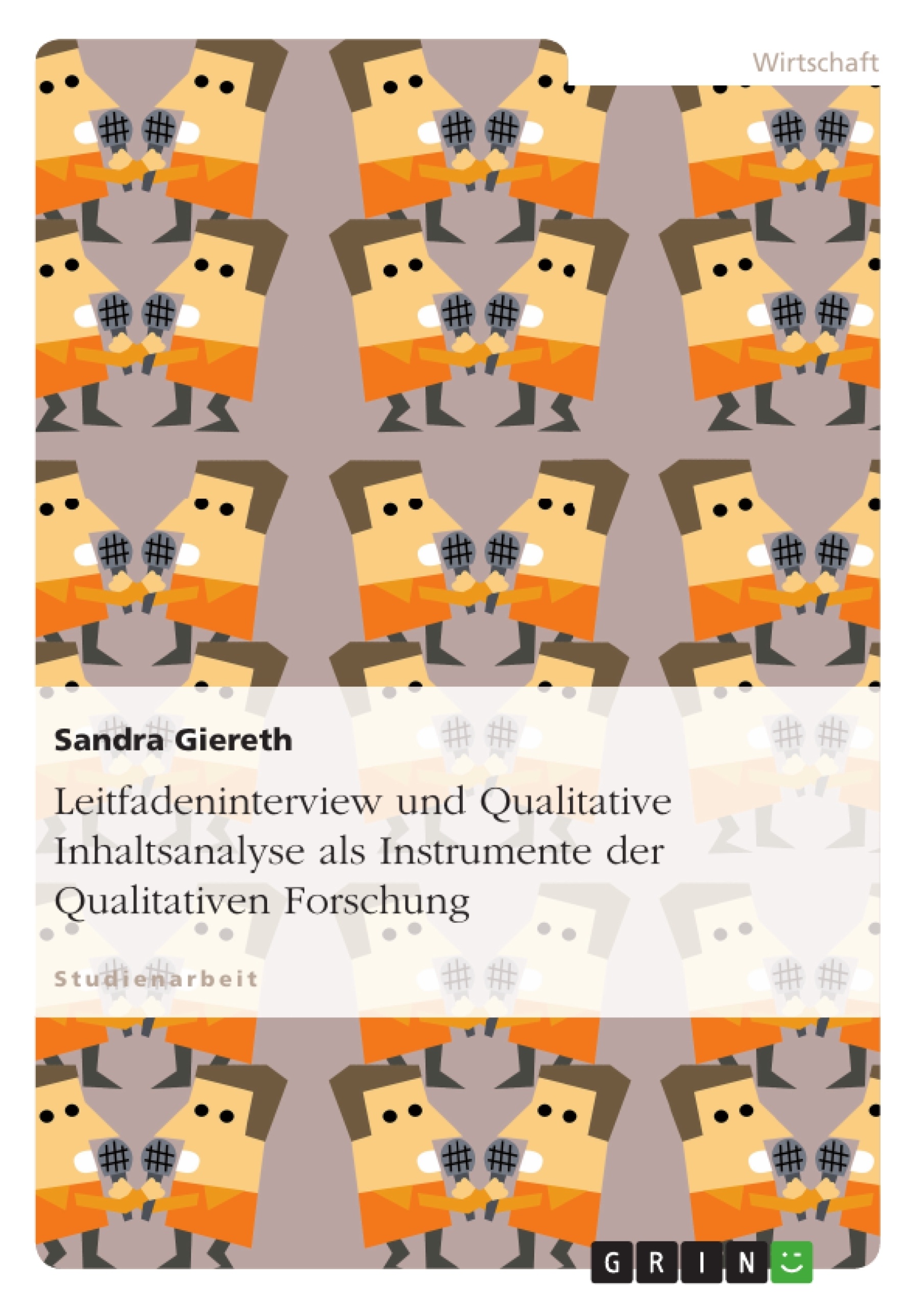Die qualitativen Forschungsmethoden gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Anwendung finden sie insbesondere in der Kommunikationswissenschaft, mittlerweile jedoch auch in der Psychologie, Erziehungswissenschaft oder Soziologie. Aufgrund der gestiegenen Resonanz beschäftigt sich die vorliegende Arbeit näher mit dem Thema der Qualitativen Forschung. Der Fokus hierbei liegt vor allem auf dem Bereich der Leitfadeninterviews und der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.
Dafür wird wie folgt vorgegangen: Unter Punkt 2 wird die Qualitative Forschung im Überblick dargestellt und von der Quantitativen Forschung abgegrenzt. Anschließend wird der qualitative Ansatz gezielter betrachtet und die Bedeutung der Qualitativen Forschung für die Organisationsentwicklung herausgearbeitet. Punkt 3 der Arbeit beschäftigt sich aufbauend mit dem Thema des Leitfadeninterviews als Instrument der qualitativen Datenerhebung. Hierfür wird der Begriff des Interviews zunächst erläutert und Leitfadeninterviews als Sonderform mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Neben der Vorstellung typischer Charakteristika erfolgen Hinweise zur Erstellung und Durchführung.
Zur Auswertung der erhobenen Daten wird im Abschnitt 4 die Herangehensweise nach Mayring dargelegt. Dafür wird der Begriff der Qualitativen Inhaltsanalyse definiert sowie seine Eigenschaften und Zielsetzungen erarbeitet. Weiterhin werden typische Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Der Punkt 5 verweist - bezugnehmend auf die vorgestellte Qualitative Inhaltsanalyse – nochmals explizit auf die Gütekriterien. Zu diesem Zweck werden zuerst die Bedeutung der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfasst und anschließend ergänzend spezielle inhaltsanalytische Gütekriterien aufgezeigt. Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung sowie eine kritische Würdigung der Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema und Aufbau der Arbeit
- Die Qualitative Forschung im Überblick
- Quantitative versus Qualitative Forschung
- Bedeutung der Qualitativen Forschung in der Organisationsentwicklung
- Das Leitfadeninterview als Mittel der qualitativen Datenerhebung
- Interviews im Überblick
- Das Leitfadeninterview im Überblick
- Erstellung und Durchführung von Leitfadeninterviews
- Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- Die Qualitative Inhaltsanalyse: Begriff und Zielsetzungen
- Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse
- Spezielle Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse
- Gütekriterien der Qualitativen Forschung
- Klassische Gütekriterien
- Inhaltsanalytische Gütekriterien
- Zusammenfassung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der qualitativen Forschung, insbesondere mit Leitfadeninterviews und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Ziel ist es, diese Methoden im Kontext der Organisationsentwicklung näher zu beleuchten und ihre Bedeutung für die Erhebung und Analyse von Daten zu verdeutlichen.
- Abgrenzung der quantitativen und qualitativen Forschung
- Relevanz der qualitativen Forschung für die Organisationsentwicklung
- Leitfadeninterviews als Instrument der qualitativen Datenerhebung
- Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als Methode zur Datenauswertung
- Gütekriterien der qualitativen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und einem Überblick über die qualitative Forschung. Anschließend wird die quantitative von der qualitativen Forschung abgegrenzt und die Bedeutung der qualitativen Forschung für die Organisationsentwicklung herausgearbeitet. In Kapitel 3 wird das Leitfadeninterview als Mittel der qualitativen Datenerhebung vorgestellt, wobei der Begriff des Interviews erläutert und Leitfadeninterviews als Sonderform mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt werden. Neben der Vorstellung typischer Charakteristika erfolgen Hinweise zur Erstellung und Durchführung. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Herangehensweise nach Mayring bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Der Begriff der qualitativen Inhaltsanalyse wird definiert sowie Eigenschaften und Zielsetzungen erarbeitet. Weiterhin werden typische Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Kapitel 5 verweist - in Bezug auf die vorgestellte qualitative Inhaltsanalyse – nochmals explizit auf die Gütekriterien. Dazu werden zuerst die Bedeutung der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfasst und anschließend ergänzend spezielle inhaltsanalytische Gütekriterien aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Qualitative Inhaltsanalyse, Organisationsentwicklung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Sandra Giereth (Autor:in), 2011, Leitfadeninterview und Qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente der Qualitativen Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178985