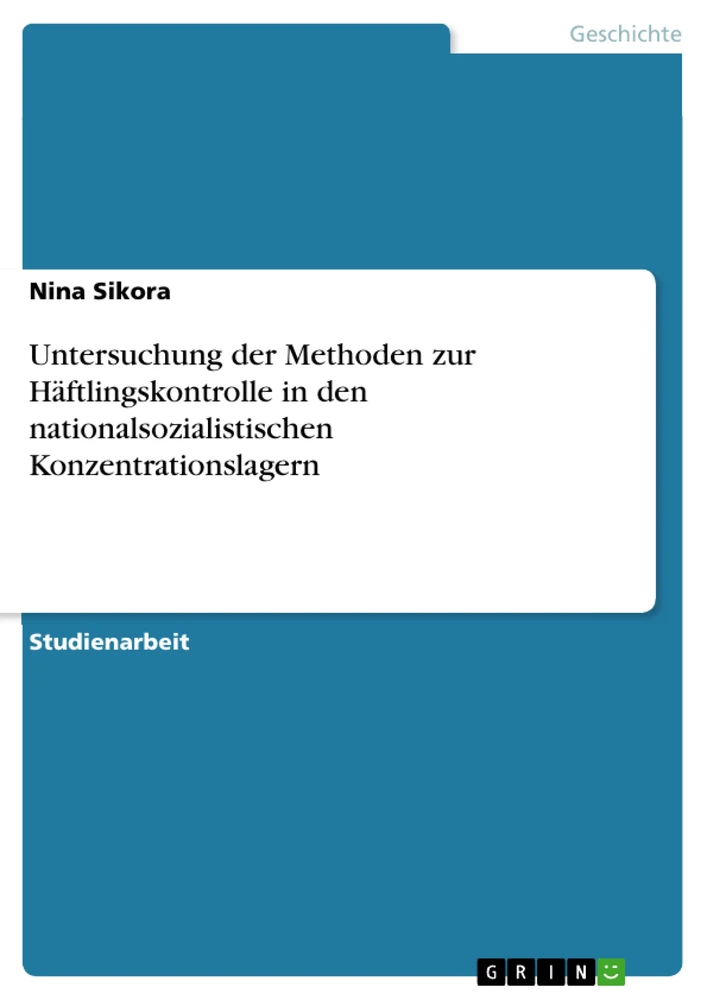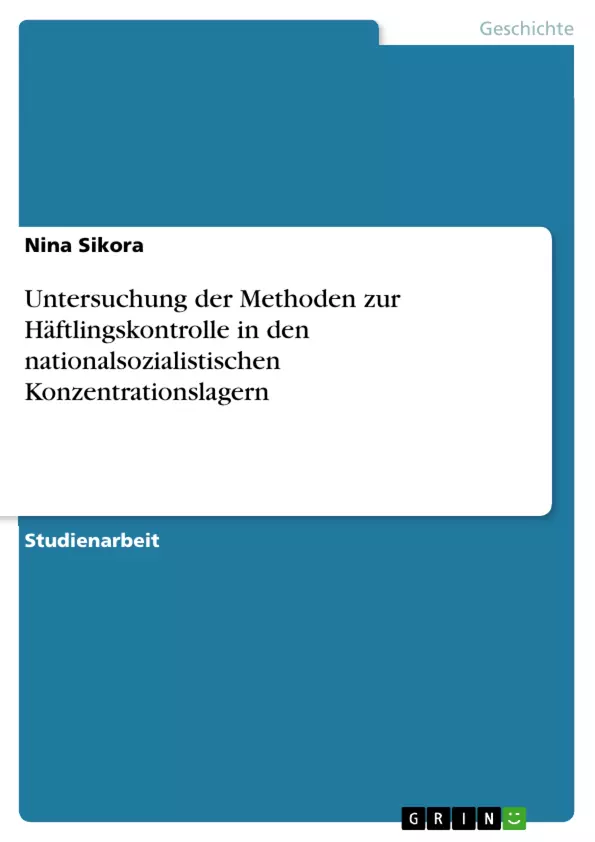Man nimmt an, dass etwa 6 Millionen Menschen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern ihr Leben verloren. Die Zahl der Inhaftierten dürfte also noch um einiges höher sein, als die hier genannten Zahlen der Todesopfer. Besonders in den letzten Jahren der NS-Herrschaft wurden die Kapazitäten der Konzentrationslager voll ausgenutzt und häufig noch überschritten. Dies führte dazu, dass statistisch gesehen nur 1 SS-Wachmann 40 Gefangene beaufsichtigte.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Herrschaftssystem der Konzentrationslager. Es soll geklärt werden, wie es möglich war mit vergleichsweise wenig Wachpersonal so viele Menschen unter Kontrolle zu halten und Aufstände weitgehend zu verhindern.
Inhalt:
1. Einleitung
2. Das System der Konzentrationslager
2.1 Theodor Eike und das Dachauer Modell
2.2 Die Disziplinar- und Strafordnung
3. Leben im Konzentrationslager
3.1 Alltag und Lebensbedingungen
3.2 Häftlingshierarchie
4. Schluss
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das System der Konzentrationslager
- Theodor Eike und das Dachauer Modell
- Die Disziplinar- und Strafordnung
- Leben im Konzentrationslager
- Alltag und Lebensbedingungen
- Häftlingshierarchie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Herrschaftssystem der nationalsozialistischen Konzentrationslager und erforscht die Methoden der Häftlingskontrolle, die es ermöglichten, eine große Anzahl von Menschen mit relativ geringem Wachpersonal unter Kontrolle zu halten und Aufstände zu verhindern.
- Entwicklung des Konzentrationslagersystems von den frühen, unorganisierten Lagern zu einem einheitlichen System unter SS-Kontrolle
- Die Rolle des Dachauer Modells und der Bedeutung von Theodor Eike für die Ausgestaltung des Lagerregimes
- Das Leben im Konzentrationslager, inklusive Alltagsbedingungen, Disziplinarordnung und Häftlingshierarchie
- Die Strategien der Kontrolle und Unterdrückung von Häftlingen innerhalb des Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der nationalsozialistischen Konzentrationslager ein, beleuchtet die Entwicklung des Systems und die Problematik der genauen Häftlingszahlen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Systems der Konzentrationslager in den letzten Jahren der NS-Herrschaft, als das System ausgereift war und ein systematisierter Terror herrschte. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Konzentrationslagersystems von den frühen „wilden“ Lagern bis hin zur Etablierung eines einheitlichen Systems unter Kontrolle der SS. Das Kapitel konzentriert sich auf Theodor Eike und seine Rolle bei der Entwicklung des Dachauer Modells, das als Vorbild für alle weiteren Konzentrationslager diente.
Schlüsselwörter
Konzentrationslager, nationalsozialistisches System, Häftlingskontrolle, Theodor Eike, Dachauer Modell, Disziplinarordnung, Lebensbedingungen, Häftlingshierarchie, Unterdrückung, SS-Wachpersonal, Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Wie konnten so viele Häftlinge mit so wenig Wachpersonal kontrolliert werden?
Dies wurde durch ein ausgeklügeltes Herrschaftssystem erreicht, das auf systematischer Einschüchterung, einer strengen Disziplinarordnung und der Instrumentalisierung einer Häftlingshierarchie basierte.
Was war das "Dachauer Modell"?
Das von Theodor Eike entwickelte Dachauer Modell diente als Blaupause für alle späteren Konzentrationslager. Es vereinheitlichte die Organisation, die Bewachung durch die SS und den systematischen Terror.
Welche Rolle spielte die Häftlingshierarchie im Lageralltag?
Die SS setzte sogenannte Funktionshäftlinge (wie Kapos) ein, um die Kontrolle innerhalb der Baracken und Arbeitskommandos auszuüben. Dies spaltete die Häftlingsgemeinschaft und verhinderte Solidarität.
Wer war Theodor Eike?
Theodor Eike war ein maßgeblicher SS-Funktionär, der das Konzentrationslagersystem organisierte und die Disziplinar- und Strafordnung einführte, die den Terror institutionalisierte.
Wie sah die Disziplinar- und Strafordnung in den Lagern aus?
Sie sah drakonische Strafen für kleinste Vergehen vor, die oft willkürlich angewendet wurden, um die Häftlinge in einem Zustand permanenter Angst und Unterwerfung zu halten.
Wie viele Häftlinge kamen statistisch auf einen SS-Wachmann?
In den letzten Jahren der NS-Herrschaft war das System so weit optimiert, dass statistisch gesehen oft nur ein SS-Wachmann für die Beaufsichtigung von etwa 40 Gefangenen zuständig war.
- Quote paper
- Nina Sikora (Author), 2008, Untersuchung der Methoden zur Häftlingskontrolle in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178993