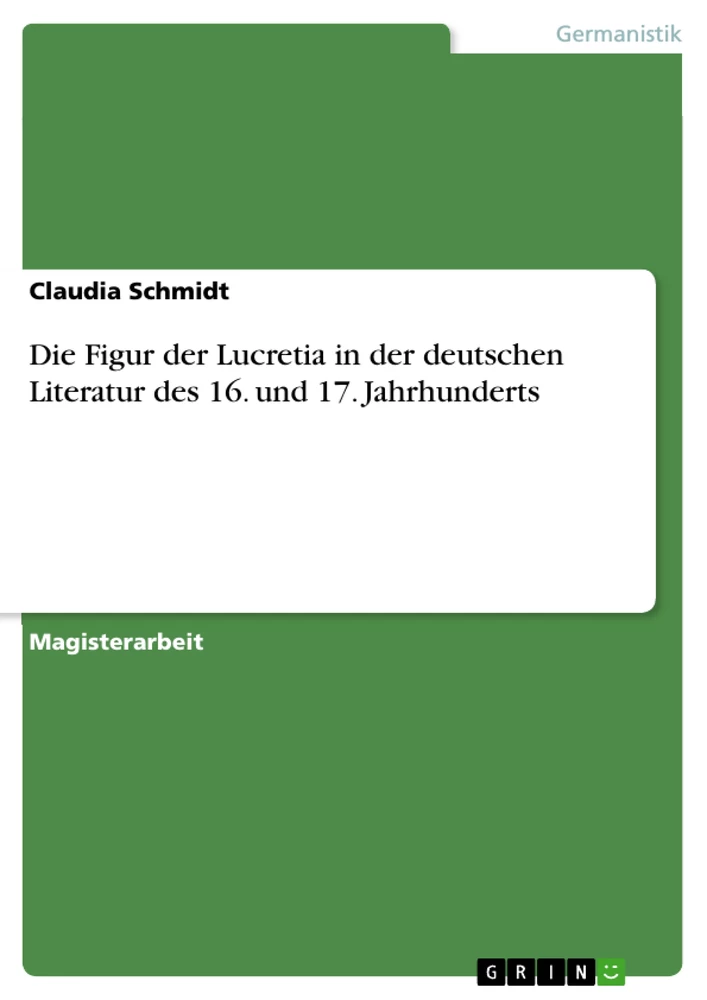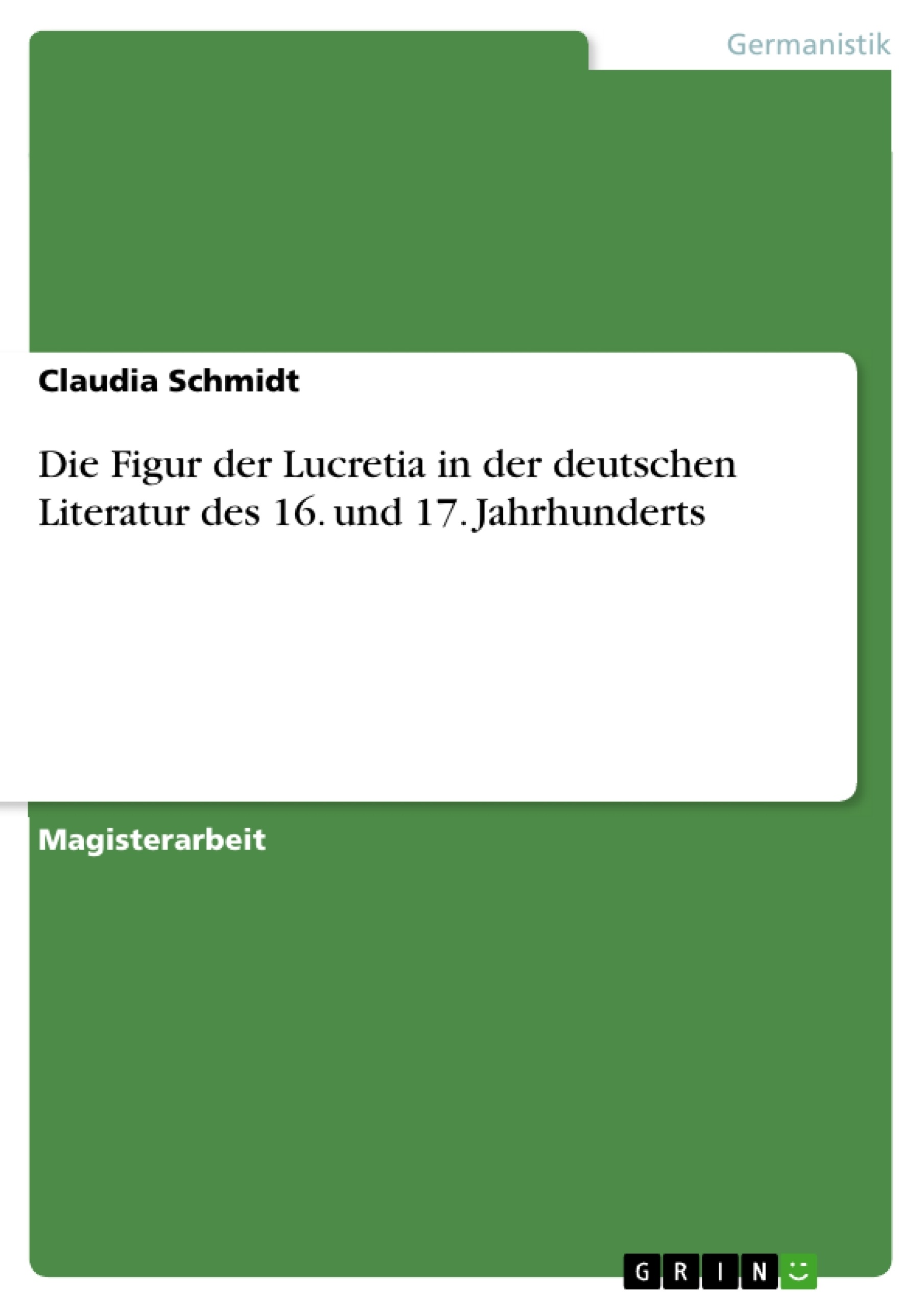Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Rezeption des Lucretia-Stoffes in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
Im ersten Teil wird hierzu auf die antiken Quellen sowie die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Überlieferungen eingegangen.
Der Hauptteil der Arbeit setzt sich u.a. mit den Fragen auseinander, welche Quellen die Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts nutzten und welcher Art von Interpretation sie folgten oder inwiefern sie den Stoff neu deuteten.
Bemerkenswert ist vor allem die signifikante Verstärkung der Beschäftigung mit Lucretia in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Zu nennen sind hier insbesondere die Lucretia-Tragödien von Hans Sachs und Heinrich Bullinger, deren literarische Gestaltung ausführlich analysiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Forschungsstand und Vorgehensweise
- 2. Lucretia in der Antike
- 2.1. Früheste Quellen und die Frage nach der Historizität der Lucretia-Geschichte
- 2.2. Livius
- 2.3. Ovid
- 2.4. Dionysios von Halikarnass
- 2.5. Weitere antike Quellen
- 2.6. Interpretationsansätze
- 2.6.1. Die Bewertung von Vergewaltigungen innerhalb der römischen Gesellschaft
- 2.6.2. Vergewaltigung als Bestandteil der römischen Frühgeschichte
- 2.6.3. Lucretia als exemplum weiblicher Tugend
- 2.6.4. Brutus als Begründer der römischen Republik
- 2.6.5. Collatinus als „dummer Junge“
- 3. Lucretia in Spätantike und Mittelalter
- 3.1. Christliche Umdeutungen: Augustinus und die Gesta Romanorum
- 3.2. Kaiserchronik
- 3.3. Lucretia und die Humanisten
- 4. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 16. Jahrhundert
- 4.1. Bernhard Schöfferlins „Römische Historie“ (1505)
- 4.2. Ludwig Binder „Diß Lied sagt Von Lucretia“ (zwischen 1520 und 1530)
- 4.3. Der Lucretia-Stoff im Werk des Hans Sachs
- 4.3.1. Die „Tragedia. Von der Lucretia“ (1.1.1527)
- 4.3.2. „Die keusch Römerin Lucrecia erstach sich selber, ir er zw retten“ (22.10.1548)
- 4.3.3. Spruchgedicht: Die Klagerede Lucretias (ohne Datierung)
- 4.4. Lucretia, Tell und die Revolution: Schweizer Besonderheiten
- 4.4.1. Das Urner Tellenspiel (1512)
- 4.4.2. Heinrich Bullingers Lucretia-Tragödie (1533)
- 4.5. Jakob Ayrer: „Tragedi. Vierter Theil; von Servii Tulii Regiment vnd Sterben, darinnen der Schönen Lucretia Hystori begriffen“ (1598)
- 4.6. Die neulateinischen Lucretia-Tragödien: Friedrich Balduin (1597), Samuel Junius (1599) und Joachim Jungius (1602)
- 4.6.1. Friedrich Balduin: Lucretia (1597)
- 4.6.2. Samuel Junius: Lucretia (1599)
- 4.6.3. Joachim Jungius: Lucretia (1602)
- 4.7. Zusammenfassung des 4. Kapitels
- 5. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 17. Jahrhundert
- 5.1. Wolfgang (Marianus) Rot: Lucretia. Ein kurtze Tragoedi (wahrscheinlich zwischen 1625 und 1637)
- 5.2. Johann Peter Titz: Lucretia (zwischen 1642 und 1647)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Rezeption der Lucretia-Figur in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Entwicklung der Interpretationen und die Bedeutung des Stoffes im Kontext der jeweiligen Epoche aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung der Lucretia-Figur von der Antike bis zur Frühen Neuzeit
- Die unterschiedlichen Interpretationen der Lucretia-Geschichte in der Literatur
- Die Rolle von Lucretia als Exempel weiblicher Tugend und Opfer politischer Intrigen
- Der Einfluss der Lucretia-Geschichte auf die Entwicklung moralischer und politischer Ideale
- Die Verwendung des Lucretia-Stoffes durch junge Literaten als Übungsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
1. Forschungsstand und Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt den bisherigen Forschungsstand zur Rezeption der Lucretia-Figur und skizziert die Methodik der Arbeit. Es wird auf den Rückgang der Bekanntheit der Geschichte in den letzten hundert Jahren eingegangen und die Bedeutung des Stoffes in der Antike, im Mittelalter und der Neuzeit hervorgehoben. Die Mehrdimensionalität des Stoffes, der moralische, politische und erotische Aspekte vereint, wird betont. Der Fokus der Arbeit auf die Literatur der Frühen Neuzeit in Deutschland wird begründet.
2. Lucretia in der Antike: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen antiken Quellen zur Lucretia-Geschichte, beginnend mit den frühesten Überlieferungen und der Frage nach ihrer Historizität. Es behandelt die Darstellungen bei Livius, Ovid und Dionysios von Halikarnass sowie weitere antike Quellen und verschiedene Interpretationsansätze, die die Vergewaltigung im Kontext der römischen Gesellschaft, ihre Rolle in der Frühgeschichte und Lucretia als Exempel weiblicher Tugend beleuchten.
3. Lucretia in Spätantike und Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die christliche Umdeutung der Lucretia-Geschichte durch Augustinus und die Gesta Romanorum, ihre Erwähnung in der Kaiserchronik sowie die Rezeption durch Humanisten. Es beleuchtet die Weiterentwicklung der Interpretationen und die Anpassung des Stoffes an die jeweiligen religiösen und kulturellen Kontexte.
4. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 16. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die vielfältige Rezeption des Lucretia-Stoffes in der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts. Es analysiert verschiedene Werke, darunter Schöfferlins „Römische Historie“, Binders „Diß Lied sagt Von Lucretia“, die Lucretia-Bearbeitungen von Hans Sachs und die Schweizer Besonderheiten mit Bezug auf das Urner Tellenspiel und Bullingers Tragödie. Es schließt mit einer Zusammenfassung der im Kapitel behandelten Werke und deren jeweiliger Interpretation des Stoffes.
5. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel widmet sich den Bearbeitungen des Lucretia-Stoffes im 17. Jahrhundert und analysiert die Werke von Wolfgang (Marianus) Rot und Johann Peter Titz. Es untersucht die spezifischen Interpretationen und die Veränderungen der Darstellung im Vergleich zum 16. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Lucretia, Vergewaltigung, Römische Republik, Exemplum, Tugend, Deutsche Literatur, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Antike, Mittelalter, Rezeption, Interpretationsansätze, Hans Sachs, Heinrich Bullinger, Neulateinische Literatur.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Rezeption der Lucretia-Figur in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit untersucht die Rezeption der Lucretia-Figur in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie analysiert die Entwicklung der Interpretationen und die Bedeutung des Lucretia-Stoffes im Kontext der jeweiligen Epochen.
Welche Aspekte der Lucretia-Geschichte werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung der Lucretia-Figur von der Antike bis zur Frühen Neuzeit, die unterschiedlichen Interpretationen der Lucretia-Geschichte in der Literatur, Lucretias Rolle als Exempel weiblicher Tugend und Opfer politischer Intrigen, den Einfluss der Lucretia-Geschichte auf die Entwicklung moralischer und politischer Ideale sowie die Verwendung des Lucretia-Stoffes durch junge Literaten als Übungsfeld.
Welche Quellen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert antike Quellen wie Livius, Ovid und Dionysios von Halikarnass, sowie spätere Bearbeitungen in der Spätantike, dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Im Fokus stehen deutsche literarische Werke des 16. und 17. Jahrhunderts, darunter Schöfferlins „Römische Historie“, Binders „Diß Lied sagt Von Lucretia“, Werke von Hans Sachs, das Urner Tellenspiel, Bullingers Lucretia-Tragödie, Ayrer's "Tragedi", neulateinische Tragödien von Balduin, Junius und Jungius, sowie Werke von Wolfgang (Marianus) Rot und Johann Peter Titz. Die Arbeit beleuchtet auch christliche Umdeutungen (Augustinus, Gesta Romanorum) und die Rezeption durch Humanisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Forschungsstand und Vorgehensweise; 2. Lucretia in der Antike; 3. Lucretia in Spätantike und Mittelalter; 4. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 16. Jahrhundert; und 5. Lucretia in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: das 17. Jahrhundert. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Epoche und der dort relevanten literarischen Bearbeitungen des Lucretia-Stoffes.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Interpretationen der Lucretia-Geschichte und die Bedeutung des Stoffes im Kontext der jeweiligen Epoche aufzuzeigen. Es geht darum, die Mehrdimensionalität des Stoffes, der moralische, politische und erotische Aspekte vereint, herauszustellen und den Einfluss dieser Interpretationen auf die Entwicklung moralischer und politischer Ideale zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lucretia, Vergewaltigung, Römische Republik, Exemplum, Tugend, Deutsche Literatur, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Antike, Mittelalter, Rezeption, Interpretationsansätze, Hans Sachs, Heinrich Bullinger, Neulateinische Literatur.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die Rezeption der Lucretia-Geschichte im Laufe der Zeit unterschiedlichen Interpretationen unterlag und dabei stets den jeweiligen moralischen, politischen und kulturellen Kontext widerspiegelte. Die Arbeit zeigt auf, wie der Stoff im Laufe der Jahrhunderte angepasst und neu interpretiert wurde und wie er dazu diente, moralische und politische Ideale zu vermitteln oder zu hinterfragen.
- Citation du texte
- Claudia Schmidt (Auteur), 2008, Die Figur der Lucretia in der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179009