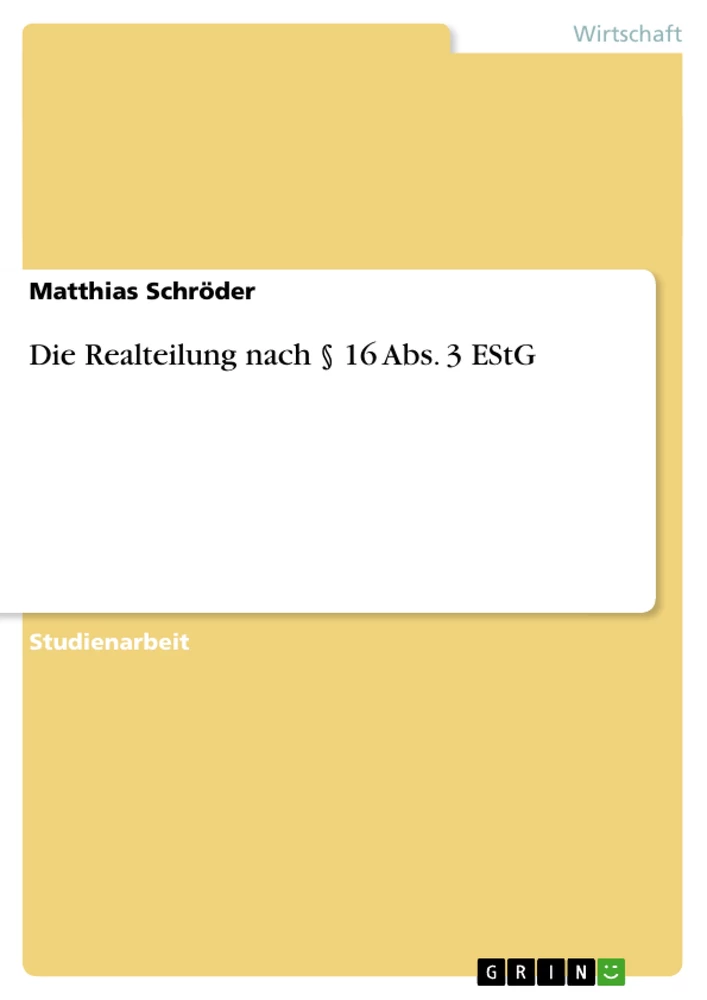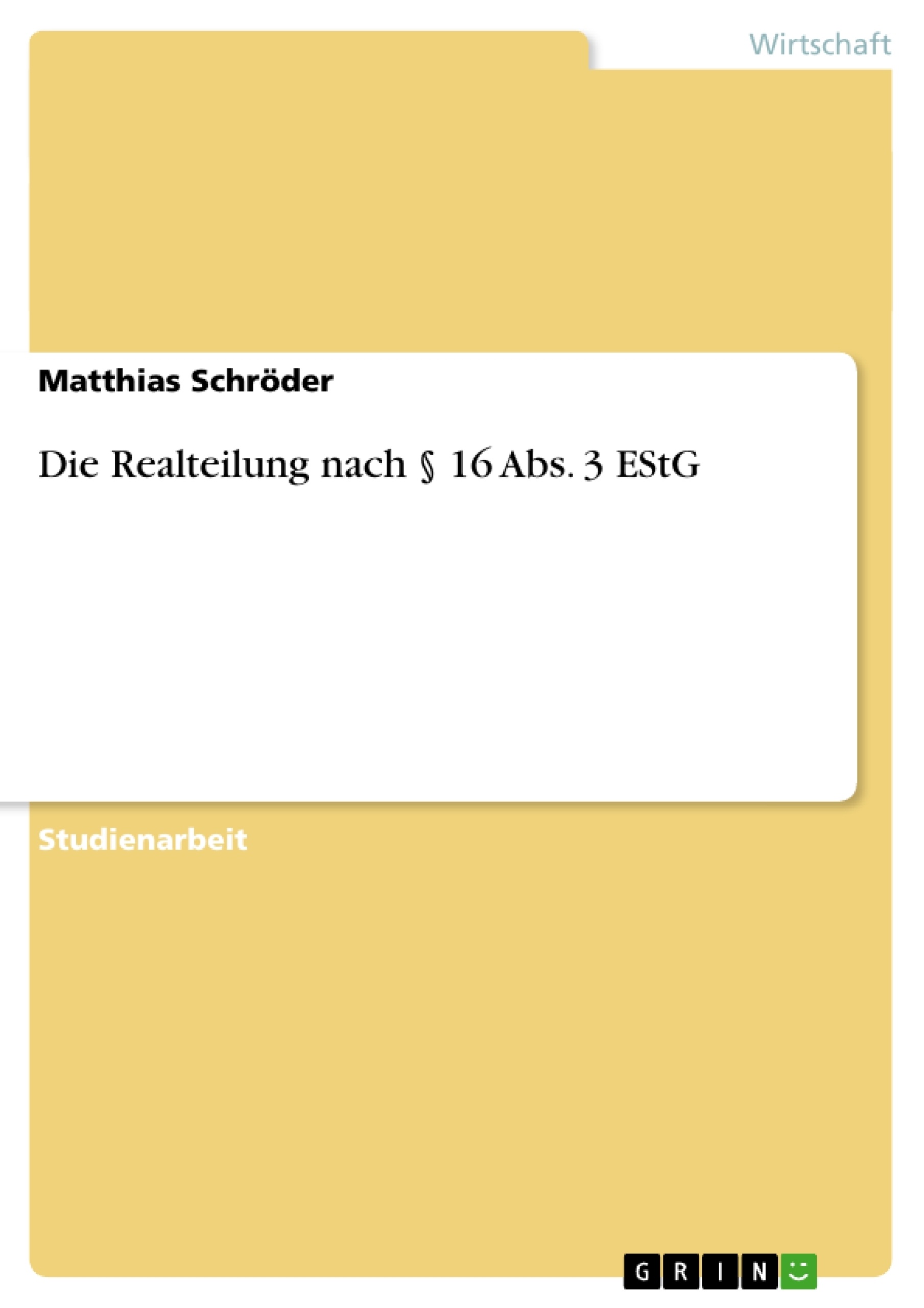Im Wirtschaftsleben kommt es neben Unternehmensgründungen auch regelmäßig dazu, dass ein Unternehmen seinen Betrieb einstellt. Bei Personengesellschaften stellt sich nun jedoch die Frage, was mit dem Betrieb geschehen soll. Er kann als Einheit oder in Teilen veräußert werden, um den Verkaufserlös danach unter den Mitunternehmern aufzuteilen, aber auch eine Verteilung des Betriebsvermögens unter den Mitunternehmern in natura ist eine denkbare Lösung. Das Betriebsvermögen kann dann direkt in das Privatvermögen überführt werden oder die einzelnen Mitunternehmer entscheiden sich, den Betrieb real zu teilen und ihren Anteil in eine neu gegründete oder bereits bestehende Gesellschaft einzubringen. Dadurch erhalten sie die Chance, einen Teilbetrieb eigenständig weiterzuführen und können so ihre Unternehmertätigkeit fortsetzen. Da es sich in diesem Fall jedoch lediglich um einen Umstrukturierungsvorgang handelt, hat der Gesetzgeber in § 16 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) die Realteilung geregelt, welche es ermöglicht, die stillen Reserven des verteilten Betriebsvermögens zu schonen. Sofern die Besteuerung der stillen Reserven in der Zukunft sichergestellt ist, können die Realteiler deshalb unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen die steuerliche Belastung durch Aufdeckung der stillen Reserven bis zu ihrer Realisierung aufschieben.
Diese Seminararbeit soll die Realteilung gemäß § 16 Abs. 3 EStG erläutern. Nach der Definition und der Abgrenzung werden zuerst die bestehenden Voraussetzungen einer Realteilung erklärt. Danach wird erläutert, was bei der Durchführung einer Realteilung beachtet werden muss, wobei ebenfalls auf die Besonderheiten bei der Beteiligung juristischer Personen hingewiesen wird. Es folgt eine genauere Betrachtung der Problematik eines Spitzenausgleichs und es werden Möglichkeiten genannt, diesen zu umgehen. Schließlich werden die Folgen einer Realteilung aufgezeigt, wobei neben den bilanziellen Folgen auch erläutert wird, was passiert, wenn die gesetzliche Sperrfrist missachtet wird. Gegen Ende wird die eventuelle Beeinflussung anderer Steuerarten in Form der Umsatz-, Grunderwerb- und Schenkungsteuer behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Abgrenzung der Realteilung
- 3. Voraussetzungen für eine Realteilung
- 4. Durchführung der Realteilung
- 4.1. Einteilung des Betriebsvermögens
- 4.2. Die Kapitalkontenanpassungsmethode
- 4.3. Übertragung von Gesamthandsvermögen
- 4.4. Besonderheiten bei der Beteiligung juristischer Personen
- 4.5. Der Spitzenausgleich
- 4.5.1. Durchführung
- 4.5.2. Möglichkeiten zur Umgehung
- 5. Folgen der Realteilung
- 5.1. Bilanzierung
- 5.2. Verpachtung von Teilbetrieben
- 5.3. Folgen bei Missachtung der Sperrfrist
- 5.4. Beeinflussung anderer Steuerarten
- 5.4.1. Umsatzsteuer
- 5.4.2. Grunderwerbsteuer
- 5.4.3. Schenkungsteuer
- 6. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Realteilung nach § 16 Abs. 3 EStG, einem Verfahren zur Auflösung von Personengesellschaften, das die Schonung stiller Reserven im Betriebsvermögen ermöglicht. Die Arbeit untersucht die Definition und Abgrenzung der Realteilung, die Voraussetzungen für ihre Anwendung, die Durchführungsmodalitäten und die steuerlichen Folgen für die beteiligten Gesellschafter.
- Definition und Abgrenzung der Realteilung
- Voraussetzungen für die Realteilung
- Durchführung der Realteilung
- Steuerliche Folgen der Realteilung
- Besonderheiten bei der Beteiligung juristischer Personen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Realteilung ein und erläutert die Notwendigkeit einer steuerlichen Schonung stiller Reserven bei der Auflösung von Personengesellschaften. Kapitel 2 definiert den Begriff der Realteilung und grenzt ihn von anderen Formen der Betriebsaufgabe ab. Kapitel 3 beschreibt die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Vermögensverteilung als Realteilung im Sinne des § 16 Abs. 3 EStG gilt. Kapitel 4 behandelt die Durchführung der Realteilung, einschließlich der Einteilung des Betriebsvermögens, der Kapitalkontenanpassungsmethode, der Übertragung von Gesamthandsvermögen, der Besonderheiten bei der Beteiligung juristischer Personen und der Problematik des Spitzenausgleichs. Die Folgen der Realteilung werden in Kapitel 5 untersucht, unter anderem die Auswirkungen auf die Bilanzierung, die Verpachtung von Teilbetrieben, die Folgen bei Missachtung der Sperrfrist und die Beeinflussung anderer Steuerarten wie Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und Schenkungsteuer.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Realteilung nach § 16 Abs. 3 EStG, die stille Reserven, die Betriebsaufgabe, die Voraussetzungen für die Realteilung, die Durchführungsmodalitäten, die Kapitalkontenanpassungsmethode, der Spitzenausgleich, die Folgen der Realteilung, die Bilanzierung, die Verpachtung von Teilbetrieben, die Sperrfrist, die Umsatzsteuer, die Grunderwerbsteuer und die Schenkungsteuer.
- Citar trabajo
- Matthias Schröder (Autor), 2011, Die Realteilung nach § 16 Abs. 3 EStG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179044