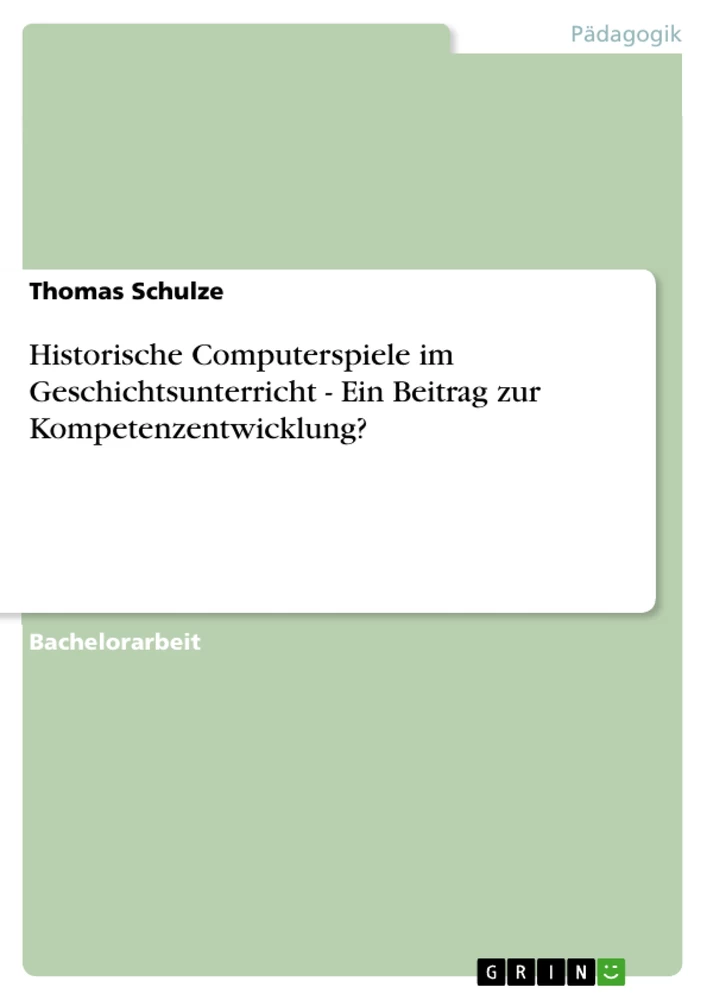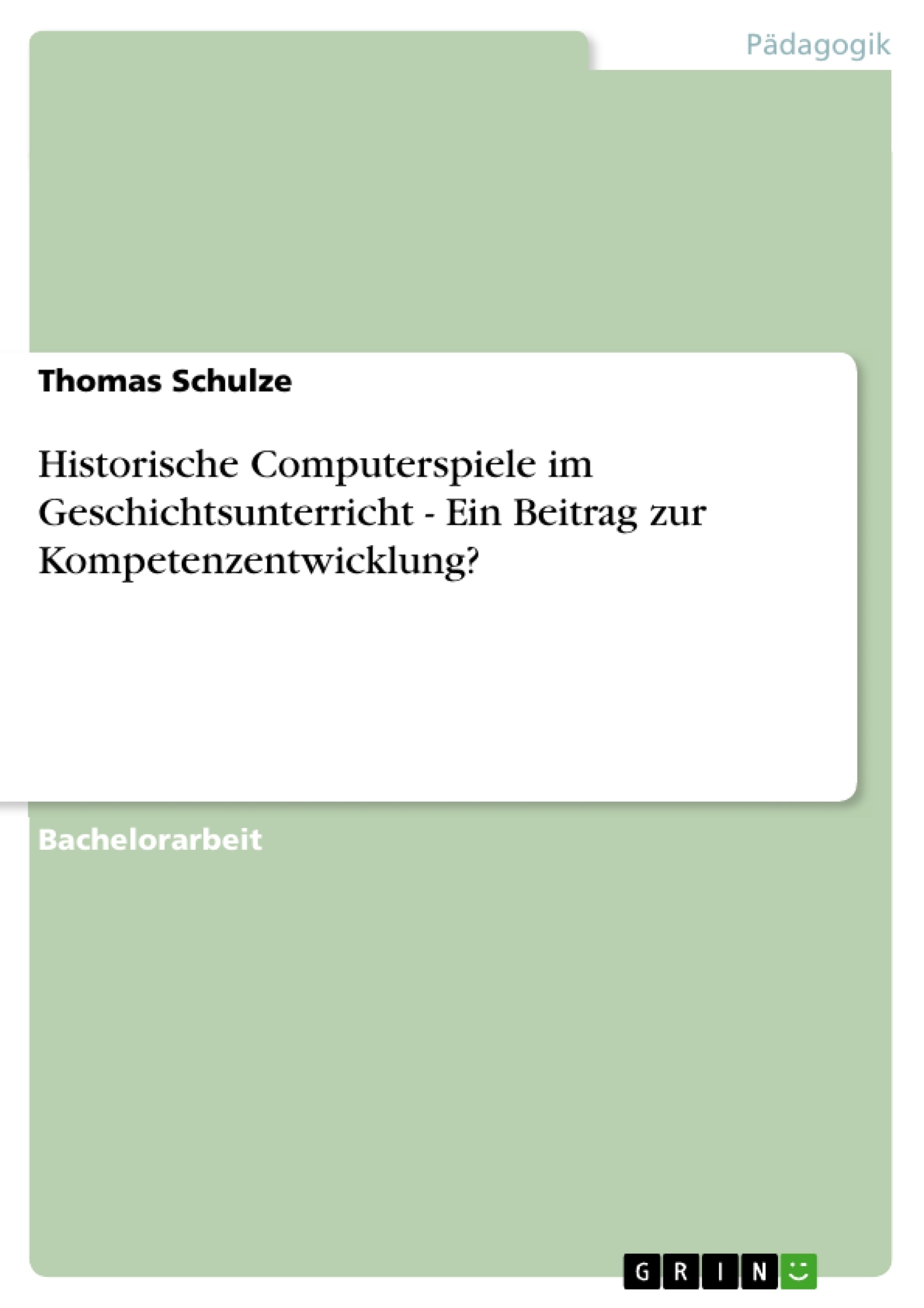Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit populäre historische Computerspiele Beiträge zur Kompetenzentwicklung und Kompetenzförderung im Geschichtsunterricht leisten können. Die Popularität und Allgegenwärtigkeit historischer Computerspiele, insbesondere in Form historischer Strategiespiele, die Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Computerspielen und die Wirkung historischer Computerspiele auf ihre Rezipienten stellen dabei den Ausgangspunkt einer Frage nach dem kompetenzförderlichen Potential dieser Unterhaltungsprodukte. Im Kern der Arbeit stehen dabei drei Fragen: Welche Legitimationsgrundlage hat ein Einsatz historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht? Wie erzählen Computerspiele Geschichte? Wie können historische Computerspiele zur Kompetenzentwicklung beitragen?
Der erste Teil der Arbeit setzt sich zunächst mit der Spieltheorie auseinander und fragt, welchen Platz historische Computerspiele im Geschichtsunterricht haben und inwiefern sich Nutzungsmotive, Faszination und Motivationspotentiale historischer Computerspiele für die pädagogische Praxis nutzen lassen. Der zweite Teil der Arbeit untersucht, wie historische Computerspiele erzählen, welche konkreten Geschichtsbilder sich aus ihren Narrationen entwickeln und wie der Wert dieser Geschichtsbilder in Hinblick auf einen potentiellen Einsatz im Unterricht einzuschätzen ist. Schließlich werden im dritten Teil Chancen, Grenzen und kompetenzförderliche Potentiale historischer Computerspiele diskutiert und anhand des historischen Strategiespiels Imperium Romanum drei mögliche Ansätze zur Kompetenzförderung durch den Einsatz historischer Computerspiele vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Historische Computerspiele im Geschichtsunterricht — ein Beitrag zur Kompetenzentwicklung?
- Historische Computerspiele als Medien des Geschichtsunterrichts
- Spieltheorie und spielerische Sinnbildung
- Nutzungsmotive, Faszination und Motivationspotentiale von (historischen) Computerspielen
- Historische Computerspiele als Narrationen
- Narration und Fiktion im historischen Computerspiel
- Geschichtsbilder historischer Computerspiele
- Historische Computerspiele als Beitrag zur Kompetenzentwicklung?
- Chancen, Grenzen und kompetenzförderliche Potentiale
- Kompetenzförderliche Potentiale historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht am Beispiel von Imperium Romanum
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Computerspiele und Medien
- Forschungsliteratur
- Bildanhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit populäre historische Computerspiele zur Kompetenzentwicklung und -förderung im Geschichtsunterricht beitragen können. Die Arbeit untersucht die Legitimationsgrundlage des Einsatzes historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht, analysiert die Narrationen und Geschichtsbilder dieser Spiele und diskutiert schließlich die Chancen, Grenzen und kompetenzförderlichen Potentiale historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht.
- Die Legitimationsgrundlage für den Einsatz historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht
- Die spezifischen Narrationen und Geschichtsbilder historischer Computerspiele
- Die Chancen und Grenzen historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht
- Die Kompetenzförderlichen Potentiale historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht
- Die Analyse des Computerspiels Imperium Romanum als Beispiel für die Anwendung der Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage nach dem kompetenzförderlichen Potential historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht. Es werden drei zentrale Fragen formuliert, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen: Welche Legitimationsgrundlage hat ein Einsatz historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht? Wie erzählen Computerspiele Geschichte? Wie können historische Computerspiele zur Kompetenzentwicklung beitragen?
Im ersten Teil der Arbeit wird die Spieltheorie beleuchtet und die Frage nach dem Platz historischer Computerspiele im Geschichtsunterricht diskutiert. Es werden die Nutzungsmotive, Faszination und Motivationspotentiale historischer Computerspiele für die pädagogische Praxis untersucht.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Analyse der Narrationen historischer Computerspiele und der daraus resultierenden Geschichtsbilder. Es wird untersucht, wie Computerspiele Geschichte erzählen, welche konkreten Geschichtsbilder sich aus ihren Narrationen entwickeln und wie der Wert dieser Geschichtsbilder in Hinblick auf einen potentiellen Einsatz im Unterricht einzuschätzen ist.
Im dritten Teil der Arbeit werden Chancen, Grenzen und kompetenzförderliche Potentiale historischer Computerspiele diskutiert. Anhand des historischen Strategiespiels Imperium Romanum werden drei mögliche Ansätze zur Kompetenzförderung durch den Einsatz historischer Computerspiele vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen historische Computerspiele, Geschichtsunterricht, Kompetenzentwicklung, Kompetenzförderung, Spieltheorie, Narration, Geschichtsbild, Imperium Romanum, Medienkompetenz, Methodenkompetenz, Deutungs- und Analysekompetenz, Urteils- und Orientierungskompetenz.
- Quote paper
- Thomas Schulze (Author), 2011, Historische Computerspiele im Geschichtsunterricht - Ein Beitrag zur Kompetenzentwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179154