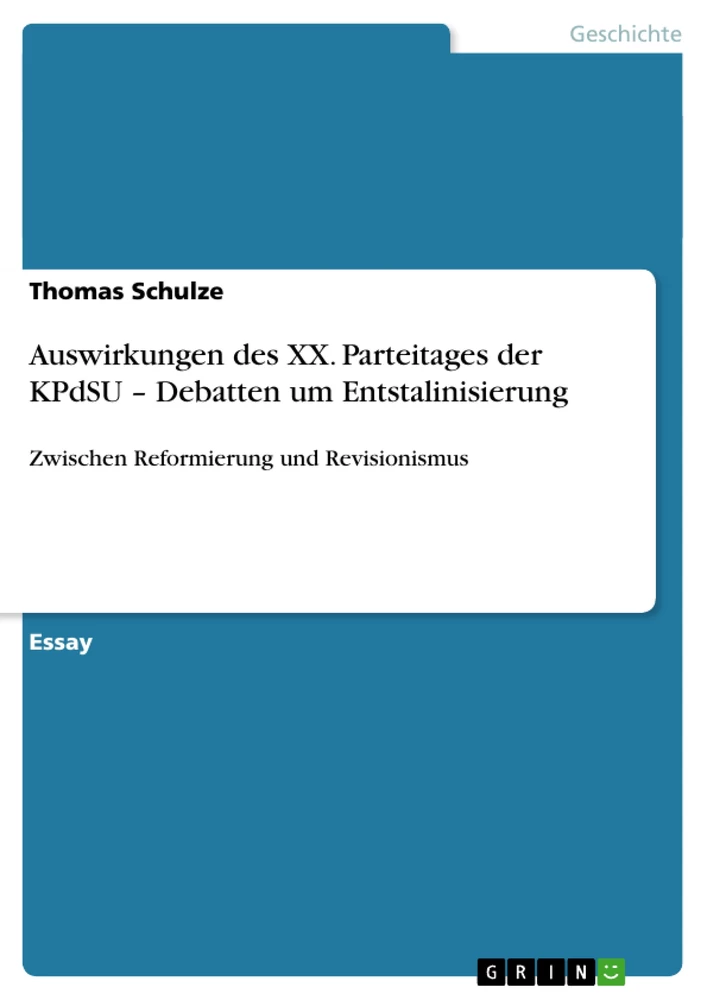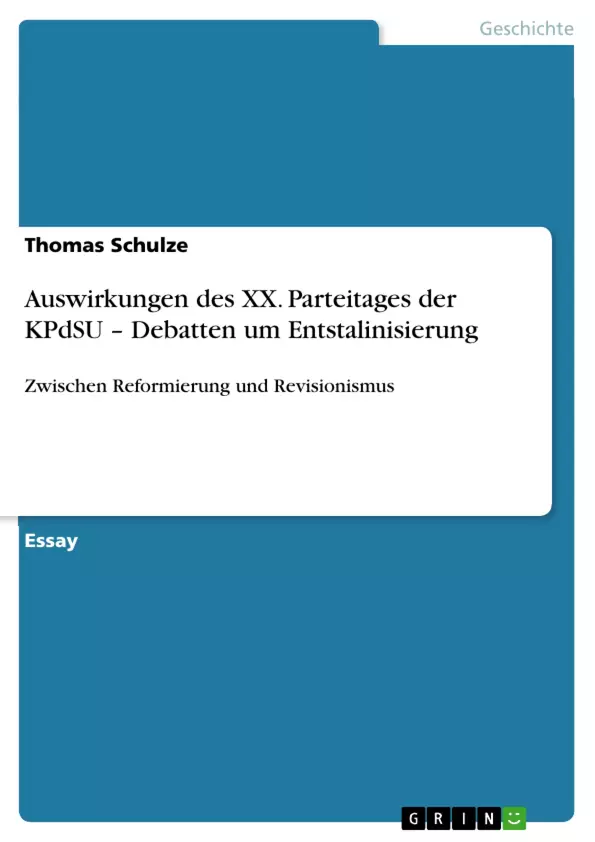Der Traum einer künstlerischen und wissenschaftlichen Liberalisierung in der DDR endete im Winter des Jahres 1956. Wolfgang Harich, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, wird als Folge der Veröffentlichung und Versendung der „Plattform eines besonderen deutschen Weges zum Sozialismus“ verhaftet. Im Zuge seiner Verhaftung werden alle Hoffnungen auf politische und soziale Reformen zerstört. Wie konnte es trotz der positiven politischen Zeichen Anfang des Jahres 1956 zu einer solchen Entwicklung kommen?
Im Kern dieses Essays soll folglich die Frage stehen, inwieweit die Folgen des XX. Parteitages der KPdSU im kulturellen Bereich als Prozess der Entstalinisierung bzw. Liberalisierung bezeichnet werden können und welche Chancen und Reformen sich die Intellektuellen und Künstler der DDR vom Parteitag der KPdSU versprachen. Dabei stehen zunächst die Entwicklungen in der DDR bis 1956 im Vordergrund. Kernpunkt der Betrachtung stellen der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen für die Kulturpolitik der DDR dar.
Inhaltsverzeichnis
- DDR-Kulturpolitik seit 1953 und der XX. Parteitag der KPdSU
- Der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen für die Kulturpolitik der DDR
- Entstalinisierung, Konsolidierung und Inhaftierungen
- Die Folgen — Zwischen Entstalinisierung und Liberalisierung
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Auswirkungen des XX. Parteitages der KPdSU auf die Kulturpolitik der DDR im Kontext der Entstalinisierung und der Debatten um Reformierung und Revisionismus. Er untersucht die Hoffnungen und Erwartungen der Intellektuellen und Künstler der DDR auf eine künstlerische und wissenschaftliche Liberalisierung, die durch die Rede Chruschtschows über den Personenkult und seine Folgen geweckt wurden. Zudem werden die Reaktionen der SED-Führung auf diese Reformbestrebungen beleuchtet, die in der Verhaftung von Wolfgang Harich und der Zwangsemeritierung von Ernst Bloch gipfelten.
- Die Auswirkungen des XX. Parteitages der KPdSU auf die Kulturpolitik der DDR
- Die Hoffnungen und Erwartungen der Intellektuellen und Künstler auf eine Liberalisierung
- Die Reaktionen der SED-Führung auf die Reformbestrebungen
- Die Debatten um Entstalinisierung, Reformierung und Revisionismus
- Die Folgen der Verhaftung von Wolfgang Harich und der Zwangsemeritierung von Ernst Bloch
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Darstellung der DDR-Kulturpolitik seit 1953 und der Reformdiskussion innerhalb der SED. Im Fokus steht der XX. Parteitag der KPdSU und seine Bedeutung für die politische Stimmung in der DDR. Die Rede Chruschtschows über den Personenkult und seine Folgen wird als ein Wendepunkt in der sowjetischen und ostdeutschen Geschichte betrachtet, der neue Hoffnungen auf eine Liberalisierung der Kultur und der Wissenschaften weckte. Die Intellektuellen und Künstler der DDR sahen in den Ereignissen des Parteitages eine Chance auf mehr Freiheiten und eine andere Politik der SED.
Im weiteren Verlauf des Essays werden die Reaktionen der SED-Führung auf die Reformbestrebungen der Intellektuellen und Künstler analysiert. Die Verhaftung von Wolfgang Harich und die Zwangsemeritierung von Ernst Bloch werden als Ausdruck der Angst der SED-Führung vor einer möglichen Destabilisierung des Systems interpretiert. Die Ereignisse Ende des Jahres 1956 und Anfang 1957 markieren das Scheitern der Hoffnungen auf eine Reformierung der Kulturpolitik in der DDR.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den XX. Parteitag der KPdSU, die Entstalinisierung, die Kulturpolitik der DDR, die Debatten um Reformierung und Revisionismus, die Intellektuellen und Künstler der DDR, die Verhaftung von Wolfgang Harich, die Zwangsemeritierung von Ernst Bloch, die SED-Führung und die politische Stimmung in der DDR.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung des XX. Parteitages der KPdSU für die DDR?
Chruschtschows Rede gegen den Personenkult Stalins weckte 1956 Hoffnungen auf eine politische und kulturelle Liberalisierung sowie auf Reformen innerhalb der SED.
Wer war Wolfgang Harich und was geschah mit ihm?
Harich war ein Professor, der Reformen forderte ("Plattform"). Er wurde Ende 1956 verhaftet, was das Ende der Hoffnungen auf eine Entstalinisierung in der DDR markierte.
Wie reagierte die SED-Führung auf die Entstalinisierungs-Debatten?
Nach anfänglichem Zögern reagierte die Führung mit Härte, Inhaftierungen und der Bekämpfung des sogenannten "Revisionismus", um ihre Macht zu sichern.
Welche Rolle spielte Ernst Bloch in dieser Zeit?
Der Philosoph Ernst Bloch galt als geistiger Kopf der Reformbestrebungen und wurde im Zuge der Restriktionen zwangsemeritiert.
Kam es in der DDR-Kulturpolitik zu einer echten Liberalisierung?
Nur kurzzeitig; der Prozess wurde durch die Angst der SED vor einem Kontrollverlust (ähnlich wie in Ungarn 1956) schnell wieder gestoppt.
- Quote paper
- Thomas Schulze (Author), 2009, Auswirkungen des XX. Parteitages der KPdSU – Debatten um Entstalinisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179159