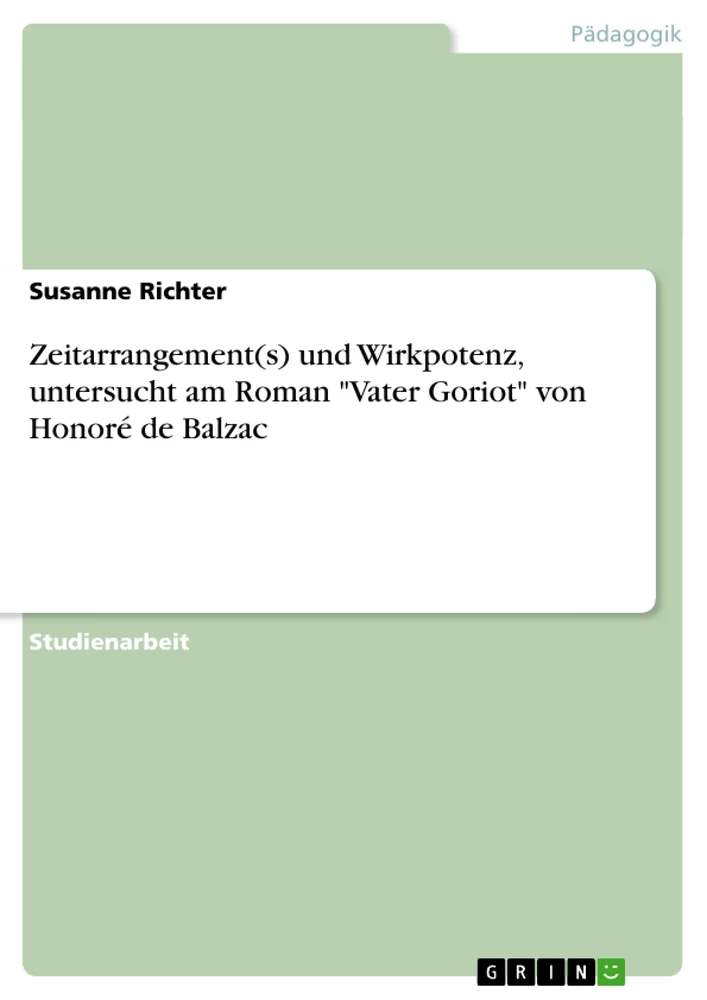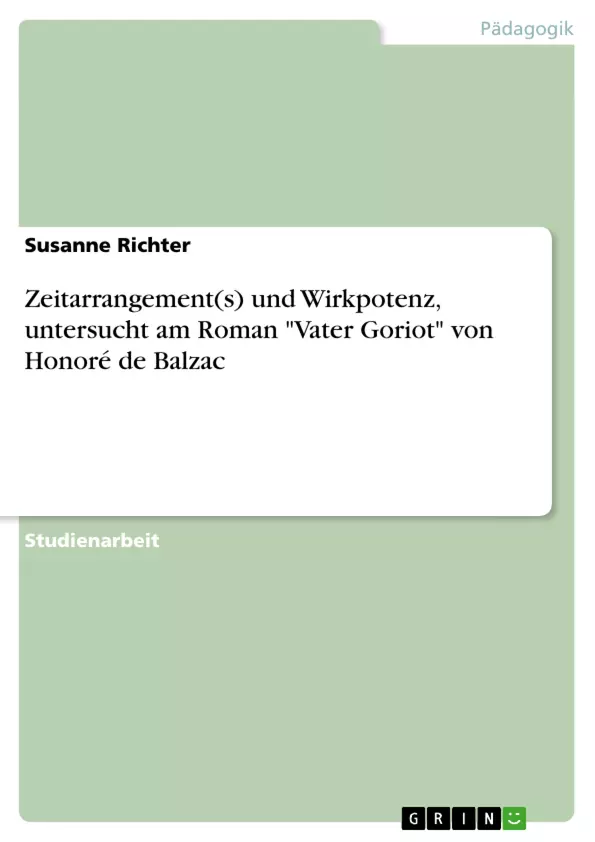„Eine Geschichte kann man ohne weiteres erzählen, ohne genau anzugeben, an welchem Ort sie spielt oder ob dieser Ort mehr oder weniger weit von dem Ort entfernt ist, wo man sie erzählt; während es so gut wie unmöglich ist, sie nicht zeitlich in Bezug zu dem narrativen Akt zu situieren, da man sie notwendigerweise in einer Zeitform der Gegenwart, der Vergangenheit oder der Zukunft erzählen muss.“1 Doch nicht nur diese Zeit der Narration spielt eine wichtige Rolle, sondern auch die gesamte zeitliche Organisation. Sie gilt als ein wesentlicher Teil der Textstruktur. Gérard Genette hat 1972 in seinem Buch „Die Erzählung“ ein Analyseinstrumentarium entwickelt, das geeignet ist, die „äußerst komplexen Strukturen der Zeitkonstitution zu erfassen“.2
Robert Petsch (1934) erkannte die Zeitstruktur als eine unerläßliche Dimension im Text. Bahnbrechend waren die Feststellungen, dass bestimmte Formen der Zeitbehandlung ein Organisationsprinzip par excellence narrativer Texte seien und dass sie nicht nur eine handlungsbezogene Funktion hätten, sondern zugleich eine Bedeutung in Bezug auf den Leser. Die Zeitbehandlung wird also als Wirkinstrument entdeckt. Die temporale Struktur ist zum Beispiel Träger einer „Botschaft“, aber auch eine wichtige strukturierende Instanz und ein verbindendes Element zwischen Erzähler und Leser. In meiner Hausarbeit möchte ich mich mit dem Thema „Zeitarrangement und Wirkpotenz“ am Beispiel von Honoré de Balzacs Roman „Vater Goriot“ beschäftigen. In meiner Analyse werde ich mich vor allem auf das Werk von Genette beziehen, in welchem er zwischen den Organisationsprinzipien ‚ordre‘, ‚durée‘ und ‚fréquence‘3 unterscheidet – mit der Absicht, die Rezeption des Lesers stärker zu lenken. Honoré de Balzac ist am 20. Mai 1799 in Tours geboren und am 18. August 1850 in Paris gestorben. In nur 40 Tagen hat er den Roman „Vater Goriot“, mit dem er eine der ergreifendsten Gestalten seiner Menschlichen Komödie geschaffen hat, fertiggestellt. Es ist ein Meisterwerk der „Scènes de la vie privée“, wo er die Spezies Mensch als gesellschaftliches Wesen mit naturwissenschaftlicher Methode darzustellen versucht. Balzac zeigt kraftvolle Charaktere, die sich gegen die herrschende Gesellschaft auflehnen. „Seine Geschöpfe, mögen sie noch so bizarr erscheinen, leben und sind wirklicher als die Wirklichkeit. Es sind Prototypen, die einen Stand, einen Charakter, eine Eigenschaft in übertriebener Weise vertreten: [...] Vater Goriot die Vaterliebe, Baron von Nucingen die Finanz [...].“4
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gliederung des Romans
- Elemente der Erzählstruktur im Expositions- und Handlungsteil
- Zäsuren als bewußte Form der Zeitangabe
- Zeit der Erzählung
- Zeitenwechsel Gegenwart - Vergangenheit
- Anachronien der Erzählung
- Prolepse
- Analepse oder Retrospektion
- Analepse in der Analepse
- Zeitüberlagerung
- Dauer einer erzählten Geschichte
- Isochronie
- Anisochronie
- Summary und Szene
- Pause oder Zeitdehnung
- Zeitliche Ellipse
- Wiederholungsbeziehungen
- Schlußbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Thema „Zeitarrangement und Wirkpotenz“ am Beispiel von Honoré de Balzacs Roman „Vater Goriot“. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der zeitlichen Struktur des Romans, insbesondere auf die Prinzipien von „ordre“, „durée“ und „fréquence“, wie sie von Gérard Genette definiert werden. Die Analyse zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie diese Prinzipien die Rezeption des Lesers beeinflussen.
- Zeitliche Struktur und Organisationsprinzipien im Roman
- Einfluss der Zeitbehandlung auf die Leserrezeption
- Analyse von „ordre“, „durée“ und „fréquence“ im Werk von Genette
- Der Roman „Vater Goriot“ als Fallstudie
- Die Relevanz von Zeitstrukturen in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Zeitstruktur in der Literatur dar und führt den Leser in die Thematik von „Zeitarrangement und Wirkpotenz“ ein. Die Arbeit konzentriert sich auf die zeitliche Organisation des Romans „Vater Goriot“, wobei sie sich insbesondere auf die Prinzipien von „ordre“, „durée“ und „fréquence“ stützt, die von Gérard Genette im Buch „Die Erzählung“ entwickelt wurden.
Das zweite Kapitel behandelt die Gliederung des Romans und die Unterscheidung zwischen statischem Expositionsteil und dynamischem Handlungsteil. Dabei wird die spezifische Struktur von „Vater Goriot“ hinsichtlich der Verwendung von Zeitstrukturen analysiert.
Kapitel drei befasst sich mit den Elementen der Erzählstruktur im Expositions- und Handlungsteil des Romans. Hier werden verschiedene Aspekte der Zeitbehandlung im Roman untersucht, darunter Zäsuren, Zeitenwechsel, Anachronien, Prolepse, Analepse, Zeitüberlagerung, Dauer einer erzählten Geschichte und Wiederholungsbeziehungen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusgebiete dieser Arbeit sind Zeitarrangement, Wirkpotenz, Erzählstruktur, Romananalyse, Zeitkonstitution, Gérard Genette, „ordre“, „durée“, „fréquence“, Honoré de Balzac, „Vater Goriot“, Anachronien, Analepse, Prolepse, Zeitüberlagerung, Isochronie, Anisochronie, Summary, Szene, Zeitdehnung, Zeitliche Ellipse, Wiederholungsbeziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Hausarbeit am Roman "Vater Goriot"?
Die Arbeit analysiert das "Zeitarrangement" und die "Wirkpotenz", also wie die zeitliche Struktur des Romans die Wahrnehmung des Lesers beeinflusst.
Welches theoretische Analysemodell wird verwendet?
Die Analyse stützt sich primär auf das Instrumentarium von Gérard Genette, insbesondere auf die Kategorien Ordre (Ordnung), Durée (Dauer) und Fréquence (Frequenz).
Was versteht man unter Anachronien in der Erzählung?
Anachronien sind Abweichungen von der chronologischen Reihenfolge, unterteilt in Analepsen (Rückblenden) und Prolepsen (Vorausdeutungen).
Welche Rolle spielen Zäsuren im Werk von Balzac?
Zäsuren dienen als bewusste Form der Zeitangabe und strukturieren den Übergang zwischen dem statischen Expositionsteil und dem dynamischen Handlungsteil des Romans.
Was ist der Unterschied zwischen Isochronie und Anisochronie?
Isochronie bezeichnet eine gleichmäßige Erzählgeschwindigkeit, während Anisochronie durch Phänomene wie Zeitdehnung, Ellipsen oder Raffung (Summary) gekennzeichnet ist.
Warum wird Honoré de Balzacs Methode als "naturwissenschaftlich" bezeichnet?
Balzac versucht in seiner "Menschlichen Komödie", den Menschen als gesellschaftliches Wesen fast wie eine biologische Spezies in verschiedenen sozialen Milieus zu porträtieren.
- Quote paper
- Susanne Richter (Author), 2001, Zeitarrangement(s) und Wirkpotenz, untersucht am Roman "Vater Goriot" von Honoré de Balzac, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17922