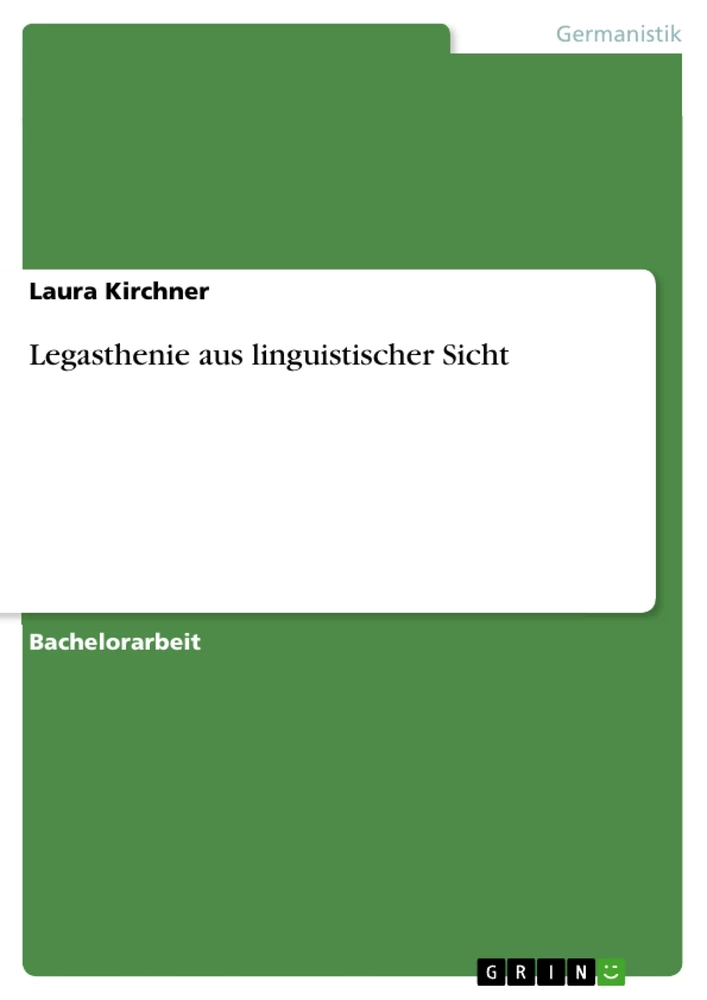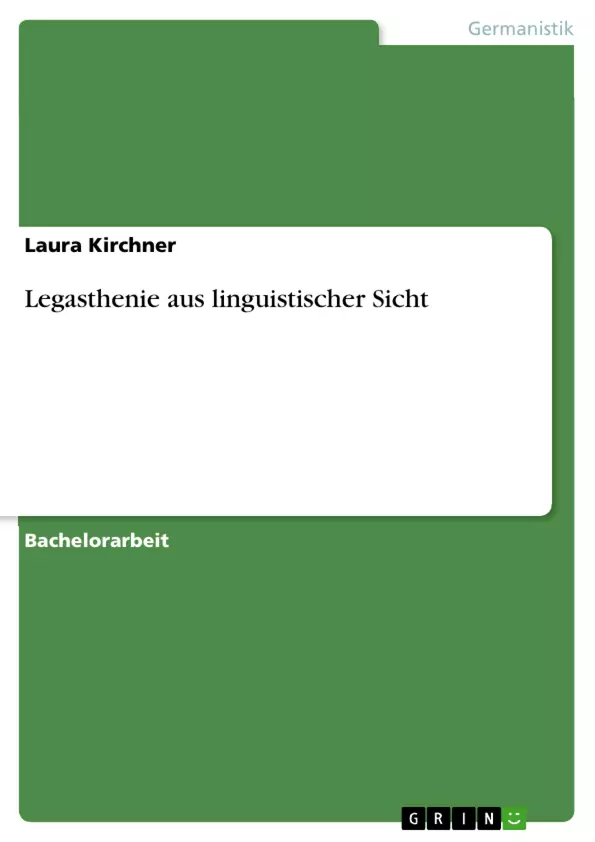Schreiben und Lesen gehören zu den wichtigsten Kulturtechniken des Menschen. Sie dienen beispielsweise zur Informationsaufnahme und Kommunikation. Probleme und Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben bedeuten für die Betroffenen Einschränkungen der Lebensqualität. In immer mehr Schulklassen sind Kinder, die schon im Anfangsunterricht Lese- und Schreib-Probleme aufweisen. Seit circa 100 Jahren wird das Thema Legasthenie in der Wissenschaft beleuchtet. Von dem Zeitpunkt an, hat sich die Wissenschaft vom medizinischen Ansatz über den prozessbezogenen bis hin zum personenbezogenen Ansatz entwickelt. Die Annahme, es gäbe eine von allen anerkannte Theorie zum Thema Legasthenie, wäre falsch. Denn immer wieder treten neue Ansätze auf und es scheint fast, dass in nahezu jedem denkbaren Teilbereich der Wissenschaft eine ganz eigene Theorie vorherrscht.
Diese Arbeit nimmt den sprachwissenschaftlichen Blickwinkel ein. Davon ausgehend wird bei genauerer Beschäftigung mit dem Konstrukt der Legasthenie deutlich, welche Fachwörter von Bedeutung sind. In neuesten wissenschaftlichen Quellen wird vermehrt der linguistische Termini ‚phonologische Bewusstheit‘ in Verbindung mit der Legasthenie genannt. Auf den folgenden Seiten wird eben dem angeschnittenen Zusammenhang nachgegangen. Daher steht diese Arbeit unter folgender Leitfrage: Welche Rolle nimmt die phonologische Bewusstheit im Rahmen der Legasthenie ein?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die phonologische Bewusstheit
3. Legasthenie
3.1 Zwischen Legasthenie und LRS: Begriffsklärung mit historischen Aspekten
3.2 Der ungestörte Schriftspracherwerb
3.3 Die Vorläufermerkmale des Schriftspracherwerbs
3.4 Das Erscheinungsbild der Legasthenie und ihre Ursachen
3.5 Zwischenfazit
4. Früherkennung und Fördermöglichkeit
4.1 Früherkennungsmöglichkeit: BISC
4.2 Fördermöglichkeit: Würzburger Trainingsprogramm
4.3 Kritische Würdigung des BISC und Würzburger Trainingsprogramms
5. Fazit und Ausblick
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Legasthenie aus linguistischer Sicht?
Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive wird Legasthenie oft mit Defiziten in der phonologischen Bewusstheit und dem Schriftspracherwerb in Verbindung gebracht.
Was bedeutet "phonologische Bewusstheit"?
Es ist die Fähigkeit, die Lautstruktur der Sprache zu erkennen, wie zum Beispiel das Reimen, das Silbentrennen oder das Identifizieren einzelner Laute.
Gibt es einen Unterschied zwischen Legasthenie und LRS?
Die Arbeit klärt diese Begriffe historisch und zeigt auf, wie sich die Definitionen vom medizinischen zum personenbezogenen Ansatz entwickelt haben.
Was ist das "Würzburger Trainingsprogramm"?
Es ist eine Fördermöglichkeit zur Steigerung der phonologischen Bewusstheit bei Kindern, um Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorzubeugen.
Wie kann man Legasthenie frühzeitig erkennen?
Ein bekanntes Früherkennungsinstrument ist das BISC (Bielefelder Screening), das Vorläufermerkmale des Schriftspracherwerbs prüft.
- Citation du texte
- Laura Kirchner (Auteur), 2011, Legasthenie aus linguistischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179280