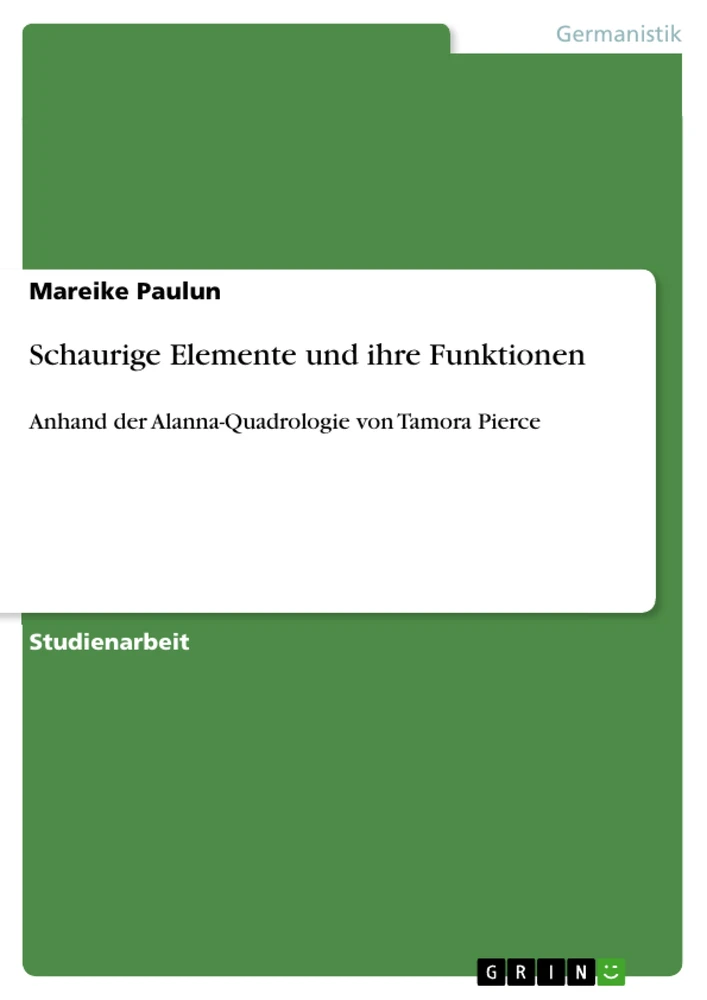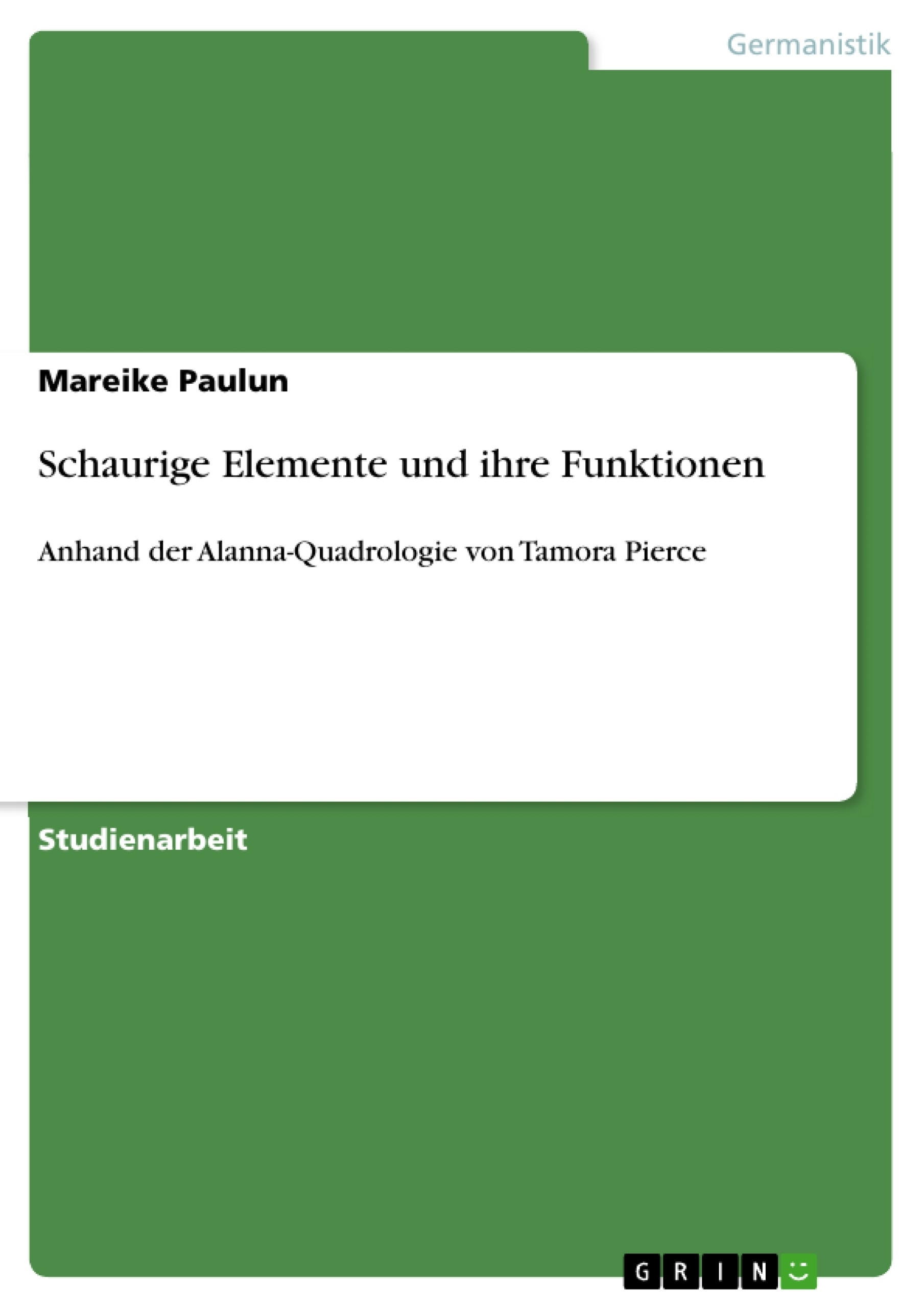In der vorliegenden Arbeit wird beschrieben, welche Funktionen die Schauplätze dieser Szenen sowohl im Einzelnen als auch unter Berücksichtigung des Gesamtwerkes haben. Dabei handelt es sich um drei sowohl in ihrer szenischen Komposition als auch handlungsmarkierenden Eigenschaft augenfällige Episoden. Durch Interpretationsarbeit und Kontextualisierung werden ihre Funktionen ersichtlich. Eine detailliertere Vorab-Definition der gothic novel ermöglicht dabei die einfache Identifizierung schauerlicher Elemente.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die gothic novel
- Geschichte
- Definition
- Funktionen des gothic setting
- Die Ruinen
- Kontextuelle Einordnung
- Schauerliche Elemente
- Funktion der Szene
- Die Schwarze Stadt
- Kontextuelle Einordnung
- Schauerliche Elemente
- Funktion der Szene
- Das Gebirge
- Kontextuelle Einordnung
- Schauerliche Elemente
- Funktion der Szene
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktionen schauerlicher Elemente in der Alanna-Quadrologie von Tamora Pierce. Im Mittelpunkt stehen drei Szenen, die sich durch eine besonders hohe Konzentration dieser Elemente auszeichnen. Ziel ist es, die Bedeutung und Wirkung dieser Elemente in den einzelnen Szenen und im Kontext des Gesamtwerks zu beleuchten. Dabei werden die Schauplätze der Szenen in ihrer szenischen Komposition und handlungsmarkierenden Eigenschaft analysiert und in Verbindung mit dem Gesamtwerk interpretiert.
- Analyse der Funktionen von Schauer- und gothic novel Elementen in der Alanna-Quadrologie von Tamora Pierce
- Untersuchung der Bedeutung und Wirkung dieser Elemente in ausgewählten Szenen
- Interpretation der Schauplätze der Szenen in ihrem Kontext
- Kontextualisierung der Schauerromanelemente im Hinblick auf die Gesamtstruktur des Werkes
- Erforschung der Beziehung zwischen schauerlicher Atmosphäre und Jugendlicher Romanliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage definiert. Das zweite Kapitel widmet sich der gothic novel, ihre Geschichte und Definition, sowie die Funktionen des gothic settings. Die folgenden drei Kapitel analysieren drei ausgewählte Szenen: "Die Ruinen", "Die Schwarze Stadt" und "Das Gebirge". In jedem Kapitel werden die jeweiligen Schauplätze, die schauerlichen Elemente und deren Funktion im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schauerroman, gothic novel, Schauer, gothic setting, Tamora Pierce, Alanna-Quadrologie, Jugendroman, Szenenanalyse, Kontextualisierung, Funktion der Szene, Schauerliche Elemente, Ruine, Schwarze Stadt, Gebirge.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktionen haben schauerliche Elemente in der Alanna-Quadrologie?
Sie dienen dazu, handlungsmarkierende Episoden zu schaffen, die Atmosphäre zu verdichten und die Entwicklung der jugendlichen Protagonistin durch Grenzsituationen zu verdeutlichen.
Was ist ein „Gothic Setting“?
Ein Gothic Setting umfasst typische Schauplätze wie Ruinen, düstere Städte oder bedrohliche Gebirge, die Angst und Faszination zugleich auslösen.
Welche drei Szenen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schauplätze „Die Ruinen“, „Die Schwarze Stadt“ und „Das Gebirge“ in den Romanen von Tamora Pierce.
Wie wird die „Gothic Novel“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit liefert eine Vorab-Definition der Schauerromantik, um Elemente wie das Übernatürliche, Verfall und psychologischen Horror in der Jugendliteratur zu identifizieren.
Warum sind diese Elemente für Jugendromane relevant?
Sie helfen dabei, Themen wie Identitätsfindung und den Kampf gegen das „Böse“ in einem spannungsgeladenen, metaphorischen Rahmen darzustellen.
- Quote paper
- Mareike Paulun (Author), 2011, Schaurige Elemente und ihre Funktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179327