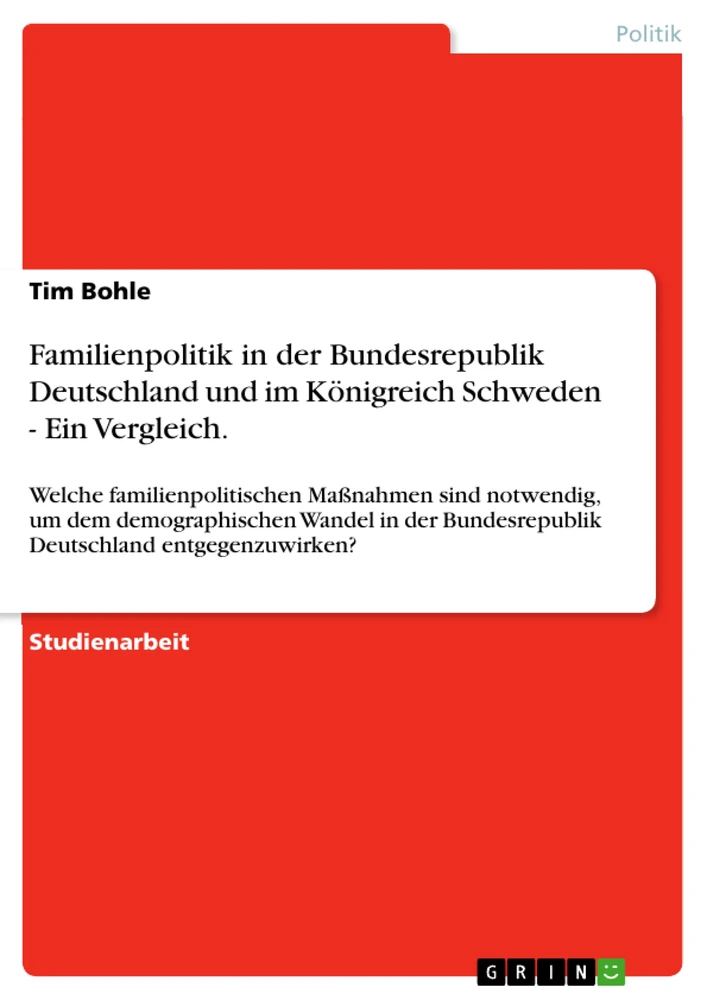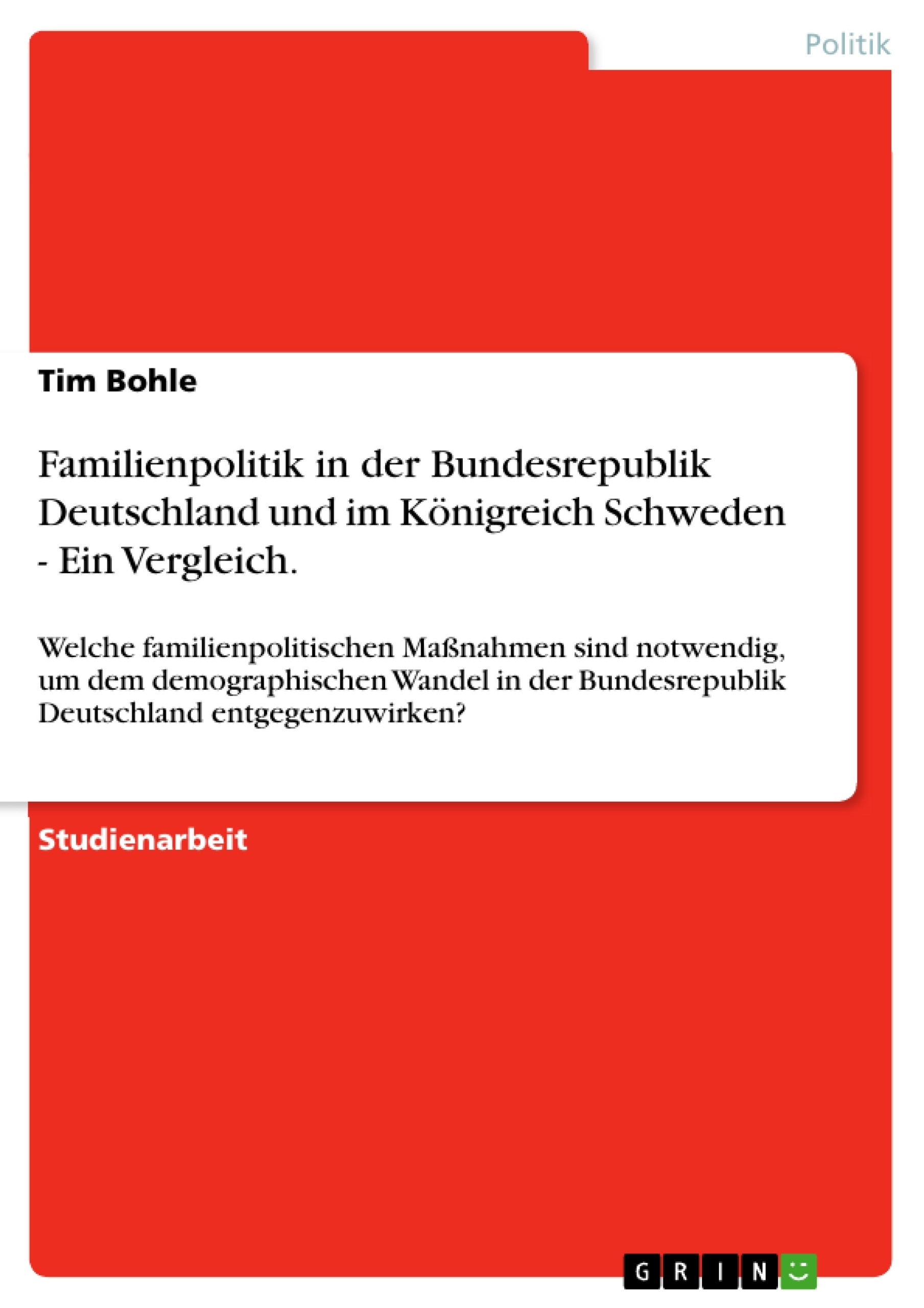In dieser Arbeit wird Schweden eine zentrale Rolle spielen, um die Unterschiede zum bundesdeutschen Ansatz in der Familienpolitik zu verdeutlichen.
Wie diese Maßnahmen aussehen, dazu im späteren Verlauf mehr, doch vorwegzunehmen ist das Schweden einen weniger direkt monetären Ansatz als die Bundesrepublik verfolg, sondern sich vielmehr darauf konzentriert infrastrukturelle Maßnahmen zur Förderung der Familie zu schaffen. Hierneben spielt die Gleichstellung von Mann und Frau eine entscheidende Rolle. Doch wie gesagt, dies soll vorerst reichen.
Diese Arbeit wird sich also unter der Fragestellung: „Welche familienpolitischen Maßnahmen sind notwendig, um dem Demographischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland entgegenzuwirken?“ genau mit diesen Fragen zur Familienpolitik und den Problemfeldern die der Demographische Wandel aufwirft beschäftigen. Sie wird Elemente der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, sowie im Königreich Schweden vergleichend analysieren und am Ende Schlüsse für die Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland ziehen und Anreize geben. Es soll beleuchtet werden ob die Familienpolitik überhaupt Einfluss auf den demographischen Wandel hat und haben kann und wenn ja, welche Faktoren notwendig sind um diesem entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen sowie Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden
- 2.1. Demographie / demographischer Wandel
- 2.2. Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.2.1 Bevölkerungsentwicklung im Königreich Schweden
- 3. Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden
- 3.1 Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
- 3.2. Familienpolitik im Königreich Schweden
- 4. Kinderbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden
- 4.1 Kinderbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.2 Kinderbetreuung im Königreich Schweden
- 4.3. Ergebnisse im Bezug auf die demographische Entwicklung
- 5. Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden
- 5.1. Ergebnisse im Bezug auf die demographische Entwicklung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden im Kontext des demographischen Wandels. Sie untersucht, welche familienpolitischen Maßnahmen notwendig sind, um dem demographischen Wandel in Deutschland entgegenzuwirken.
- Die Bedeutung des demographischen Wandels für die Familienpolitik
- Der Vergleich der Familienpolitik in Deutschland und Schweden
- Die Rolle der Kinderbetreuung und der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familienpolitik
- Die Wirksamkeit von familienpolitischen Maßnahmen im Hinblick auf die demographische Entwicklung
- Die Herausforderungen und Chancen der Familienpolitik im Kontext des demographischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den demographischen Wandel und die Familienpolitik. Kapitel 2 beleuchtet die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und Schweden und stellt den demographischen Wandel in den beiden Ländern dar. Kapitel 3 skizziert die Familienpolitik in Deutschland und Schweden. Kapitel 4 befasst sich mit der Kinderbetreuung und Kapitel 5 mit der Gleichstellung von Mann und Frau in den beiden Ländern. Die Ergebnisse im Hinblick auf die demographische Entwicklung werden jeweils in den Kapiteln 4 und 5 diskutiert.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, demographischer Wandel, Bundesrepublik Deutschland, Königreich Schweden, Kinderbetreuung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wohlfahrtsstaat, konservativer Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat.
- Quote paper
- Tim Bohle (Author), 2009, Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Schweden - Ein Vergleich., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179385