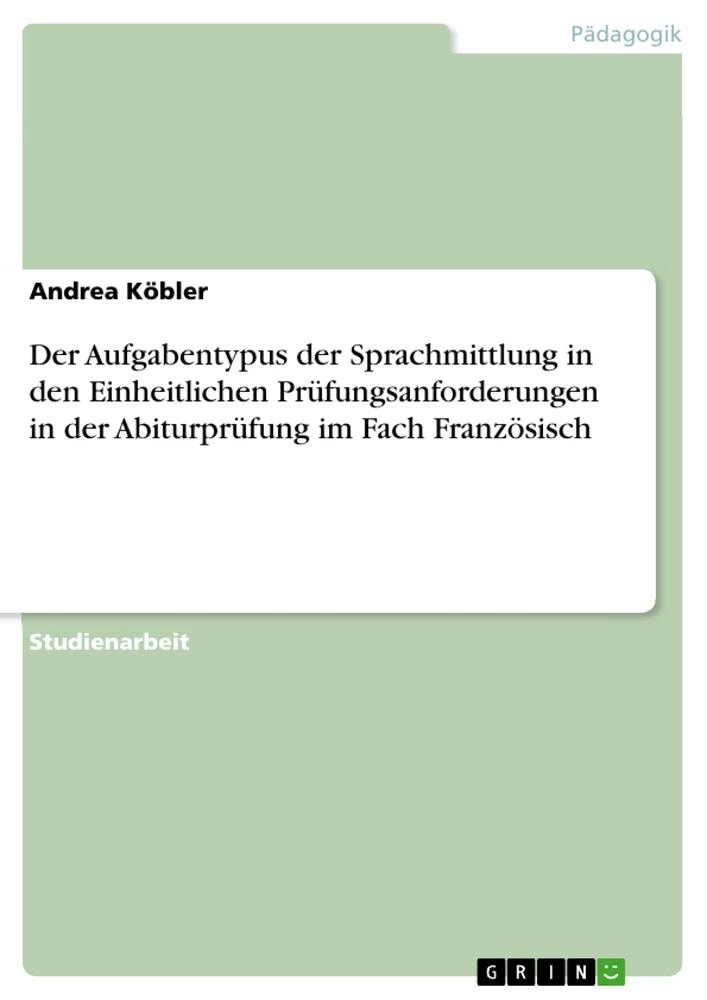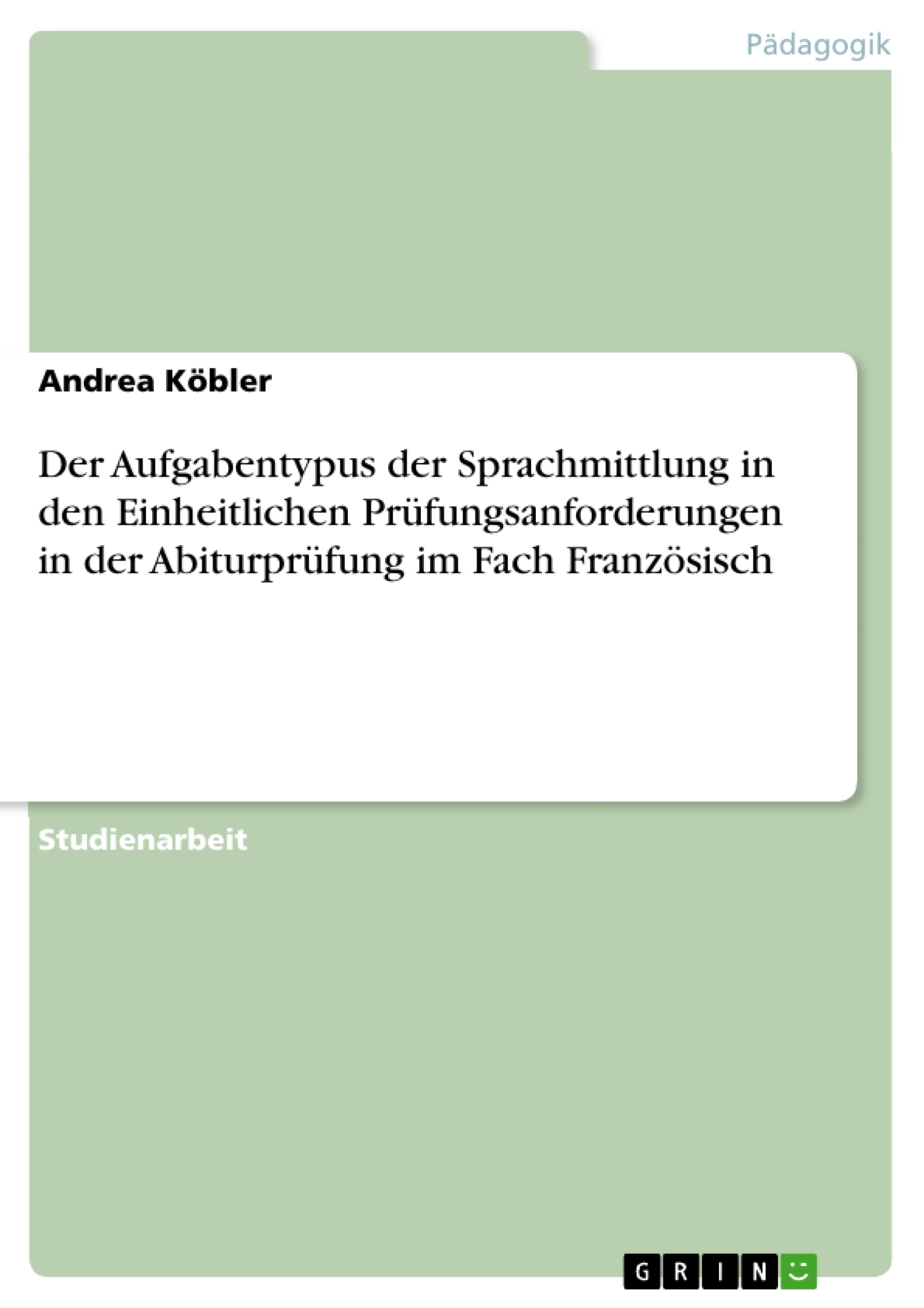Die Allgemeine Hochschulreife ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einem Studium an der Hochschule oder zu einer Berufsausbildung. Deswegen sind die Ziele der gymnasialen Oberstufe, eine breite und vertiefte Allgemeinbildung zu erhalten, wichtige inhaltliche und methodische Voraussetzungen für die allgemeine Studierfähigkeit zu erwerben, das selbstständige Lernen und die wissenschaftspropädeutische Grundbildung sowie die Schwerpunktbereiche zu stärken. Laut KMK gehört zur Grundstruktur der gymnasialen Oberstufe die Gliederung in eine einjährige Einführungsphase und eine zweijährige Qualifikationsphase, weiterhin die Zuordnung der Fächer zu drei Aufgabenfeldern, die Unterscheidung der Fächer nach Pflicht- und Wahlfächern, die Möglichkeit einer individuellen Schwerpunktsetzung und die Erteilung des Unterrichts auf unterschiedlichen Anspruchsebenen. Damit wird den in den „Einheitlichen Prüfungsanordnungen für die Abiturprüfung“ beschriebenen Anspruchsniveaus entsprochen. (KMK: fortan EPA 2004: 4f) Im Folgenden soll zunächst geklärt werden, was Sprachmittlung überhaupt ist und welchen Stellenwert sie im GER und in den Bildungsstandards einnimmt. Daraufhin werden die EPA für das Fach Französisch inhaltlich vorgestellt. Die einzelnen Bereiche werden näher erläutert und mit Beispielen veranschaulicht. Ein besonderes Augenmerk soll auf den Aufgabentyp der kombinierten Aufgabe gelegt werden. Dabei wird die Sprachmittlung als besonderes Ziel des fremdsprachlichen Unterrichts hervorgehoben. Die Aktivität der Sprachmittlung hat in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren. Das liegt vor allem daran, dass sie im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER), in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen im Abitur für moderne Fremdsprachen und infolgedessen natürlich auch in den aktuellen curricuralen Vorgaben für modernen Fremdsprachenunterricht aller Bundesländer einen festen Platz einnimmt.
Im Folgenden werde ich mich auf die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung im Fach Französisch und auf den GER beziehen. Für die Bedeutung von Sprachmittlung werde ich mich vor allem auf Rössler, Freundestein und Roche stützen.
Gliederung
1. Hinführung
2. Sprachmittlung
2.1 Was bedeutet Sprachmittlung?
2.2 Sprachmittlung im GER
2.3 Sprachmittlung in den Bildungsstandards
3. Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung im Fach Französisch
3.1 Grundlagen und Zielsetzungen
3.2 Festlegungen für die Gestaltung der Abiturprüfung
3.2.1 Fachliche Qualifikationen und Inhalte
3.2.2 Anforderungsbereiche in der Abiturprüfung
4. Aufgaben zur Sprachmittlung in den EPAs im Fach Französisch
4.1 Aufgaben zur Sprachmittlung in der schriftlichen Abiturprüfung
4.2 Aufgaben zur Sprachmittlung in der mündlichen Abiturprüfung
4.3 Analyse einer kombinierten Aufgabe in der Abiturprüfung
5. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Sprachmittlung (Médiation)?
Sprachmittlung ist die adressatengerechte Übertragung von Inhalten von einer Sprache in eine andere, wobei es nicht um wortwörtliche Übersetzung, sondern um die Vermittlung der Botschaft geht.
Welche Bedeutung hat Sprachmittlung im Abitur Fach Französisch?
Sie ist ein fester Bestandteil der Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) und wird sowohl in schriftlichen als auch in mündlichen Prüfungen abgefragt.
Was ist eine „kombinierte Aufgabe“ in der Abiturprüfung?
Dabei werden verschiedene Kompetenzen verknüpft, beispielsweise das Hörverstehen oder Leseverstehen mit einer anschließenden Sprachmittlungsaufgabe.
Wie wird Sprachmittlung im GER eingeordnet?
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER) sieht Sprachmittlung als zentrale kommunikative Kompetenz, die neben Rezeption, Produktion und Interaktion steht.
Welche fachlichen Qualifikationen werden in den EPA Französisch gefordert?
Schüler müssen in der Lage sein, komplexe Texte zu verstehen, kulturelle Kontexte zu berücksichtigen und Informationen situationsangemessen in die Zielsprache zu übertragen.
- Quote paper
- Andrea Köbler (Author), 2010, Der Aufgabentypus der Sprachmittlung in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung im Fach Französisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179430