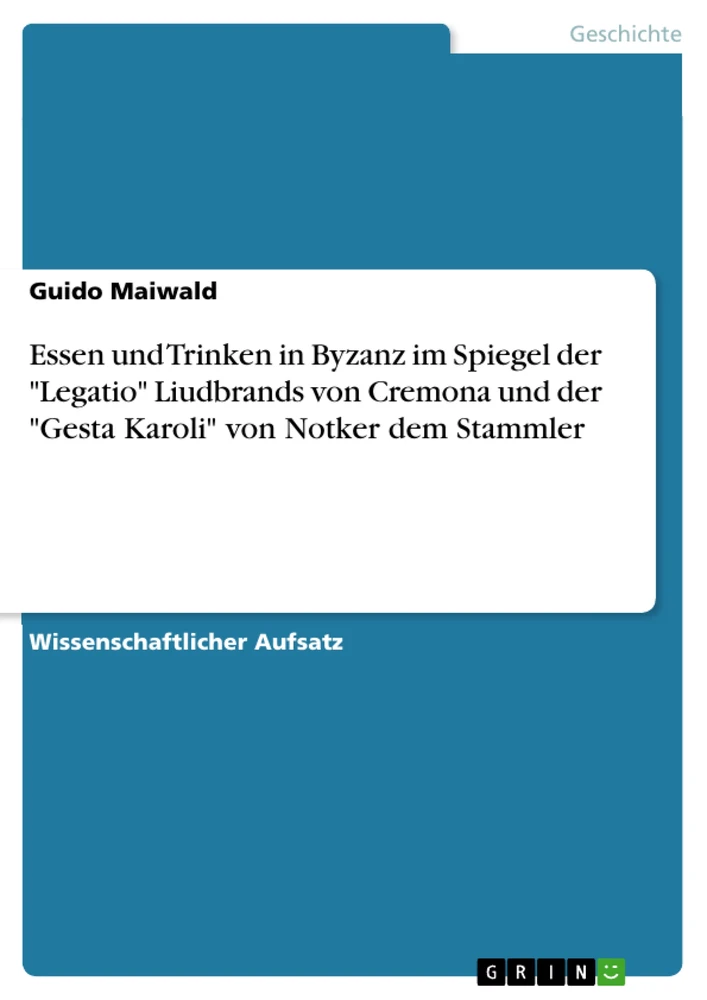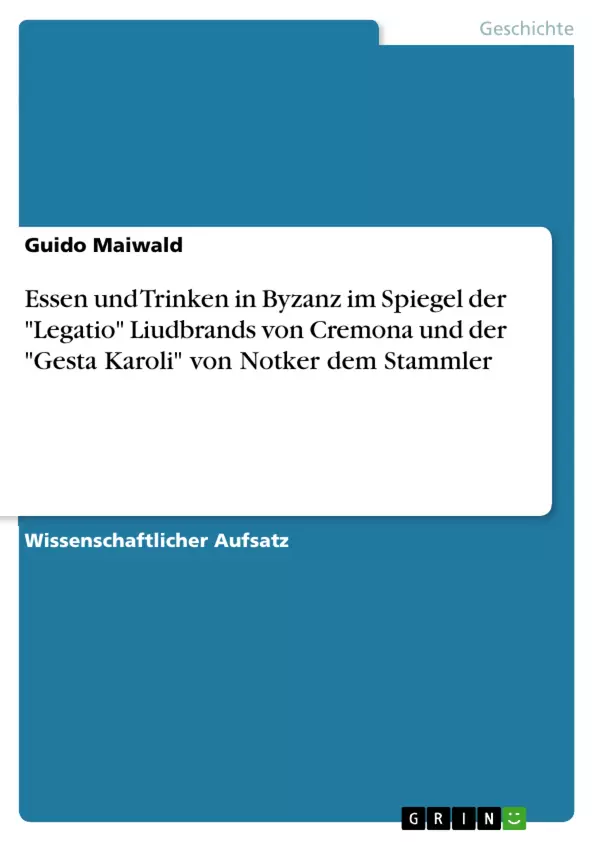In dieser Arbeit sollen zwei mittelalterliche Quellen kritisch untersucht werden die sich unter anderem mit der politischen Beziehung zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich beschäftigen. Näher untersucht werden soll dabei das Thema Ernährung. Während Notker Balbulus, dessen Werk um das Jahr 887 entstand, seine Quellen aus mündlicher Überlieferung schöpfte, reiste Liutprand von Cremona, der seine Schrift um 968 verfasste, selbst zum zweiten Mal im Auftrag Ottos II nach Byzanz. So ist es wenig verwunderlich, dass während Notkar gezielt literarische Heldentopoi verwendete und diese auf Karl den Großen übertrug, Liutprand eigene Erfahrungen verarbeitete. Als historische Werke in der Tradition Einhards können jedoch beide nicht bestehen, aus welchen Gründen soll unter anderem in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Neben dem historischen Gehalt der Quellen sollen die realpolitischen Umstände und die Motivation der Verfasser einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Die Arbeit ist nach Verfassern in zwei Teile gegliedert, die jeweils mit einem kurzen Werdegang und der Schilderung der politischen Umstände beginnen und mit der den in beiden Schriften enthaltenen Abhandlungen über die Speisegewohnheiten des byzantinischen Hofes schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Notker Balbulus (840-912)
- 1.2 Struktur und Ziel der Gesta Karoli
- 1.3 Die Geschichte vom gewendeten Fisch
- 2.1 Der Werdegang Liutprands von Cremona
- 2.2 Auftrag und Ausgestaltung der Legatio Constantinopolitana
- 2.3 Essen und Trinken als Spiegel der Kultur in der ,,Legatio"
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert zwei mittelalterliche Quellen, die sich mit dem politischen Verhältnis zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich beschäftigen. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema Ernährung. Die Arbeit untersucht, wie Notker Balbulus und Liutprand von Cremona, beide Autoren aus dem Mittelalter, dieses Thema in ihren Schriften behandeln.
- Die politische Beziehung zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich im Mittelalter
- Die Rolle von Ernährung als kulturelles und politisches Symbol
- Die Darstellung des byzantinischen Hofes in den Quellen
- Die Unterschiede in der Herangehensweise an die Geschichte durch Notker Balbulus und Liutprand von Cremona
- Die historische Bedeutung der beiden Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit werden Notker Balbulus und sein Werk, die Gesta Karoli, beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Struktur des Werkes und den von Notker verwendeten historischen Quellen. Des Weiteren wird auf die Darstellung des byzantinischen Hofes im Kontext der Geschichte vom gewendeten Fisch eingegangen.
Im zweiten Teil der Arbeit wird Liutprand von Cremona und seine Legatio Constantinopolitana betrachtet. Dabei wird auf Liutprands Werdegang und seinen Auftrag zur Reise nach Byzanz eingegangen. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung von Essen und Trinken als kulturelles und politisches Symbol im Kontext der byzantinischen Kultur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Byzanz, mittelalterliche Geschichte, politische Beziehungen, Ernährungskultur, Hofzeremonien, literarische Quellen, historische Quellen, Notker Balbulus, Gesta Karoli, Liutprand von Cremona, Legatio Constantinopolitana.
Häufig gestellte Fragen
Welche mittelalterlichen Quellen werden in dieser Arbeit verglichen?
Untersucht werden die „Legatio“ von Liutprand von Cremona (ca. 968) und die „Gesta Karoli“ von Notker dem Stammler (ca. 887).
Warum ist das Thema Ernährung in diesen historischen Texten so wichtig?
Ernährung und Speisegewohnheiten dienen in diesen Quellen als Spiegel der Kultur und als Symbole für die politische Beziehung zwischen dem Ost- und dem Weströmischen Reich.
Wie unterscheiden sich die Ansätze von Notker Balbulus und Liutprand von Cremona?
Notker stützte sich auf mündliche Überlieferungen und literarische Heldentopoi, während Liutprand als Gesandter eigene, oft kritische Erfahrungen am byzantinischen Hof verarbeitete.
Was beschreibt die „Geschichte vom gewendeten Fisch“?
Dies ist eine Episode aus Notkers Werk, die exemplarisch zur Darstellung des byzantinischen Hofes und dessen Sitten im Vergleich zum Frankenreich genutzt wird.
Welchen historischen Gehalt haben diese Werke?
Die Arbeit zeigt auf, dass beide Werke weniger als objektive Chroniken, sondern eher als Zeugnisse realpolitischer Umstände und persönlicher Motivationen ihrer Verfasser zu verstehen sind.
- Quote paper
- MA Guido Maiwald (Author), 2004, Essen und Trinken in Byzanz im Spiegel der "Legatio" Liudbrands von Cremona und der "Gesta Karoli" von Notker dem Stammler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179441