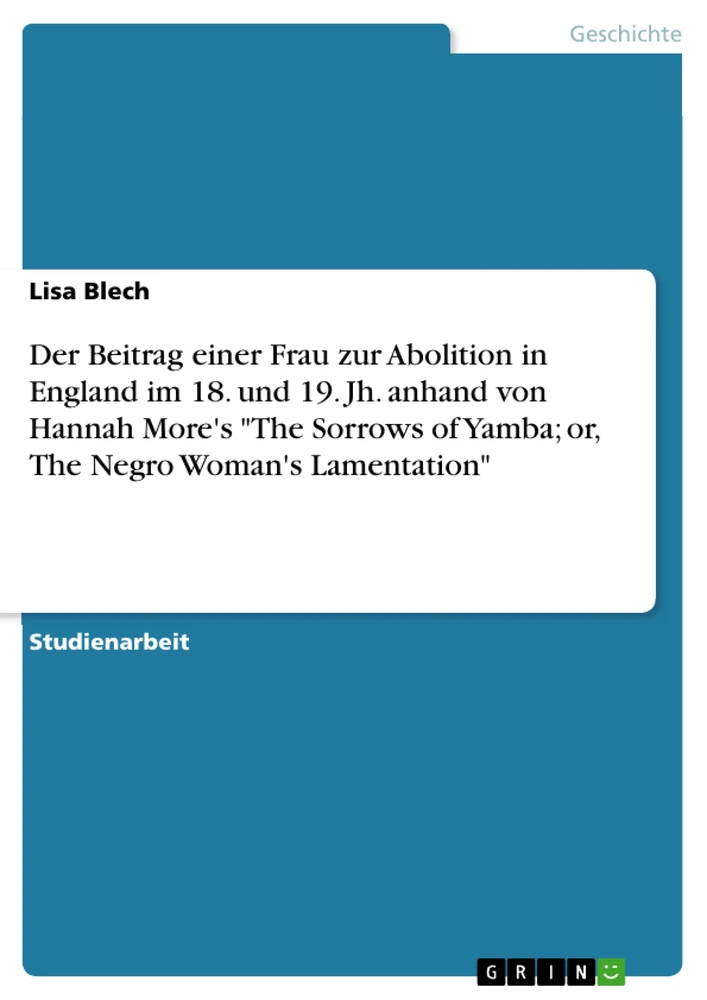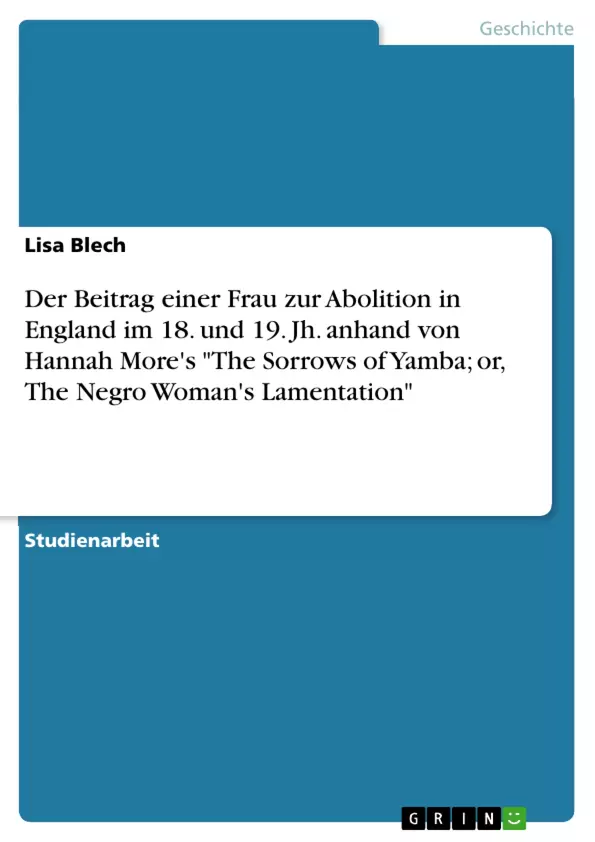„Slavery is the reverse of liberty.“ - George Ramsay
Die Sklaverei besteht seit unzähligen Zeiten in verschiedensten Formen. Sie hat sich morphologisch geändert, doch ist die Unterdrückung von Menschen bis zur heutigen Zeit in vielen Formen, so auch als Sklaverei durch vertragliche Bindung, erhalten geblieben. Im 18. und 19. Jahrhundert aber wurden in Großbritannien Siege gegen den Sklavenhandel und die Sklaverei durch die abolitionistische Bewegung errungen.
Der Zweck dieser Hausarbeit liegt darin zu untersuchen, welchen Beitrag die Frauen zu dieser Abolition geleistet haben. Dieser Aspekt ist besonders interessant zu beleuchten, da die Frauen damals eine niedrigere Stellung in der Gesellschaft als Männer und somit historisch wenig bekannte Rollen einnahmen. Somit gilt für mich zu erforschen, welchen geschichtlichen Beitrag eine von ihnen geleistet hat. Dies werde ich anhand von Hannah More und ihrem Werk "The Sorrows of Yamba; or, The Negro Woman's Lamentation" darlegen.
Dabei werde ich zuerst auf die abolitionistische Bewegung in England zu dieser Zeit eingehen, sowie auf deren Mitglieder. Ein besonderes Augenmerk werde ich dabei auf die Person Hannah More haben. Daraufhin setze ich mich in dieser Hausarbeit mit dem zu untersuchenden Text und dem dazugehörigen Zeitgeschehen am Ende des 18. Jahrhunderts auseinander. Im Folgenden werde ich schließlich reflektierend auf meine Fragestellung bezüglich des Beitrags der Frauen zur Abolition, besonders der Bedeutung des gewählten Textes von Hannah More, eingehen. Mit diesen Betrachtungen werde ich diese Arbeit abschließen.
- Arbeit zitieren
- Lisa Blech (Autor:in), 2011, Der Beitrag einer Frau zur Abolition in England im 18. und 19. Jh. anhand von Hannah More's "The Sorrows of Yamba; or, The Negro Woman's Lamentation", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179483