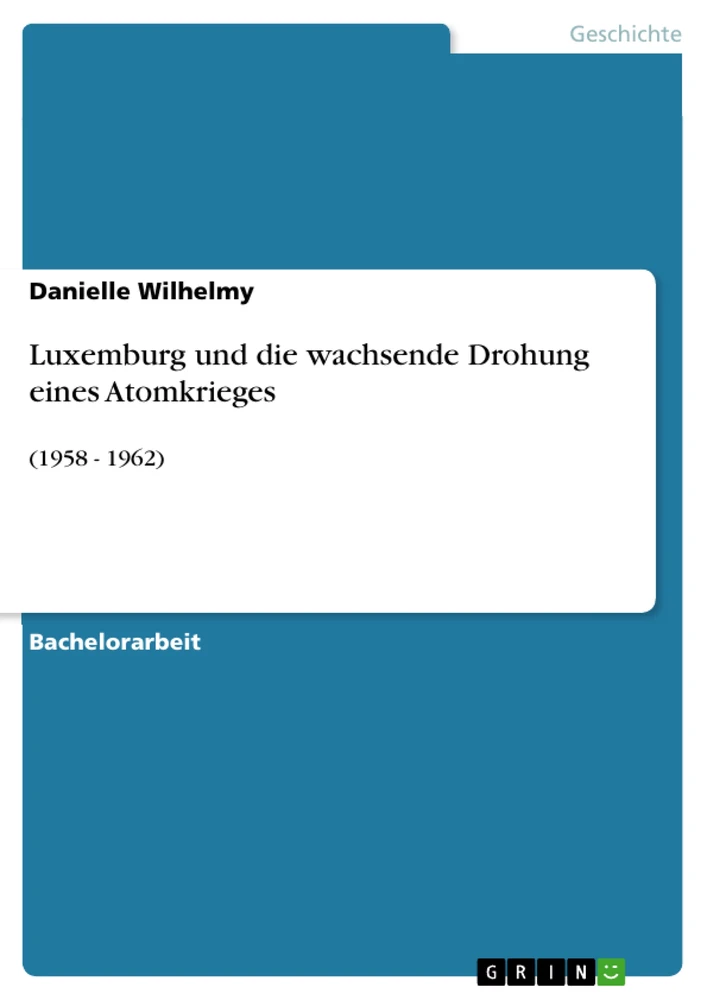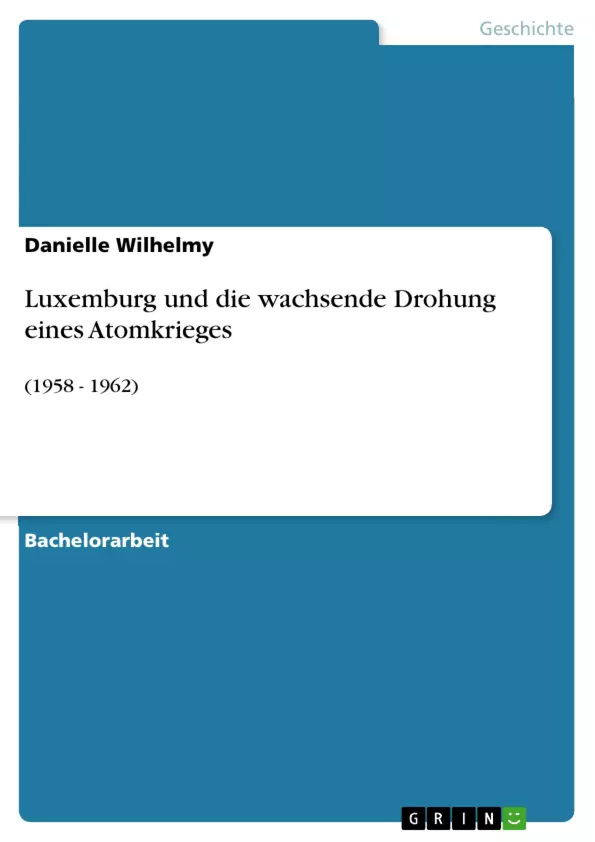4. Oktober 1957: die westliche Welt steht unter Schock. An diesem Tag ist es der Sowjetunion gelungen, den ersten künstlichen Satelliten mit Hilfe einer Interkontinentalrakete in die Erdumlaufbahn zu schießen. Es wird klar, dass die U.d.S.S.R. den U.S.A. ebenbürtig, wenn nicht sogar technisch überlegen ist. Nicht nur der Fakt, dass Moskau nun über funktionelle Interkontinentalraketen verfügt, die jeden Punkt des Territoriums der Vereinigten Staaten binnen einer halben Stunde erreichen könnten, versetzt den Westen in einen Schockzustand, sondern vielmehr die Tatsache, dass nun beide antagonistischen Lager des Kalten Krieges über die nötigen Mittel verfügen, um den jeweiligen Gegner mit einem Atomangriff zu Nichte zu machen. Einzige Abschreckung vor dem Einsatz der Kernwaffen ist die Gewissheit, dass im Falle eines derartigen Angriffs der Gegner noch vernichtend zurückschlagen kann. Das „Gleichgewicht des Schreckens“ ist geschaffen.
In dieser „heißen Phase“ des Kalten Krieges wird auch Luxemburg sich gezwungen sehen, seine Position in den internationalen Beziehungen zu bestimmen und Schutzmaßnahmen für das eigene Land vorzusehen. Bis dato hat es noch nicht im internationalen Reigen der atomaren Aufrüstung mitgetanzt. Im Gegenteil, seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 ist es nicht nur Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, sondern auch der EURATOM, der Europäischen Atomgemeinschaft. Ihr Ziel ist es, „zur Bildung und Entwicklung von Kernindustrien in Europa beizutragen, dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten von der Entwicklung der Atomenergie profitieren, und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig garantiert der Vertrag der Bevölkerung ein hohes Maß an technischer Sicherheit und verhindert eine Abzweigung von für zivile Zwecke bestimmtem Kernmaterial für andere, insbesondere militärische Zwecke. Zu beachten ist, dass EURATOM nur im Bereich der zivilen und friedlichen Nutzung der Kernenergie zuständig ist.“
Wie reagiert das Großherzogtum nun auf das immer wieder durch Krisenherde aufkeimende atomare Wettrüsten? Welche Ängste und Hoffnungen offenbaren sich? Wie positioniert sich der Kleinstaat selbst zu der Atom-Debatte und warum nimmt es diese jeweilige Stellungnahme an?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. 1958-1960: Die Wurzeln der luxemburgischen Anteilnahme an der Atom-Debatte
- 1. „Koexistenzphrasen und wüste Drohungen“: Empörung in Luxemburg über den Wandel der sowjetischen Politik
- 2. Ja zu Nuklearexperimenten in der Sahara - Einheitspolitik der Benelux?
- 3. Luxemburg stärkt seine Position in den internationalen Beziehungen
- II. Zwischen An- und Entspannung: Luxemburg bleibt seinem Kurs treu
- 1. Angst vor Westdeutschland? - Luxemburg unterstützt Frankreichs Atompolitik
- 2. Angst vor Chruschtschow? - Luxemburg während der Zeit zwischen dem U2-Vorfall und dem Ost-West Gipfeltreffen in Paris
- 3. Die Hoffnung Kennedy - und doch: Luxemburg will NATO weiter stärken
- III. 1961-1962: Richtungswechsel Luxemburgs in der Atom-Debatte
- 1. Wachsender Missmut gegen Kernwaffentests im Großherzogtum
- 2. November 1961: Die luxemburgischen Abstimmungen in der UNO-Vollversammlung
- 3. Luxemburgs Stellung gegenüber Kernwaffen kurz vor und nach der Kuba-Krise: Ein Wandel?
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die luxemburgische Reaktion auf die Atom-Debatte im Kontext des Kalten Krieges zwischen 1958 und 1962. Sie beleuchtet die Entwicklung der luxemburgischen Positionierung in Bezug auf die Atomwaffentests und die damit verbundenen internationalen Spannungen.
- Die Wurzeln der luxemburgischen Anteilnahme an der Atom-Debatte
- Luxemburgs Positionierung gegenüber den Atomwaffentests in den Jahren 1958-1960
- Luxemburgs Stellungnahme zur Atom-Debatte im Krisenjahr 1960
- Die Entwicklung des luxemburgischen Meinungswandels in der Atom-Debatte zwischen 1961 und 1962
- Luxemburgs Umgang mit den internationalen Spannungen im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Atomwaffentests im Kalten Krieg ein und erläutert den historischen Kontext der Untersuchung. Das erste Kapitel beleuchtet die Ursprünge der luxemburgischen Anteilnahme an der Atom-Debatte. Es analysiert die Reaktionen in Luxemburg auf die sowjetische Politik der «friedlichen Koexistenz» und die damit verbundenen Spannungen. Das zweite Kapitel untersucht die Positionierung Luxemburgs im Jahr 1960 in Bezug auf die Atomwaffentests und die damit verbundenen internationalen Krisen. Das dritte Kapitel schließlich beleuchtet die Entwicklung des luxemburgischen Meinungswandels in der Atom-Debatte zwischen 1961 und 1962.
Schlüsselwörter
Atomwaffentests, Kalter Krieg, Luxemburg, internationale Beziehungen, Nuklearpolitik, Nuklearexperimente, «friedliche Koexistenz», UNO-Vollversammlung, Kuba-Krise, EURATOM, NATO, Kleinstaat, internationale Spannungen, historische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte Luxemburg auf den Start von Sputnik 1 im Jahr 1957?
Der Start versetzte den Westen und Luxemburg in Schock, da er die technische Ebenbürtigkeit der UdSSR und die Gefahr eines Atomangriffs verdeutlichte.
Welche Rolle spielt die EURATOM für Luxemburg?
Luxemburg trat der EURATOM bei, um von der zivilen Nutzung der Atomenergie zu profitieren und gleichzeitig technische Sicherheit zu gewährleisten.
Gab es einen Wandel in der luxemburgischen Haltung zu Kernwaffentests?
Ja, zwischen 1961 und 1962 entwickelte sich im Großherzogtum ein wachsender Missmut gegen Kernwaffentests.
Wie positionierte sich Luxemburg gegenüber Frankreichs Atompolitik?
Luxemburg unterstützte zeitweise Frankreichs Atompolitik, unter anderem aus Sorge vor Entwicklungen in Westdeutschland.
Was ist das "Gleichgewicht des Schreckens"?
Es beschreibt die Situation im Kalten Krieg, in der die gegenseitige nukleare Vernichtungskapazität als Abschreckung diente.
- Citar trabajo
- Danielle Wilhelmy (Autor), 2010, Luxemburg und die wachsende Drohung eines Atomkrieges , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179485