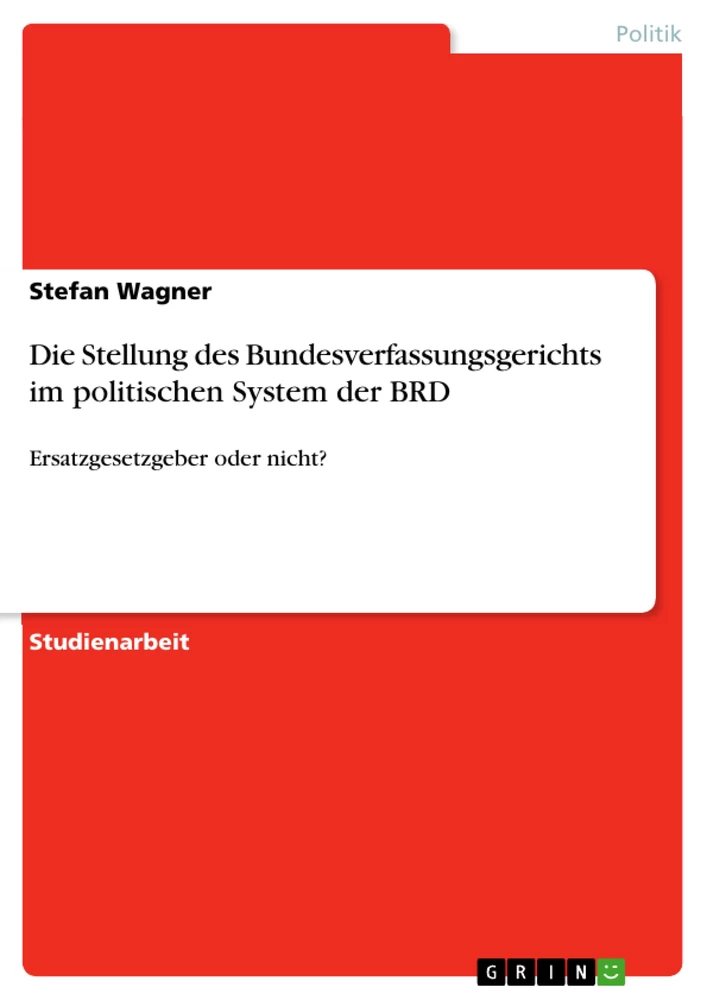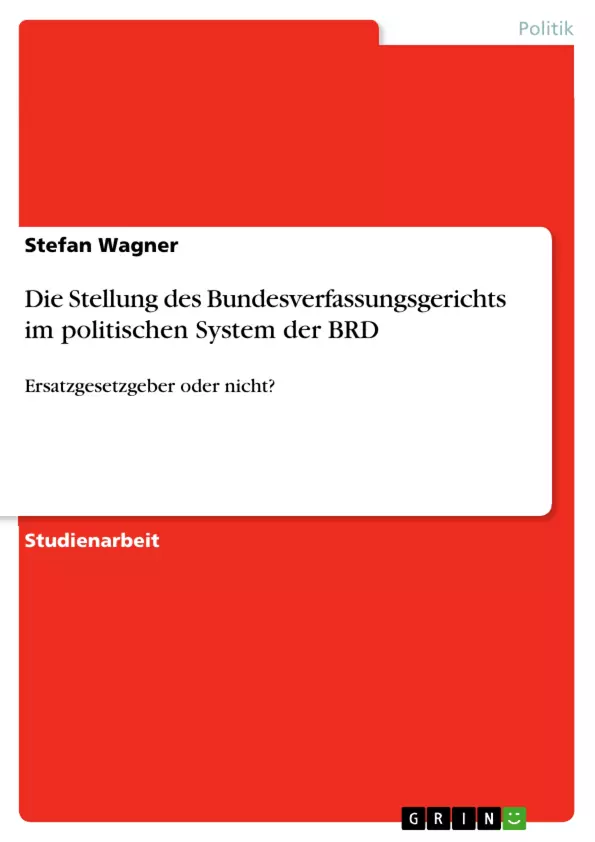Das Bundesverfassungsgericht ist die höchstrangige Institution der rechtsprechenden Gewalt der Bundesrepublik
Deutschland. Es ist der sogenannte Hüter der Verfassung – also des Grundgesetzes – und kontrolliert die
Verfassungsmäßigkeit des politischen Lebens. Dabei gehört es nicht dem Instanzenzug an, was bedeutet, dass es
keine vollständige Rechtsprüfung ausübt, sondern es überprüft Entscheidungen anderer Gerichte und sonstige
Anträge als Akte der Staatsgewalt am Maßstab des Verfassungsrechts. Das Grundgesetz stellt also die oberste
Richtschnur dar, anhand derer sämtliches staatliches Handeln interpretiert und gemessen wird. Das Parlament,
die Regierung und auch die übrige Rechtsprechung sind in ihrem Handeln an die Verfassung gebunden und das
Bundesverfassungsgericht überwacht diese Verfassungsmäßigkeit. Da die Artikel des Grundgesetzes – wie es für
Verfassungen typisch ist – nur allgemein und grundsätzlich formulierte Regelungen enthalten, ist das
Verfassungsgericht dazu angehalten, diese Regelungen im Sinne der bestehenden politischen
Rahmenbedingungen zu interpretieren und mit Leben zu füllen sowie diesen Interpretationen
Rechtsverbindlichkeit zu verleihen. Dabei wird die Verfassung und die Verfassungsrechtsprechung ständig
fortentwickelt und dem gesellschaftlichen Wandel angepasst. „Das Grundgesetz gilt so, wie das
Bundesverfassungsgericht es auslegt.“
(...)
Die Arbeit soll sich deshalb dem Thema der besonderen Stellung des Bundesverfassungsgericht im
Gesamtgefüge der deutschen Staatsorgane widmen sowie identifizierbare Probleme nennen, und untersuchen,
worauf diese Stellung gegründet ist, welches Verhältnis der Organe untereinander dadurch entsteht und wie
insgesamt mit der Gefahr eines Ersatzgesetzgeber „Bundesverfassungsgericht“ umgegangen werden kann und
wird.
Inhaltsverzeichnis
I Deckblatt
II Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Entstehung des Bundesverfassungsgerichts
3 Der organisatorische Aufbau des Bundesverfassungsgerichts
3.1 Die Wahl der Richter des Bundesverfassungsgericht
3.2 Die Kritik der Richterwahl
4 Die Aufgabenbereiche des Bundesverfassungsgerichts
5 Die besondere Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen 9 System der BRD - Gericht und Verfassungsorgan
5.1 Die Letztinterpretation der Verfassung
5.2 Die Bindungswirkung der Urteile
5.3 Das Verhältnis zum Gesetzgeber
5.3.1 Das Bundesverfassungsgericht im Spannungsverhältnis 12 von Recht und Politik
5.3.2 Die Problematik des Ersatzgesetzgebers
6 Diskussion der besonderen Stellung des Bundesverfassungsgerichts
6.1 Das Verhältnis zum Gesetzgeber
6.2 Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit
7 Fazit
III Anmerkungen und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das Bundesverfassungsgericht als "Hüter der Verfassung" bezeichnet?
Weil es die Aufgabe hat, sämtliches staatliches Handeln am Maßstab des Grundgesetzes zu messen und dessen Einhaltung durch alle Staatsorgane zu überwachen.
Wie werden die Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt?
Die Richter werden jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, was oft wegen der politischen Einflussnahme kritisiert wird.
Was bedeutet die "Bindungswirkung" der Urteile?
Die Entscheidungen des Gerichts binden alle Verfassungsorgane sowie alle Gerichte und Behörden des Bundes und der Länder; sie haben oft Gesetzeskraft.
Was versteht man unter der Problematik des "Ersatzgesetzgebers"?
Es ist die Kritik, dass das Gericht durch seine weitreichenden Interpretationen faktisch Politik gestaltet und damit Aufgaben übernimmt, die eigentlich dem demokratisch gewählten Parlament zustehen.
Gehört das Bundesverfassungsgericht zum normalen Instanzenzug?
Nein, es ist kein "Super-Revisionsgericht". Es prüft Urteile anderer Gerichte nur auf die Verletzung von spezifischem Verfassungsrecht, nicht auf einfache Rechtsfehler.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Stefan Wagner (Autor:in), 2011, Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System der BRD, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179542