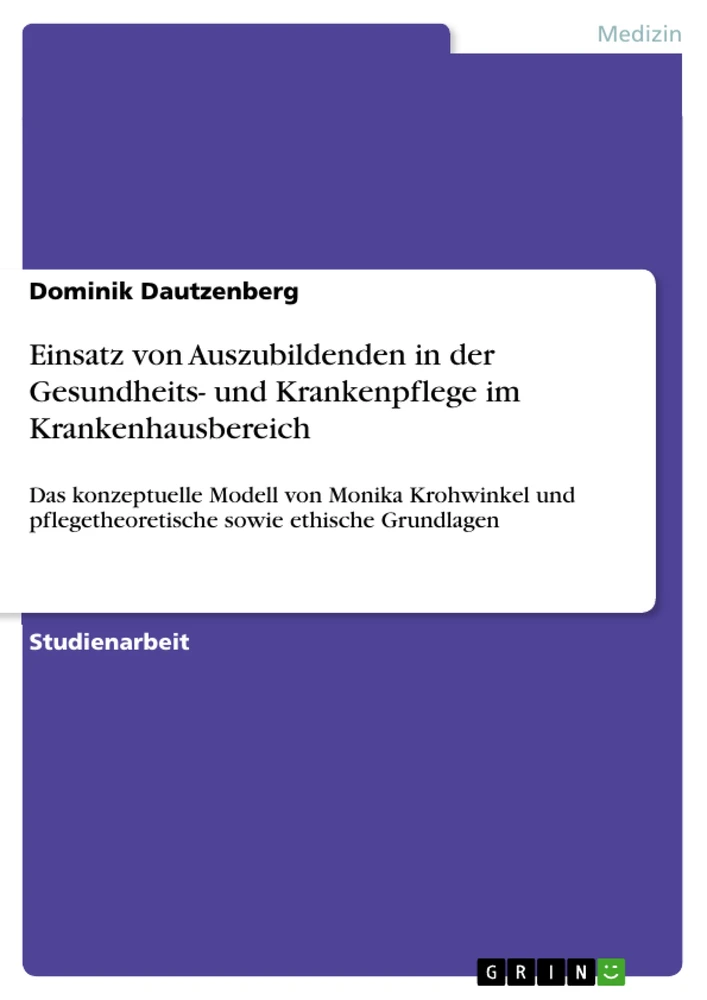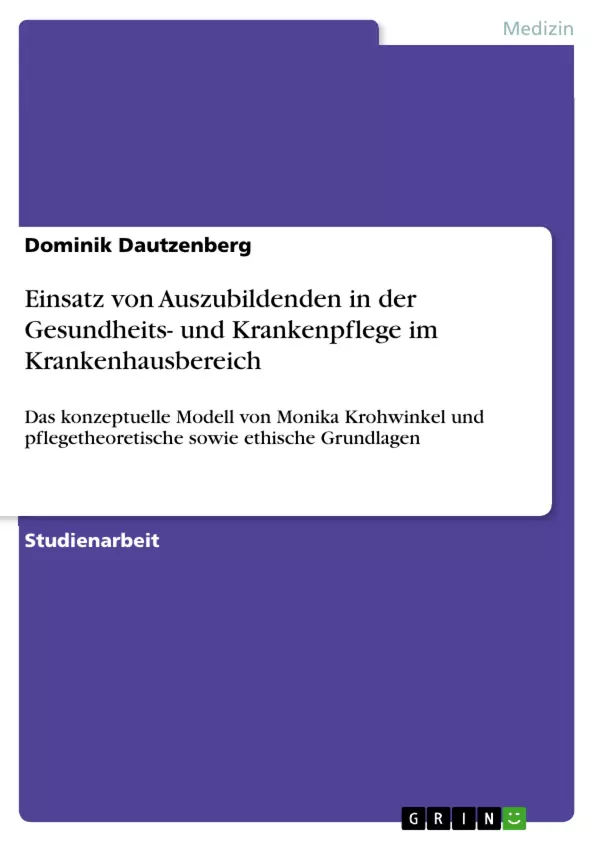Das Thema „Ausbildung“, findet sich genau wie das Thema „Pflege“ in ständiger Entwicklung. Mit dem 2003 geänderten Gesetz kam es zu einer Reform, die in Deutschland zwar längst überfällig war, die Krankenpflegeschulen aber dennoch vor große inhaltliche und strukturelle Veränderungen stellte.
In dieser Arbeit ist es gelungen, die vielen gemeinsamen Anforderungen an die Pflegepersonen in Deutschland in direkten Zusammenhang mit dem konzeptionellen Modell von Frau Krohwinkel zu stellen, und gleichzeitig die Inhalte des Modells für die praktische Ausbildung nutzbar darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das konzeptuelle Modell von Monika Krohwinkel
- Biografie und Entwicklung des konzeptuellen Modells
- Kernaussagen des konzeptuellen Modells
- Fördernde Prozesspflege als System
- Das AEDL/ABEDL Strukturmodell
- Das Pflegeprozessmodell
- Das Managementmodell
- Das Modell zum reflektierten Erfahrungslernen
- Das konzeptuelle Modell von M. Krohwinkel in Verbindung zur Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in
- „Das AEDL Strukturenmodell“ im Zusammenhang mit kompetenzorientiertem Lernen in der praktischen Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in
- ,,Das Pflegeprozessmodell“ und der Regelkreislauf der praktischen Ausbildung
- Krohwinkels Modell zum „Reflektierten Erfahrungslernen“ in der praktischen Anwendung
- Das Managementmodell zur Strukturierung eines Stationseinsatzes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen von Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege auf einer Station im Krankenhausbereich. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Anwendung des konzeptuellen Modells von Monika Krohwinkel zur „Fördernden Prozesspflege“ im Kontext der praktischen Ausbildung.
- Das konzeptuelle Modell von Monika Krohwinkel zur „Fördernden Prozesspflege“
- Die Anwendung des Modells in der praktischen Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in
- Die Bedeutung von Kompetenzorientierung und reflektiertem Erfahrungslernen in der Ausbildung
- Die Rolle des Managementmodells für die Strukturierung von Stationseinsätzen
- Die Förderung der Fähigkeiten und Ressourcen von Auszubildenden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Motivation des Autors, das konzeptuelle Modell von Monika Krohwinkel in den Kontext der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in zu untersuchen. Das zweite Kapitel präsentiert das konzeptuelle Modell von Monika Krohwinkel und beleuchtet dessen Entwicklung, Kernaussagen und die zugrundeliegende ganzheitliche Sicht des Menschen und seiner Umgebung. Das dritte Kapitel widmet sich dem System der „Fördernden Prozesspflege“ und analysiert die vier Teilmodelle: AEDL/ABEDL Strukturmodell, Pflegeprozessmodell, Managementmodell und Modell zum reflektierten Erfahrungslernen. Das vierte Kapitel untersucht die Anwendung von Krohwinkels Modell in der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in, wobei der Fokus auf den einzelnen Teilmodellen und deren Rolle im Kontext der praktischen Ausbildung liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der „Fördernden Prozesspflege“ nach Monika Krohwinkel, der praktischen Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Kompetenzorientierung, reflektiertem Erfahrungslernen, AEDL/ABEDL Strukturmodell, Pflegeprozessmodell, Managementmodell, Stationseinsätze und Ressourcenförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Modell der 'Fördernden Prozesspflege'?
Es ist ein von Monika Krohwinkel entwickeltes ganzheitliches Pflegemodell, das die Fähigkeiten und Ressourcen des Patienten sowie seine Unabhängigkeit in den Mittelpunkt stellt.
Was bedeuten die Kürzel AEDL und ABEDL?
Sie stehen für 'Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des Lebens', ein Strukturmodell zur Erfassung des Pflegebedarfs und der Ressourcen eines Menschen.
Wie hilft Krohwinkels Modell Auszubildenden in der Pflege?
Es bietet einen strukturierten Rahmen für kompetenzorientiertes Lernen und hilft dabei, Theorie und Praxis durch reflektiertes Erfahrungslernen zu verknüpfen.
Welche Rolle spielt das Managementmodell in der Ausbildung?
Das Managementmodell dient dazu, den Stationseinsatz von Auszubildenden zu strukturieren und Verantwortlichkeiten klar zu definieren.
Warum ist reflektiertes Erfahrungslernen wichtig?
Es ermöglicht Schülern, praktische Erlebnisse kritisch zu hinterfragen und ihr Handeln auf Basis pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern.
- Citar trabajo
- Dominik Dautzenberg (Autor), 2011, Einsatz von Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege im Krankenhausbereich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179563