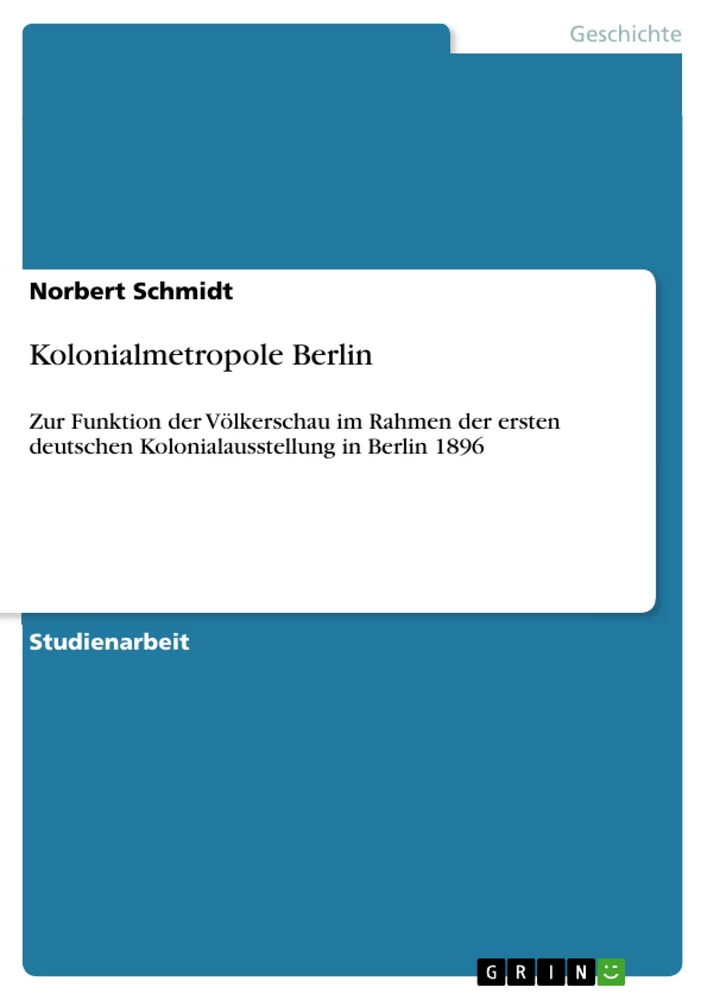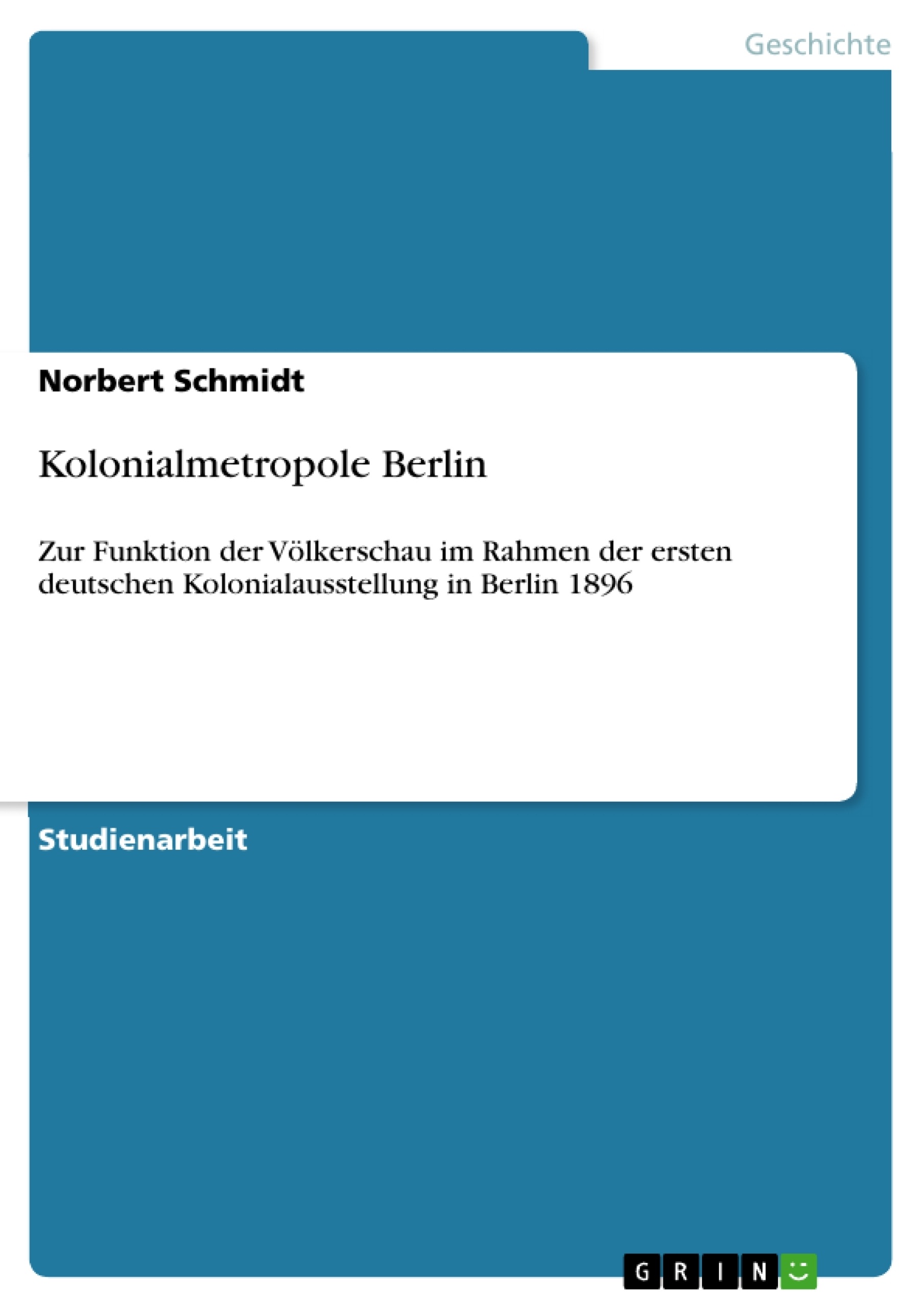Einleitung
Die erste deutsche Kolonialausstellung fand 1896 im Rahmen der Berliner Gewerbeausstellung, welche später auch als verhinderte Weltausstellung bezeichnet wurde, auf dem Gelände des heutigen Treptower Parks statt.
Wie es im Amtlichen Bericht heißt, „...mußte der Versuch, dem deutschen Volke das Kolonialwesen in seinen mannigfachen Verzweigungen vorzuführen, verdienstlich sein“.
Dies sollte u.a. durch eine sog. Völkerschau geschehen, zu der Einwohner aus den deutschen Kolonien angeworben worden waren.
Diese Arbeit strebt an, die Funktion der Völkerschau auf der ersten deutschen Kolonialausstellung im Hinblick auf die von den Organisatoren gesteckten Ziele zu untersuchen.
Dabei möchte ich zunächst den Charakter der Gewerbeausstellung klären mit der Intention, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum im Rahmen der Gewerbeausstellung eine Kolonialausstellung ihren Platz fand.
Im einem nächsten Schritt soll die Verankerung der Völkerschauen im öffentlichen Leben Deutschlands darstellt werden, um klären zu können, was die Veranstalter dazu bewegt haben könnte, eine Völkerschau in die Kolonialausstellung aufzunehmen. Im letzten Abschnitt soll die Funktion der Völkerschau im Rahmen der Kolonialausstellung hinsichtlich der durch die Organisatoren gesteckten Ziele anhand der bisher ermittelten Ergebnisse geprüft werden.
Neben dem 1897 herausgegebenen Amtlichen Bericht zur Kolonialausstellung als Quelle lag mir verschiedene neuere Literatur vor, die im einzelnen dem Literaturverzeichnis entnommen werden kann. Besonders hinweisen möchte ich jedoch bezüglich des ersten Abschnitts auf die Veröffentlichung des Bezirksamts Treptow von Berlin, bezüglich der zweiten Frage auf Hilke Thode-Arora und Andrew Zimmerman. Gemein ist vielen Texten, daß sie auf eine bisher unzureichende Erschließung der Quellen, bzw. schlichtweg auf ihr Nichtvorhandensein hinweisen. Dies gilt in besonderem Maße für den Bereich der Rezeption im weitesten Sinne kolonialer Veranstaltungen seitens des Publikums.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Keine Weltausstellung in Berlin - oder doch?
- 2. Warum eine Kolonialausstellung im Rahmen einer Gewerbeausstellung?
- 3. Zwischen Wissenschaft und Unterhaltung - die Völkerschauen
- 4. Warum eine Völkerschau im Rahmen der Kolonialausstellung?
- 5. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion der Völkerschau auf der ersten deutschen Kolonialausstellung 1896 in Berlin. Sie beleuchtet den Kontext der Ausstellung innerhalb der Berliner Gewerbeausstellung und analysiert die Gründe für die Einbindung einer Völkerschau. Die Arbeit klärt den Charakter der Gewerbeausstellung und die Rolle der Völkerschauen im öffentlichen Leben Deutschlands.
- Der Charakter der Berliner Gewerbeausstellung 1896 und ihre Entwicklung.
- Die Integration der Kolonialausstellung in die Gewerbeausstellung.
- Die Rolle und Funktion von Völkerschauen im öffentlichen Leben Deutschlands.
- Die Beweggründe der Veranstalter für die Aufnahme einer Völkerschau in die Kolonialausstellung.
- Die Funktion der Völkerschau im Kontext der Ziele der Organisatoren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit: die Untersuchung der Funktion der Völkerschau auf der ersten deutschen Kolonialausstellung 1896 in Berlin. Sie benennt die Quellen und die Forschungsfrage, die die Arbeit zu beantworten versucht. Die Autorin/der Autor skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Herausforderungen bei der Quellenerschließung, insbesondere in Bezug auf die Rezeption der Ausstellung durch das Publikum.
1. Keine Weltausstellung in Berlin - oder doch?: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Berliner Gewerbeausstellung 1896. Es beschreibt den Wunsch nach einer Weltausstellung in Deutschland und die verschiedenen Versuche, diese zu realisieren. Es analysiert die politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zum Scheitern der Pläne für eine Weltausstellung führten und schließlich zur Entscheidung für eine große Gewerbeausstellung führten. Das Kapitel zeigt auch die Rolle staatlicher Förderung und die Verbindung zwischen Kolonial- und Flottenpolitik.
2. Warum eine Kolonialausstellung im Rahmen einer Gewerbeausstellung?: Dieses Kapitel würde die Gründe für die Integration der Kolonialausstellung in die Gewerbeausstellung untersuchen. Es würde die herrschende koloniale Ideologie und deren Einfluss auf die politische Entscheidung analysieren, sowie die wirtschaftlichen und propagandistischen Aspekte beleuchten. Zusätzlich könnte es die Synergien und das Zusammenspiel beider Ausstellungen untersuchen.
3. Zwischen Wissenschaft und Unterhaltung - die Völkerschauen: Dieses Kapitel würde die Völkerschauen an sich analysieren. Es würde ihre Präsentation als wissenschaftliche und unterhaltende Attraktion untersuchen, sowie die anthropologischen Konzepte, die ihnen zugrunde lagen. Es würde die Art und Weise der Darstellung der kolonialisierten Völker und die damit verbundenen Machtstrukturen und Stereotypen analysieren.
4. Warum eine Völkerschau im Rahmen der Kolonialausstellung?: Dieses Kapitel würde die spezifischen Gründe für die Einbindung der Völkerschau in die Kolonialausstellung untersuchen. Es würde die Rolle der Völkerschau in der kolonialen Propaganda und der Präsentation des deutschen Kolonialreichs analysieren. Das Kapitel würde möglicherweise die Beziehung zwischen den dargestellten "Völkern" und den Zielen der Kolonialpolitik untersuchen.
Schlüsselwörter
Kolonialausstellung, Berlin 1896, Völkerschau, Gewerbeausstellung, Kolonialpolitik, Imperialismus, Anthropologie, Publicität, Propaganda, Reichseinigung, Wirtschaftsaufschwung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Kolonialausstellung Berlin 1896
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Funktion der Völkerschau auf der ersten deutschen Kolonialausstellung 1896 in Berlin. Sie analysiert den Kontext der Ausstellung innerhalb der Berliner Gewerbeausstellung und die Gründe für die Einbindung einer Völkerschau. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung des Charakters der Gewerbeausstellung und der Rolle der Völkerschauen im öffentlichen Leben Deutschlands.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Vorgeschichte der Berliner Gewerbeausstellung, die Integration der Kolonialausstellung in die Gewerbeausstellung, die Rolle und Funktion von Völkerschauen, die Beweggründe der Veranstalter für die Aufnahme einer Völkerschau und die Funktion der Völkerschau im Kontext der Ziele der Organisatoren. Sie analysiert die herrschende koloniale Ideologie, wirtschaftliche und propagandistische Aspekte, die Präsentation der Völkerschau als wissenschaftliche und unterhaltende Attraktion, die anthropologischen Konzepte und die damit verbundenen Machtstrukturen und Stereotypen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt das Thema und die Forschungsfrage. Kapitel 1 beleuchtet die Vorgeschichte der Berliner Gewerbeausstellung und den Weg zur Entscheidung für eine große Gewerbeausstellung statt einer Weltausstellung. Kapitel 2 untersucht die Gründe für die Integration der Kolonialausstellung in die Gewerbeausstellung. Kapitel 3 analysiert die Völkerschauen selbst, ihre Präsentation und die zugrundeliegenden anthropologischen Konzepte. Kapitel 4 untersucht die spezifischen Gründe für die Einbindung der Völkerschau in die Kolonialausstellung und deren Rolle in der kolonialen Propaganda. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit nennt zwar nicht explizit alle Quellen, aber die Einleitung erwähnt Herausforderungen bei der Quellenerschließung, insbesondere in Bezug auf die Rezeption der Ausstellung durch das Publikum. Die genaue Quellenlage ist im Text selbst detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kolonialausstellung, Berlin 1896, Völkerschau, Gewerbeausstellung, Kolonialpolitik, Imperialismus, Anthropologie, Publicität, Propaganda, Reichseinigung, Wirtschaftsaufschwung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Untersuchung der Funktion der Völkerschau auf der ersten deutschen Kolonialausstellung 1896 in Berlin im Kontext der Gesamtveranstaltung und der damaligen politischen und gesellschaftlichen Situation.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der Kolonialausstellung 1896 in Berlin und der Rolle von Völkerschauen in der kolonialen Propaganda und der Präsentation des deutschen Kolonialreichs. Sie analysiert kritisch die damaligen Machtstrukturen und Stereotypen.
- Quote paper
- Norbert Schmidt (Author), 2005, Kolonialmetropole Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179698