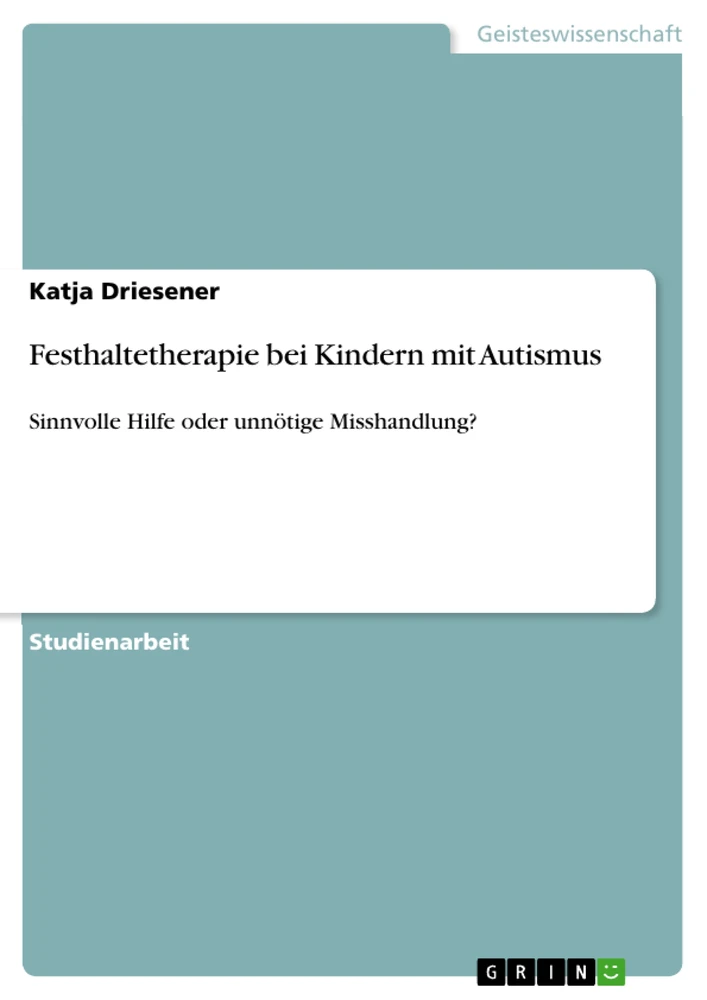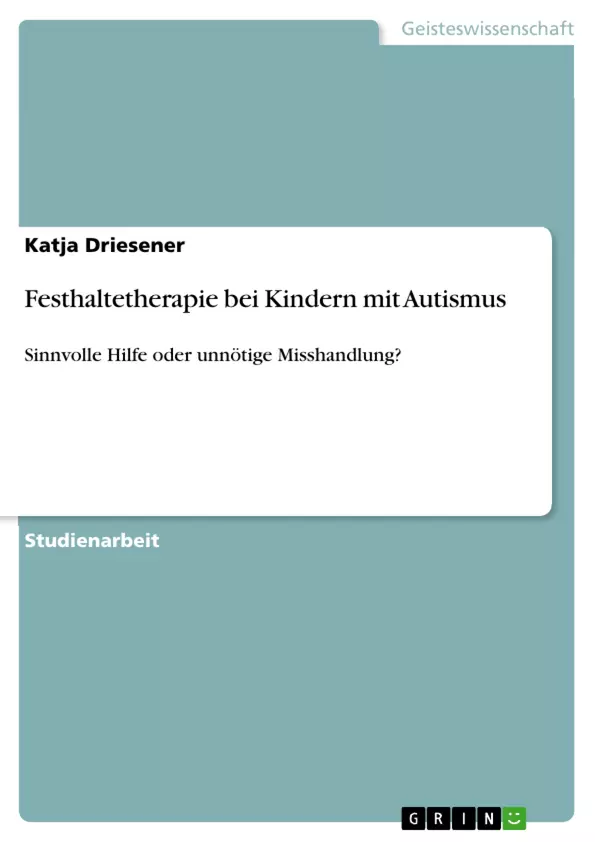Diese Arbeit befasst sich mit der Mutter-und-Kind-Haltetherapie („Forced Holding“) nach Martha G. Welch und der Festhaltetherapie nach Jirina Prekop. Einschränkend zu der Betrachtung dieser Therapieformen und des möglichen Klientels werde ich mich auf Kinder mit Autismus beziehen, weil gerade sie nach den Verfechterinnen unter einer Kontaktstörung leiden und eher eine Bindung zu Gegenständen und unbelebten Dingen statt zu Menschen und vor allem ihren Eltern herstellen. Es ist mir wichtig, herauszukristallisieren, wie die Therapieform begründet wird, welche Möglichkeiten sie für Kinder mit Autismus und ihre Familien erschließt und wie Kritiker zu dieser Methode stehen und ob sie eine wirkliche Alternativmethode zu den vielen weiteren Therapieformen darstellt.
Im Vorfeld werde ich Autismus und die drei häufigsten Formen kurz vorstellen. Auf den frühkindlichen Autismus gehe ich näher ein, da sich auch die Vertreter der Festhaltetherapien vorwiegend auf diese Form des Autismus beziehen. Ein wichtiges Element wird weiterhin die Bindungsfähigkeit autistischer Kinder zu ihren Eltern sein, denn diese ist ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit. Nachdem die Festhaltetherapien nach Welch und Prekop vorgestellt wurden, werde ich zur Gegenüberstellung kurz auf die Argumentation der Kritiker dieser Methode eingehen, um aufzuzeigen, wie gegensätzlich die Stellungnahmen sind und welche Debatten noch bis heute ausgefochten werden. Zum Schluss wird sich ein Fazit entwickeln, dass einen Mittelweg versuchen wird und Möglichkeiten aufzeigt, wie die Therapieform vielleicht im Sinne der Kritiker und der Vertreter anwendbar werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Autismus?
- 2.1. Allgemein
- 2.2. Formen des Autismus
- 2.3. Frühkindlicher Autismus im Speziellen
- 2.4. Eltern-Kind-Bindung
- 3. Eine Therapiemöglichkeit – die Festhaltetherapie
- 3.1. Entstehung, Begründer, Vertreter
- 3.2. Formen der Festhaltetherapie nach Welch und Prekop
- 4. Stellungnahmen von Vertretern und Gegnern zur Festhaltetherapie
- 5. Fazit: Sinn – Unsinn der Festhaltetherapie
- 6. Bibliografie und Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Festhaltetherapie bei Kindern mit Autismus und untersucht, ob sie eine sinnvolle Hilfe oder eine unnötige Misshandlung darstellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Mutter-und-Kind-Haltetherapie („Forced Holding“) nach Martha G. Welch und der Festhaltetherapie nach Jirina Prekop. Die Arbeit möchte die Entstehungsgeschichte dieser Therapieformen beleuchten, ihre Anwendungsmöglichkeiten für Kinder mit Autismus und ihre Familien aufzeigen und die Kritikpunkte der Gegner darlegen.
- Die Definition von Autismus und seine verschiedenen Formen
- Die Entstehung und Begründung der Festhaltetherapie
- Die Anwendungsmöglichkeiten und die Kritikpunkte der Methode
- Die Bindungsfähigkeit autistischer Kinder zu ihren Eltern
- Die Frage, ob die Festhaltetherapie eine Alternative zu anderen Therapieformen darstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den persönlichen Bezug des Autors zur Festhaltetherapie. Kapitel 2 definiert Autismus und seine drei häufigsten Formen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem frühkindlichen Autismus, da sich die Vertreter der Festhaltetherapie vorwiegend auf diese Form beziehen. Die Bedeutung der Bindungsfähigkeit autistischer Kinder zu ihren Eltern wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben. Kapitel 3 beschreibt die Entstehung, Begründer und Vertreter der Festhaltetherapie. Die beiden wichtigsten Formen, die Mutter-und-Kind-Haltetherapie („Forced Holding“) nach Martha G. Welch und die Festhaltetherapie nach Jirina Prekop, werden im Detail vorgestellt. Kapitel 4 beleuchtet die Argumentation der Kritiker der Festhaltetherapie und zeigt die gegensätzlichen Stellungnahmen und Debatten auf.
Schlüsselwörter
Autismus, Festhaltetherapie, Forced Holding, Martha G. Welch, Jirina Prekop, Eltern-Kind-Bindung, Kontaktstörung, frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus, Kritik, Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Festhaltetherapie nach Prekop?
Es ist eine Therapieform, bei der Eltern ihr Kind (oft gegen dessen Widerstand) festhalten, um eine emotionale Bindung und einen „Durchbruch“ in der Kommunikation zu erzwingen.
Warum wird diese Methode bei Autismus eingesetzt?
Vertreter glauben, dass Autismus eine Kontaktstörung ist, die durch das erzwungene Festhalten und den engen Körperkontakt gelöst werden kann.
Was kritisieren Gegner an der Festhaltetherapie?
Kritiker sehen darin eine Form der Misshandlung und Gewalt, die das Trauma des Kindes verstärken kann, statt eine echte Bindung aufzubauen.
Wer erfand das „Forced Holding“?
Die Methode geht ursprünglich auf die Amerikanerin Martha G. Welch zurück.
Gibt es einen Mittelweg in der Debatte?
Die Arbeit versucht im Fazit aufzuzeigen, ob und wie Elemente der Therapie im Sinne der Kritiker und Vertreter ethisch vertretbar anwendbar sein könnten.
- Quote paper
- Katja Driesener (Author), 2009, Festhaltetherapie bei Kindern mit Autismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179863