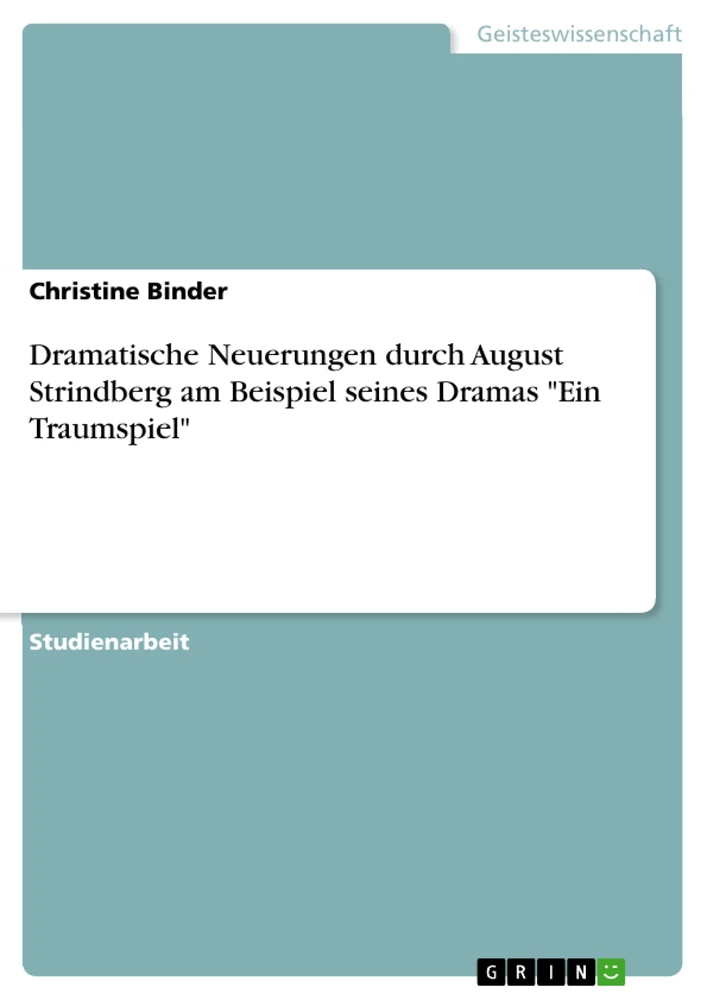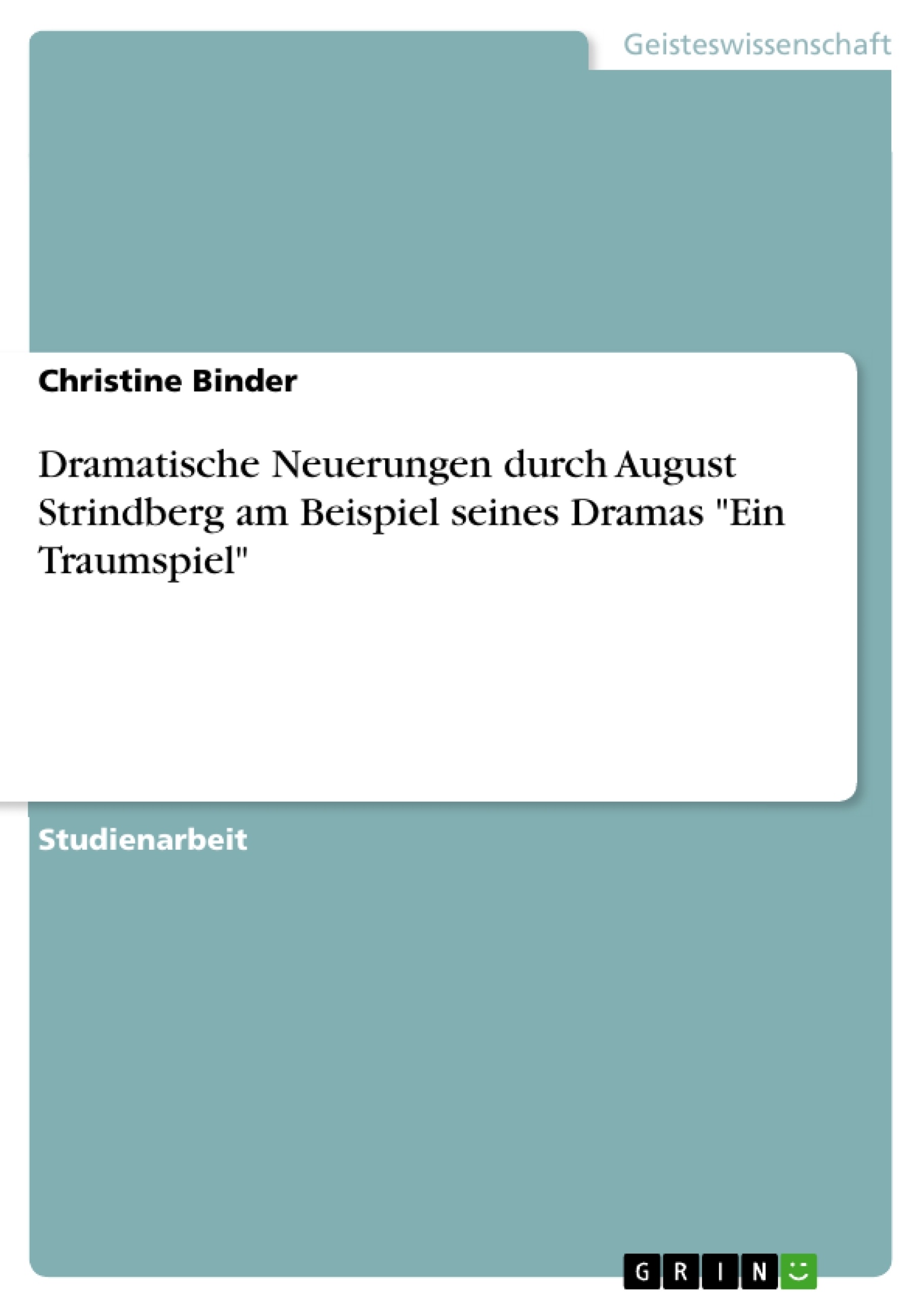Die vorliegende Arbeit möchte ein Schlaglicht auf den zeitgeschichtlichen Rahmen rund um Ein Traumspiel werfen und herausstellen, was dieses Stück im Besonderen und Strindbergs Arbeit im Allgemeinen so wichtig für den Weg des Dramas in die Moderne macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strindberg und Ein Traumspiel
- historischer Kontext
- Kurzbiographie Strindbergs
- Das Drama um 1900
- Die Besonderheit des Strindberg'schen Stationendramas
- Struktur
- Fabel
- Raum
- Zeit
- Personen
- Symbol und Bild
- historischer Kontext
- Strindbergs Bedeutung für die weitere Literaturgeschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Stück „Ein Traumspiel“ von August Strindberg und stellt die dramatischen Neuerungen im Kontext des historischen und literarischen Wandels am Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Dabei soll insbesondere die Bedeutung des Stationendramas für die Entwicklung des modernen Dramas beleuchtet werden.
- Die Bedeutung des Stationendramas für die Entwicklung des modernen Dramas
- Strindbergs biografischer Kontext und seine literarische Entwicklung
- Der Wandel des Dramas im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
- Die formalen Besonderheiten des Strindberg'schen Stationendramas
- Strindbergs Einfluss auf die weitere Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Themen und Ziele der Arbeit vor und führt in Strindbergs Leben und Werk ein. Das zweite Kapitel widmet sich dem historischen Kontext von „Ein Traumspiel“, indem es sowohl Strindbergs Biografie als auch den Wandel des Dramas um 1900 beleuchtet. Im Anschluss wird die Besonderheit des Strindberg'schen Stationendramas in Bezug auf Struktur, Fabel, Raum, Zeit, Personen und Symbol und Bild näher betrachtet. Abschließend werden Strindbergs Einfluss auf die weitere Literaturgeschichte und seine Bedeutung für die Entwicklung des modernen Dramas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Stationendrama, August Strindberg, Ein Traumspiel, modernes Drama, historischer Kontext, Naturalismus, Expressionismus, Symbolismus, Theatergeschichte, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Stationendrama bei Strindberg?
Das Stationendrama bricht mit der klassischen Dramenstruktur. Es reiht lose verbundene Szenen (Stationen) aneinander, die oft traumähnlich und subjektiv wirken.
Worum geht es in August Strindbergs 'Ein Traumspiel'?
Das Stück behandelt die Reise der Göttertochter Agnes auf die Erde, um das Leid der Menschen zu erfahren. Es markiert den Weg des Dramas in die Moderne.
Welche literarischen Strömungen beeinflussten Strindberg um 1900?
Strindbergs Werk steht im Übergang vom Naturalismus zum Expressionismus und Symbolismus.
Wie werden Raum und Zeit in 'Ein Traumspiel' dargestellt?
Raum und Zeit sind im Stück aufgehoben oder fließend, ähnlich wie in einem Traum, was eine radikale Neuerung gegenüber dem traditionellen Theater darstellte.
Welchen Einfluss hatte Strindberg auf die Literaturgeschichte?
Er gilt als Wegbereiter des modernen Dramas und beeinflusste maßgeblich spätere expressionistische und absurde Theaterformen.
- Quote paper
- Christine Binder (Author), 2010, Dramatische Neuerungen durch August Strindberg am Beispiel seines Dramas "Ein Traumspiel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179891