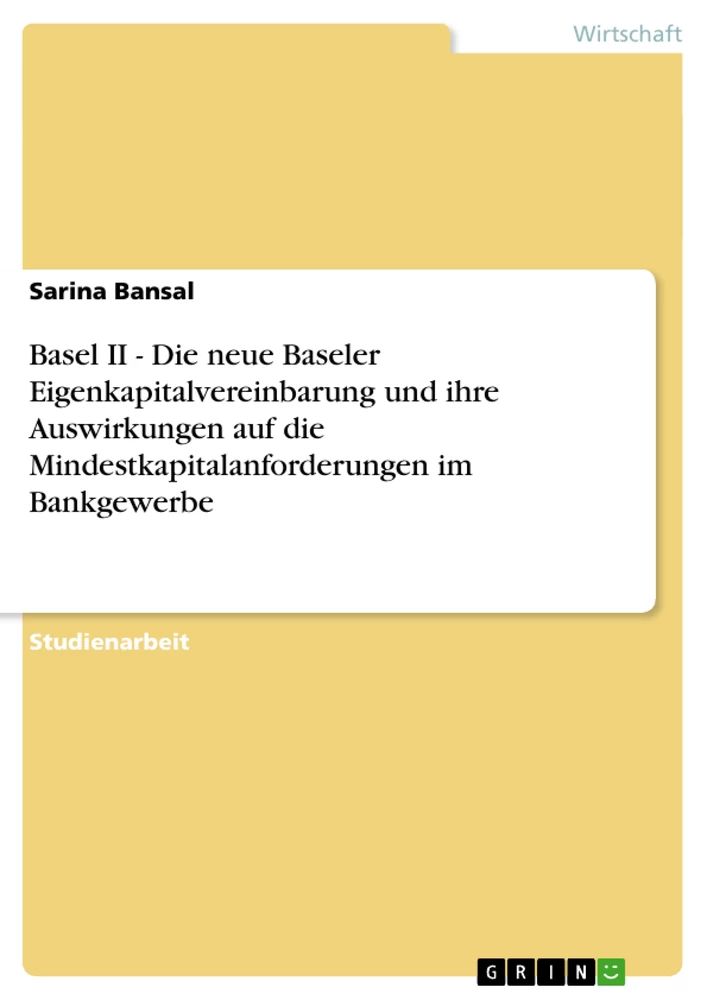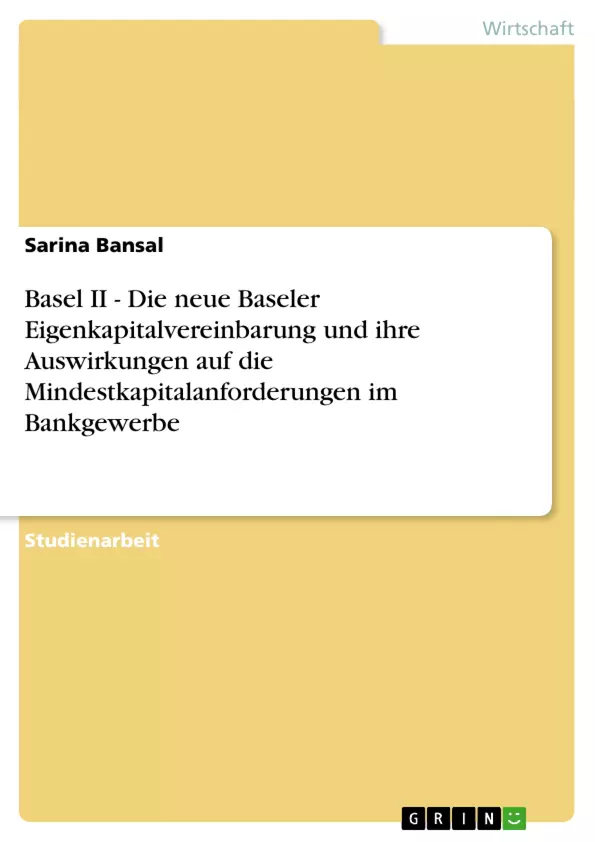Um das Wirtschaftswachstum und die allgemeine Beschäftigung nicht zu gefährden, dürfen
Banken nicht in Insolvenz geraten, da sie die Hauptfinanzierungsquelle der deutschen Unternehmen
darstellen.1 Damit größere Auswirkungen auf die Liquidität der Banken verhindert
werden, müssen die Risiken, die mit der Kreditvergabe der Banken verbunden sind, mit entsprechendem
Eigenkapital unterlegt werden. Eine ausreichende bzw. risikoadäquate Eigenkapitalausstattung
der Kreditinstitute ist somit Voraussetzung für ein stabiles Finanz- und
Wirtschaftssystem.2 Aufgrund des immer komplexer werdenden Bankgeschäfts wird derzeit
an einer Modifizierung der Eigenkapitalregeln, und somit der Mindestkapitalanforderungen,
gearbeitet. Diese neue Regelung, genannt Basel II, der neue Baseler Akkord oder die neue
Baseler Eigenkapitalvereinbarung, wird sehr kontrovers diskutiert. Basel II sieht vor, dass in
Zukunft das individuelle Rating eines Kreditnehmers für die notwendige Eigenkapitalunterlegung
maßgeblich für die Kreditvergabe sein wird.3 Kreditinstitute nutzen ohnehin schon
für die Beurteilung ihrer Kreditnehmer interne Ratingsysteme, die nun aufgrund der neuen
Regelung den neuen Anforderungen von Basel II angepasst werden müssen. Die Banken
stehen vor großen Herausforderungen.
Ziel dieser Arbeit ist es zu beweisen, dass sich trotz vieler offener Fragen bezüglich der genauen
Ratingverfahren und noch nicht vollendeter Diskussion über die Auswirkungen der
neuen Regelung auf Unternehmen und Banken die Neuregelung von Basel II eher vorteilhaft
auf die Banken und nachteilig auf die insbesonders kleineren Unternehmen auswirken werden.
Nach einer Erläuterung der Entstehungsgeschichte und des Ziels der Baseler Eigenkapitalvereinbarung
wird auf die Bestandteile der neuen Regelung eingegangen. Da das Kreditrisiko
den Hauptrisikofaktor im Kreditgeschäft darstellt, wird dieser Bereich Schwerpunkt dieser
Arbeit sein. Ganz besonders wird das interne Ratingverfahren durchleuchtet und auf die
Vorbereitungsanforderungen auf dieses Verfahren seitens der Kreditinstitute und ihrer Kreditnehmer
eingegangen. Weitere wesentliche Einflussfaktoren auf die Mindestkapitalanforderungen,
wie das Marktrisiko und das operationelle Risiko, werden aufgrund des Umfangs
nicht näher erläutert.
1 Vgl. Hückmann, Carolin (2002), S. 13.
2 Vgl. Paul, Stephan (2001), S. 6.
3 Vgl. Leker, Jens et al. (2001), S. 2.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Basel II
- 2.1 Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
- 2.2 Entwicklungsstufen von Basel II
- 2.3 Ziele von Basel II
- 3. Die drei Säulen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung
- 3.1 Säule 3: Förderung der Marktdisziplin
- 3.2 Säule 2: Aufsichtliches Überprüfungsverfahren
- 3.3 Säule 1: Mindestkapitalanforderungen
- 3.3.1 Kreditrisiko
- 3.3.1.1 Standardansatz
- 3.3.1.2 Interner Ratingansatz
- 3.3.1.2.1 Basisansatz
- 3.3.1.2.2 Fortgeschrittener Ansatz
- 3.3.2 Auswirkungen des Ratings nach dem Standardansatz
- 3.3.3 Auswirkungen des Ratings nach dem Internen Ratingansatz
- 4. Anforderungen bei der Vorbereitung zum Internen Rating
- 4.1 Aus Sicht der Kunden
- 4.1.1 Vorteile
- 4.1.2 Nachteile
- 4.2 Aus Sicht der Banken
- 4.2.1 Vorteile
- 4.2.2 Nachteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung, bekannt als Basel II, auf die Mindestkapitalanforderungen im Bankgewerbe. Dabei wird insbesondere auf die drei Säulen des neuen Akkords eingegangen, mit einem Schwerpunkt auf der Säule 1, den Mindestkapitalanforderungen, und dem Kreditrisiko. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Vorteile als auch die Nachteile der neuen Regelung aus der Perspektive der Banken und ihrer Kreditnehmer.
- Die Entwicklung und die Ziele der Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Die drei Säulen des neuen Akkords: Marktdisziplin, Aufsichtliches Überprüfungsverfahren und Mindestkapitalanforderungen
- Die Bedeutung des Kreditrisikos für die Mindestkapitalanforderungen
- Der Standardansatz und der Interne Ratingansatz zur Kreditrisikomessung
- Die Auswirkungen von Basel II auf die Banken und ihre Kunden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Bedeutung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung von Banken für die Stabilität des Finanz- und Wirtschaftssystems. Es wird die Notwendigkeit der Modifizierung der Eigenkapitalregeln im Kontext des komplexer werdenden Bankgeschäfts hervorgehoben. Basel II und seine Auswirkungen auf Banken und Unternehmen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Die Einleitung stellt das Ziel der Arbeit vor, die Vorteile und Nachteile von Basel II zu beleuchten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und der Entstehungsgeschichte von Basel II. Es werden die Entwicklungsstufen des neuen Akkords beschrieben, beginnend mit dem Grundsatz I bis hin zum aktuellen Entwurf. Die Ziele von Basel II, wie die Stärkung der Solidität des internationalen Finanzsystems und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Banken, werden erläutert.
Im dritten Kapitel werden die drei Säulen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung vorgestellt: die Förderung der Marktdisziplin, das aufsichtliche Überprüfungsverfahren und die Mindestkapitalanforderungen. Der Fokus liegt auf der Säule 1, den Mindestkapitalanforderungen, insbesondere dem Kreditrisiko. Es werden der Standardansatz und der Interne Ratingansatz zur Kreditrisikomessung detailliert erklärt.
Das vierte Kapitel analysiert die Anforderungen, die die Banken und ihre Kunden bei der Vorbereitung auf den Internen Ratingansatz erfüllen müssen. Die Vorteile und Nachteile des neuen Verfahrens für beide Seiten werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Basel II, Eigenkapitalanforderungen, Bankgewerbe, Kreditrisiko, Standardansatz, Interner Ratingansatz, Marktdisziplin, Aufsichtliches Überprüfungsverfahren, Bankenaufsicht, Finanzstabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Basel II?
Das Ziel ist die Stärkung der Solidität des internationalen Finanzsystems durch risikoadäquate Eigenkapitalanforderungen und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Banken.
Was sind die „drei Säulen“ von Basel II?
Die drei Säulen sind: 1. Mindestkapitalanforderungen (Kreditrisiko), 2. Aufsichtliches Überprüfungsverfahren und 3. Förderung der Marktdisziplin (Offenlegungspflichten).
Wie beeinflusst das Rating die Kreditvergabe unter Basel II?
Das individuelle Rating eines Kreditnehmers bestimmt die Höhe des Eigenkapitals, das die Bank für den Kredit hinterlegen muss. Ein schlechteres Rating führt zu höheren Kapitalkosten und meist zu höheren Zinsen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Standardansatz und dem Internen Ratingansatz?
Beim Standardansatz werden externe Ratings genutzt. Beim Internen Ratingansatz (IRB) verwenden Banken eigene, von der Aufsicht genehmigte Modelle zur Risikobewertung.
Welche Nachteile ergeben sich für kleine Unternehmen durch Basel II?
Kleinere Unternehmen könnten durch strengere Ratingverfahren benachteiligt werden, da sie oft über weniger Transparenz oder geringere Eigenkapitalquoten verfügen, was die Kreditaufnahme erschweren kann.
Warum ist Eigenkapital für Banken so wichtig?
Eine ausreichende Eigenkapitalausstattung dient als Puffer gegen Insolvenzrisiken bei Kreditausfällen und sichert somit die Stabilität des gesamten Wirtschaftssystems.
- Quote paper
- Sarina Bansal (Author), 2002, Basel II - Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung und ihre Auswirkungen auf die Mindestkapitalanforderungen im Bankgewerbe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17990