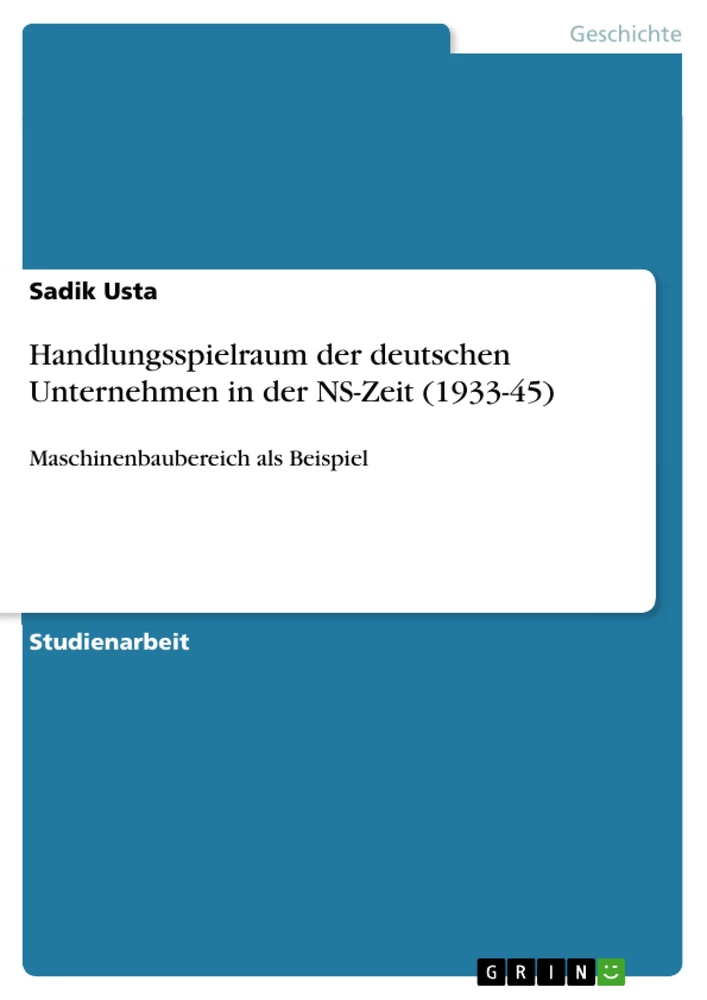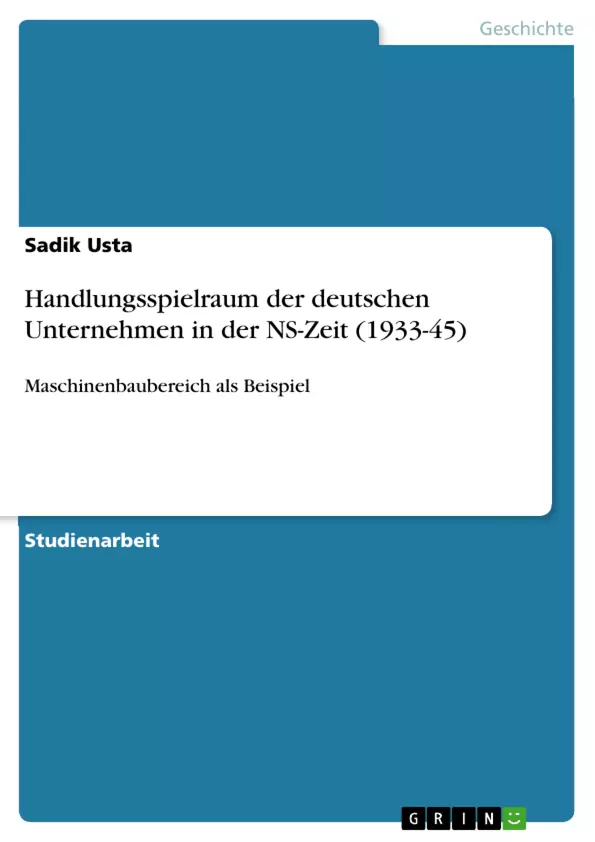Die Frage „ob die deutschen Unternehmen sich am NS-Unrechtsstaat beteiligt haben“ stellt inzwischen niemand mehr. Aber seit 1995 wird in der deutschen Öffentlichkeit eine sehr rege Diskussion darüber geführt, wie stark die deutschen Firmen in die Geschehnisse während der NS-Diktatur verwickelt waren. Diese Frage führte dazu, dass sich nach 1995 zahlreiche neue wissenschaftliche Studien mit diesem Thema beschäftigen.
Bezüglich der Rolle der Unternehmen während der NS-Diktatur könnte man auch die Fragen aufwerfen: Was für eine Rolle haben die deutschen Unternehmen während des Aufstiegs der NSDAP und der Etablierung des NS-Regimes gespielt? Wie intensiv profitierten die deutschen Firmen durch den Aufstieg der NSDAP und die Etablierung des Unrechtsstaats? Oder welche politischen und wirtschaftlichen Verschränkungen führten zu der „schrittweisen Anpassung“? Was waren die Handlungsmotive der Unternehmen, um bis zum letzten Abgrund der NS-Diktatur zu folgen?
Welche politisch-ideologischen Konfliktpunkte wurden durch die Zusammenarbeit erzeugt?
Wie wurden die Unternehmen in das NS-Regime eingebunden und welche Zwangs- und Reglementierungsmaßnahmen ergriff das Regime, um die deutschen Unternehmen in die Kriegswirtschaft einzuspannen?
Hatten die Unternehmen Möglichkeiten, sich gegen die Reglementierungsmaßnahmen zu wehren? Gab es Handlungs- oder Entscheidungsspielräume bzw. „Betriebsautonomie“? Wenn ja, haben sie von dieser „Betriebsautonomie“ Gebrauch gemacht? Und schließlich: gab es einen individuellen oder organisierten Widerstand in Bezug auf wirtschaftliche Tätigkeit gegen den Unrechtsstaat?
Diese Hausarbeit beabsichtigt, die Handlungsspielräume der deutschen Unternehmen - im Maschinenbaubereich - während des NS-Regimes zu untersuchen und anhand von konkreten Beispielen zu zeigen, dass die Unternehmen trotz intensiver Verwicklung in das NS-Regime wohl Entscheidungsspielräume hatten und sie davon auch Gebrauch machten. D.h. die privaten deutschen Unternehmen hatten während der NS-Zeit ihre betriebliche Autonomie nicht vollständig verloren, sondern konnten einen Teil ihrer wirtschaftlichen Ziele gegen die Obrigkeit durch verschiedene Maßnahmen durchsetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Das Verhältnis der Unternehmen zum NS-Regime
- 1. Lenkungsmöglichkeiten des NS-Staates und Handlungsspielraum
- 2. Epocheneinteilung nach dem Handlungsspielraum
- 2. 1. Integration der Unternehmen in das NS-System: 1933-1939
- 2. 2. Kriegswirtschaft bis zum Speerschen System: 1939-1942
- 2. 3. Speersche Ausschuss- und Ringsysteme: 1942-1944
- 2. 4. Überlebensreflex der Unternehmen und Dissens: 1944-1945
- II. Politisch-ideologische Konfliktpunkte
- 1. Ariisierung der Betriebe – das sogenannte Judenproblem
- 2. Unternehmensinterne Betriebspolitik - die Einmischung der DAF
- 3. NS-Regime und personelle Verstrickung der Unternehmer
- 4. Unternehmensleitung und kriegswirtschaftliche Struktur
- III. Handlungsspielraum und Zwangswirtschaft
- 1. Preiskontrolle durch Reglementierung
- 2. Produktions- und Exportbeschränkung
- 3. Rohstoff- und Arbeitskräftekontingentierung
- 4. Zwangsauslese der Unternehmen durch Rationalisierung
- IV. Selbstverwaltungsmöglichkeiten
- 1. Die Struktur der Selbstverwaltungsorgane
- 2. Die Funktion der Ausschüsse und Handlungsspielraum
- 3. Von der Zusammenarbeit zur Opposition?
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Handlungsspielräume der deutschen Unternehmen im Maschinenbaubereich während des NS-Regimes und zeigt anhand konkreter Beispiele, dass die Unternehmen trotz intensiver Verwicklung in das NS-Regime wohl Entscheidungsspielräume hatten und sie davon auch Gebrauch machten. Die Arbeit beleuchtet, wie deutsche Unternehmen in das NS-System integriert wurden und wie sie mit den politischen und wirtschaftlichen Zwängen des Regimes umgingen.
- Das Verhältnis der Unternehmen zum NS-Regime: Zusammenarbeit und Dissens, Zwang und Autonomie
- Politisch-ideologische Konfliktpunkte: Ariisierung, Betriebspolitik, personelle Verstrickung, kriegswirtschaftliche Struktur
- Handlungsspielräume und Zwangswirtschaft: Preiskontrolle, Produktions- und Exportbeschränkungen, Rohstoff- und Arbeitskräftekontingentierung, Rationalisierung
- Selbstverwaltungsmöglichkeiten: Struktur und Funktion der Selbstverwaltungsorgane, Oppositionspotenzial
- Die Rolle der Unternehmen im Aufstieg der NSDAP und der Etablierung des NS-Regimes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Handlungsspielraum deutscher Unternehmen im Maschinenbaubereich während der NS-Zeit und beleuchtet die Bedeutung der Thematik in der aktuellen Forschung. Das erste Kapitel analysiert das Verhältnis der Unternehmen zum NS-Regime, untersucht die Lenkungsmöglichkeiten des Staates und die Entwicklung des Handlungsspielraums in verschiedenen Phasen der NS-Zeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die politisch-ideologischen Konfliktpunkte zwischen Unternehmen und Regime. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Zwangsmaßnahmen der NS-Wirtschaft, die den Handlungsspielraum der Unternehmen einschränkten, und zeigt gleichzeitig die Möglichkeiten auf, diese Einschränkungen zu umgehen. Das vierte Kapitel untersucht die Selbstverwaltungsorgane und deren Funktion im NS-System.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Handlungsspielraum, deutsche Unternehmen, Maschinenbau, NS-Regime, Kriegswirtschaft, Zwangswirtschaft, Selbstverwaltung, Ariisierung, Betriebspolitik, personelle Verstrickung, Entscheidungsspielräume, Betriebsautonomie, Widerstand.
- Citar trabajo
- Sadik Usta (Autor), 2011, Handlungsspielraum der deutschen Unternehmen in der NS-Zeit (1933-45), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180090