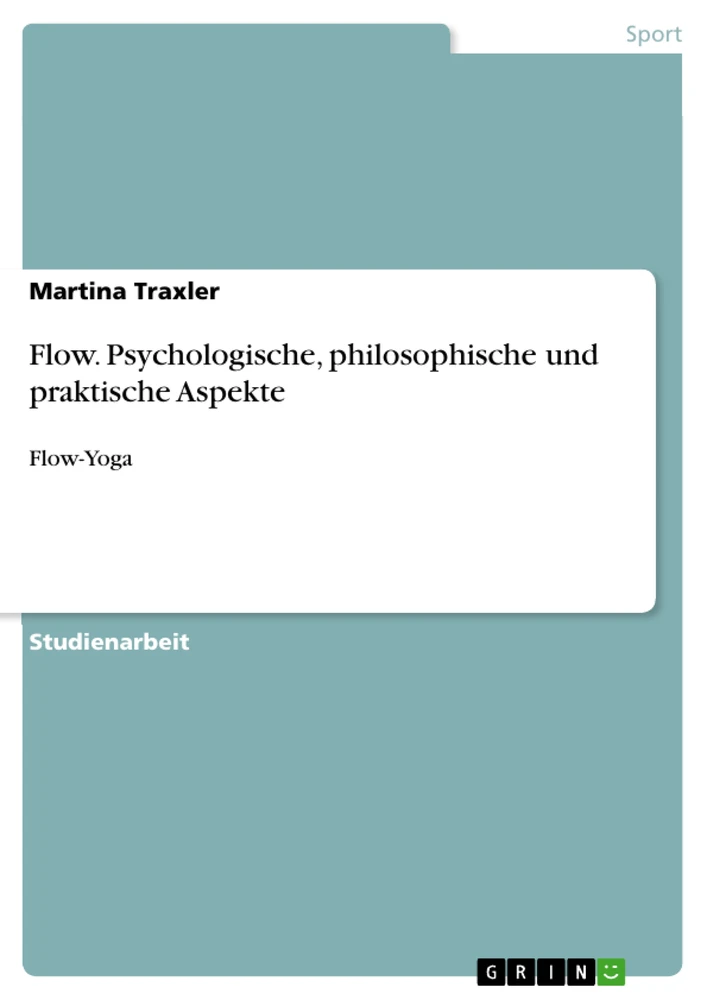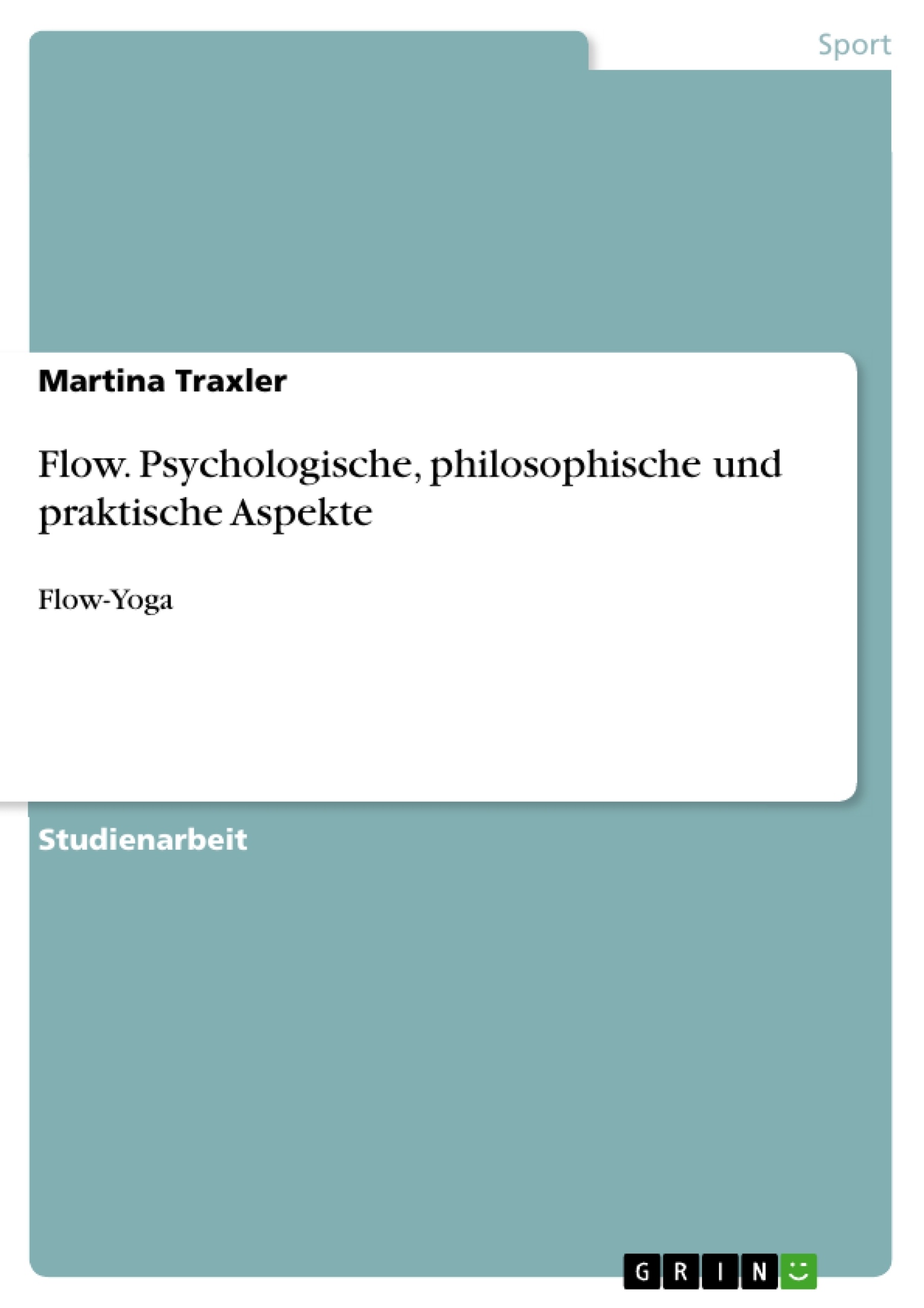Als Yoga-Übende erfahre ich immer wieder wie meine Praxis auf meine
Gemütsverfassung positiv Einfluss nimmt.[...]Was ist es nun, das Yoga die Menschen diese Glückserfahrungen machen lässt?
Die „Flow-Theorie“ von Csikszentmihalyi kann hier theoretischen Background liefern.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit psychologischen Aspekten des flow, mit den acht charakteristischen Merkmalen von flow-Erlebnissen. Im zweiten Teil versuche ich die Yoga-Philosophie und die positiven Erfahrungen die Menschen mit Yoga machen in Verbindung zur flow-Theorie von Csikszentmihalyi zu setzen.
Der dritte Teil befasst sich mit der Frage was ich als Yogalehrerin beitragen kann, um meinen Yoga-Schüler/innen im Unterricht flow-Erfahrungen zu ermöglichen.
Im vierten und im letzten Teil der Arbeit befasse ich mich mit jenem Yoga-Stil der bezeichnenderweise den „flow“ für sich beansprucht. Ich gebe einen kurzen Einblick in die Spezialitäten des flow-Yoga und als abschließender, praktischer Teil findet sich ein selbst verfasster Yoga-flow zum ausprobieren.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Flow-Theorie
- 1.1. Acht charakteristische Merkmale von Flow-Erlebnissen
- 1.1.1. Klarheit der Ziele, unmittelbare Rückmeldung
- 1.1.2. Die optimale Herausforderung
- 1.1.3. Gesammelte Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Reizfeld
- 1.1.4. Handeln und Bewusstsein verschmelzen
- 1.1.5. Gefühl von Kompetenz und potentieller Kontrolle
- 1.1.6. Selbstvergessenheit, Selbsttranszendenz
- 1.1.7. Verändertes Zeitgefühl
- 1.1.8. Autotelisches Erleben
- 1.1. Acht charakteristische Merkmale von Flow-Erlebnissen
- 2. Yoga & Flow
- 2.1. Das Yoga-System im näheren Vergleich zur Flow-Theorie
- 2.1.1. Ethische Grundlage
- 2.1.2. Körperliche Übung
- 2.1.3. Einschränkung des Reizfeldes
- 2.1.4. Aufmerksamkeit
- 2.1.5. Hingabe und Kontrolle
- 2.1.6. Wesen der Freude
- 2.1.7. Jenseits der Zeitlichkeit
- 2.1.8. Autotelisches Erleben
- 2.2. Zusammenfassend
- 2.1. Das Yoga-System im näheren Vergleich zur Flow-Theorie
- 3. Flow im Yoga-Unterricht
- 3.1. Raum schaffen um das Ego schweigen lassen zu können
- 3.2. Klarheit und Eindeutigkeit
- 3.3. Optimale Herausforderung
- 3.4. Selbst-Sein in der Übung
- 3.5. Aufmerksamkeit allein auf die Übung
- 3.6. Ermutigung zum vertrauensvollen Engagement
- 3.7. Wert des Rituals und von Wiederholungen
- 4. Flow-Yoga
- 4.1. Aspekte des Flow Yoga
- 5. Praktischer Teil: Das Leben meistern - Ein Yoga-Flow
- 5.1. Ablauf (Fotostrecke)
- 5.2. Beschreibung: Das Leben meistern
- 5.3. Kurze Reflexion über den Aufbau
- 5.3.1. Sequenz um einen Höhepunkt aufbauen
- 5.3.2. Schwerpunkt
- 5.3.3. Tanz der Energien
- 5.3.4. Verweilen & rhythmisches Fließen
- 5.3.5. Variation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen der Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi und der Yogapraxis. Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale von Flow-Erlebnissen zu beschreiben und deren Relevanz für den Yoga-Unterricht aufzuzeigen. Der praktische Teil beinhaltet die Entwicklung einer Yoga-Sequenz, die Flow-Zustände fördern soll.
- Die acht charakteristischen Merkmale von Flow-Erlebnissen nach Csikszentmihalyi
- Der Vergleich der Flow-Theorie mit dem Yoga-System
- Die Gestaltung von Yoga-Unterricht zur Förderung von Flow-Erfahrungen
- Die Charakteristika von Flow-Yoga
- Entwicklung und Beschreibung einer praktischen Yoga-Sequenz
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach dem Glück und den Möglichkeiten, es zu erreichen. Sie verbindet die Suche nach Glück mit der Flow-Theorie und Yoga, wobei Yoga als Praxis zur Erzeugung von Glücksmomenten vorgestellt wird. Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: die Flow-Theorie, Yoga und Flow, Flow im Yoga-Unterricht und schließlich einen praktischen Teil mit einer selbst entwickelten Yoga-Sequenz.
1. Die Flow-Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi, die sich mit der Frage beschäftigt, was Menschen dazu bewegt, Aktivitäten um ihrer selbst willen auszuüben. Es definiert Flow als einen Zustand des Aufgehens in einer Tätigkeit, der durch acht charakteristische Merkmale gekennzeichnet ist, wie z.B. Klarheit der Ziele, optimale Herausforderung und Selbstvergessenheit. Der Fokus liegt auf der intrinsischen Motivation und dem autotelischen Charakter von Flow-Aktivitäten.
2. Yoga & Flow: Dieses Kapitel setzt die Flow-Theorie in Beziehung zum Yoga. Es vergleicht die acht Merkmale von Flow-Erlebnissen mit den Prinzipien und Erfahrungen im Yoga. Die verschiedenen Aspekte des Yoga, wie ethische Grundlagen, körperliche Übungen, Aufmerksamkeit und Hingabe, werden im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Flow-Kriterien analysiert. Es wird gezeigt, wie Yogapraxis Flow-Zustände begünstigen kann.
3. Flow im Yoga-Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Yogalehrer*innen Flow-Erfahrungen bei ihren Schüler*innen im Unterricht fördern können. Es werden verschiedene Aspekte des Unterrichtsdesigns angesprochen, die dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Flow leichter zugänglich ist. Hierzu gehören Aspekte wie Raum für das Ego zu schaffen, Klarheit und Eindeutigkeit der Übungen und die Schaffung einer optimalen Herausforderung.
Schlüsselwörter
Flow-Theorie, Mihaly Csikszentmihalyi, Yoga, autotelisches Erleben, Glück, Selbstvergessenheit, optimale Herausforderung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Yogapraxis, Flow-Yoga, Yoga-Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verbindung zwischen Flow-Theorie und Yogapraxis
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen der Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi und der Yogapraxis. Das Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale von Flow-Erlebnissen zu beschreiben und deren Relevanz für den Yoga-Unterricht aufzuzeigen. Ein praktischer Teil beinhaltet die Entwicklung einer Yoga-Sequenz zur Förderung von Flow-Zuständen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die acht charakteristischen Merkmale von Flow-Erlebnissen nach Csikszentmihalyi, einen Vergleich der Flow-Theorie mit dem Yoga-System, die Gestaltung von Yoga-Unterricht zur Förderung von Flow-Erfahrungen, die Charakteristika von Flow-Yoga und die Entwicklung und Beschreibung einer praktischen Yoga-Sequenz.
Was ist die Flow-Theorie und wie wird sie in der Arbeit erklärt?
Die Arbeit beschreibt die Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi, die sich mit der Frage beschäftigt, was Menschen dazu bewegt, Aktivitäten um ihrer selbst willen auszuüben. Flow wird als ein Zustand des Aufgehens in einer Tätigkeit definiert, gekennzeichnet durch acht Merkmale wie Klarheit der Ziele, optimale Herausforderung und Selbstvergessenheit. Der Fokus liegt auf intrinsischer Motivation und dem autotelischen Charakter von Flow-Aktivitäten.
Wie wird die Flow-Theorie mit Yoga in Verbindung gebracht?
Die Arbeit vergleicht die acht Merkmale von Flow-Erlebnissen mit den Prinzipien und Erfahrungen im Yoga. Verschiedene Aspekte des Yoga (ethische Grundlagen, körperliche Übungen, Aufmerksamkeit, Hingabe) werden auf ihre Übereinstimmung mit den Flow-Kriterien analysiert. Es wird gezeigt, wie Yogapraxis Flow-Zustände begünstigen kann.
Wie kann Flow im Yoga-Unterricht gefördert werden?
Die Arbeit beschreibt, wie Yogalehrer*innen Flow-Erfahrungen bei ihren Schüler*innen fördern können. Es werden Aspekte des Unterrichtsdesigns angesprochen, die ein Umfeld schaffen, in dem Flow leichter zugänglich ist. Dazu gehören z.B. Raum für das Ego, Klarheit und Eindeutigkeit der Übungen und die Schaffung einer optimalen Herausforderung.
Was ist der praktische Teil der Arbeit?
Der praktische Teil beinhaltet die Entwicklung und Beschreibung einer Yoga-Sequenz ("Das Leben meistern"), die Flow-Zustände fördern soll. Der Ablauf wird detailliert beschrieben, inklusive einer Reflexion über den Aufbau der Sequenz (Sequenz um einen Höhepunkt, Schwerpunkt, Tanz der Energien, Verweilen & rhythmisches Fließen, Variation).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Flow-Theorie, Mihaly Csikszentmihalyi, Yoga, autotelisches Erleben, Glück, Selbstvergessenheit, optimale Herausforderung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Yogapraxis, Flow-Yoga, Yoga-Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, der Flow-Theorie, Yoga & Flow, Flow im Yoga-Unterricht, Flow-Yoga und einen praktischen Teil mit einer Yoga-Sequenz inklusive Beschreibung und Reflexion.
- Quote paper
- Martina Traxler (Author), 2011, Flow. Psychologische, philosophische und praktische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180095