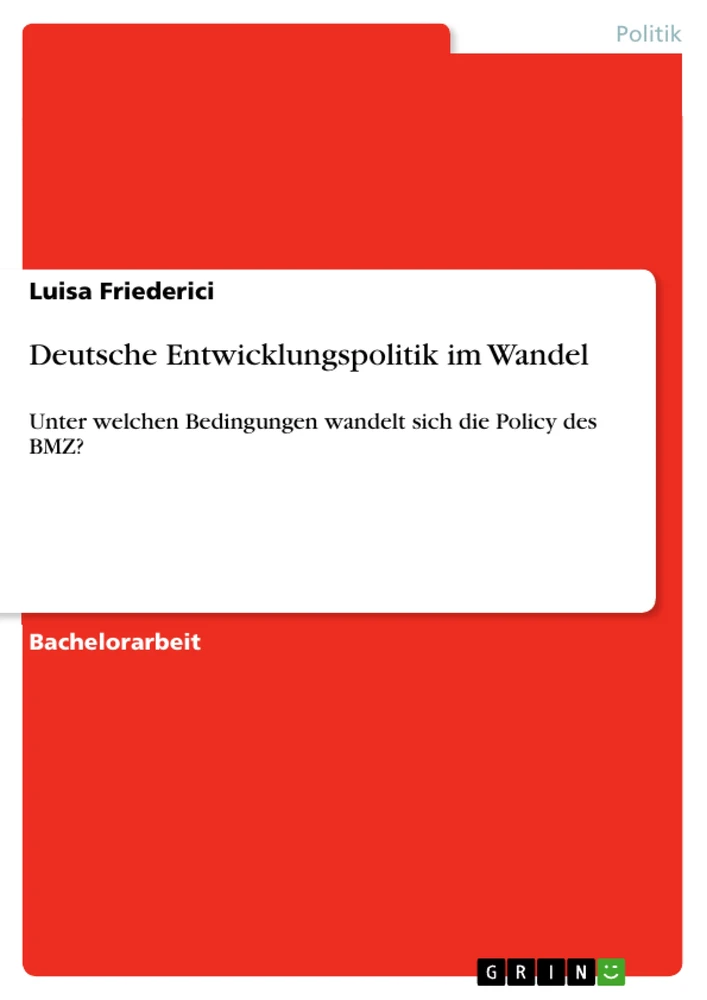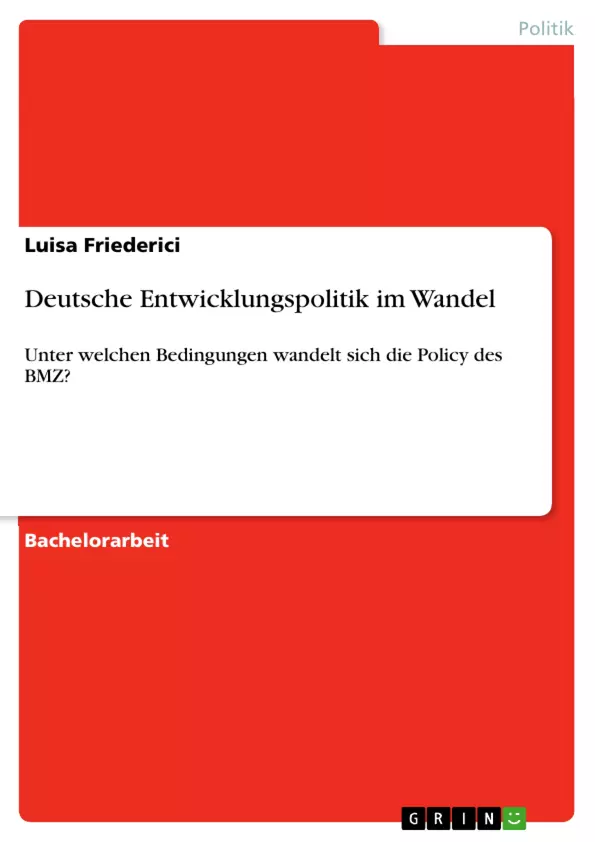In der Arbeit wird untersucht unter welchen Bedingungen sich die Policy des BMZ ändert. Es werden zwei Wendepukte analysiert; 1. 1990 und 2. 2004. Stets werden sowhl innenpolitsche und internationale Faktoren in die Analyse miteinbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Fallstudien
- Wendepunkt 1990
- Die Policy des BMZ vor 1990
- Die Deutsche Wiedervereinigung
- Ministerwechsel
- UNCED
- Die neue Policy des BMZ
- Wendepunkt 2004
- Die Policy des BMZ vor 2004
- Ministerwechsel
- Die MDGs
- Das Abkommen von Cotonou
- 11. September 2001
- Die neue Policy des BMZ
- Wendepunkt 1990
- Fazit
- Ausblick: Wie geht es weiter mit der deutschen EZ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Sie analysiert die zwei Wendepunkte 1990 und 2004, um herauszufinden, ob einhergehend mit der Veränderung der ODA-Quote ein Wandel auf Policyebene stattgefunden hat. Die Arbeit möchte die Faktoren identifizieren, die diesen Wandel beeinflusst haben.
- Die deutsche Wiedervereinigung
- Der Einfluss von Ministerwechseln auf die EZ-Policy
- Die Bedeutung internationaler Abkommen, wie die UNCED und das Abkommen von Cotonou
- Die Rolle der Millenium Development Goals (MDGs)
- Der Einfluss von Ereignissen wie den Terroranschlägen vom 11. September 2001
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der deutschen EZ und die Definition von Entwicklungshilfe dar. Sie beleuchtet die Entwicklung der ODA-Quote und zeigt die Bedeutung des stetigen Wandels in der deutschen EZ. Die Analyse der Fallstudien konzentriert sich auf die beiden Wendepunkte 1990 und 2004. Es werden die EZ-Policy vor diesen Wendepunkten beschrieben sowie die relevanten Einflussfaktoren, wie die deutsche Wiedervereinigung, Ministerwechsel, internationale Abkommen und Ereignisse wie die Terroranschläge vom 11. September 2001. Das Fazit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse und zeigt die Auswirkungen des Wandels in der deutschen EZ. Der Ausblick gibt einen kurzen Blick auf die zukünftige Entwicklung der deutschen EZ.
Schlüsselwörter
Entwicklungszusammenarbeit, ODA-Quote, Policy, Deutsche Wiedervereinigung, Ministerwechsel, UNCED, MDGs, Abkommen von Cotonou, 11. September 2001, BMZ.
Häufig gestellte Fragen
Welche Wendepunkte in der deutschen Entwicklungspolitik werden analysiert?
Die Arbeit untersucht zwei zentrale Wendepunkte: das Jahr 1990 (Deutsche Wiedervereinigung) und das Jahr 2004.
Welchen Einfluss hatte die Wiedervereinigung auf das BMZ?
Die Wiedervereinigung 1990 führte zu einer Neuausrichtung der Policy des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter Berücksichtigung neuer nationaler Prioritäten.
Wie beeinflussen internationale Abkommen die deutsche EZ-Policy?
Abkommen wie die UNCED, das Cotonou-Abkommen und die Millennium Development Goals (MDGs) spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
Spielen Ministerwechsel eine Rolle für die politische Ausrichtung?
Ja, die Arbeit analysiert, inwieweit personelle Wechsel an der Spitze des Ministeriums zu Veränderungen in der strategischen Ausrichtung (Policy) geführt haben.
Was ist die ODA-Quote?
Die ODA-Quote (Official Development Assistance) misst den Anteil des Bruttonationaleinkommens, der für öffentliche Entwicklungsleistungen aufgewendet wird; ihre Veränderung ist oft ein Indikator für politischen Wandel.
- Citation du texte
- Luisa Friederici (Auteur), 2010, Deutsche Entwicklungspolitik im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180101