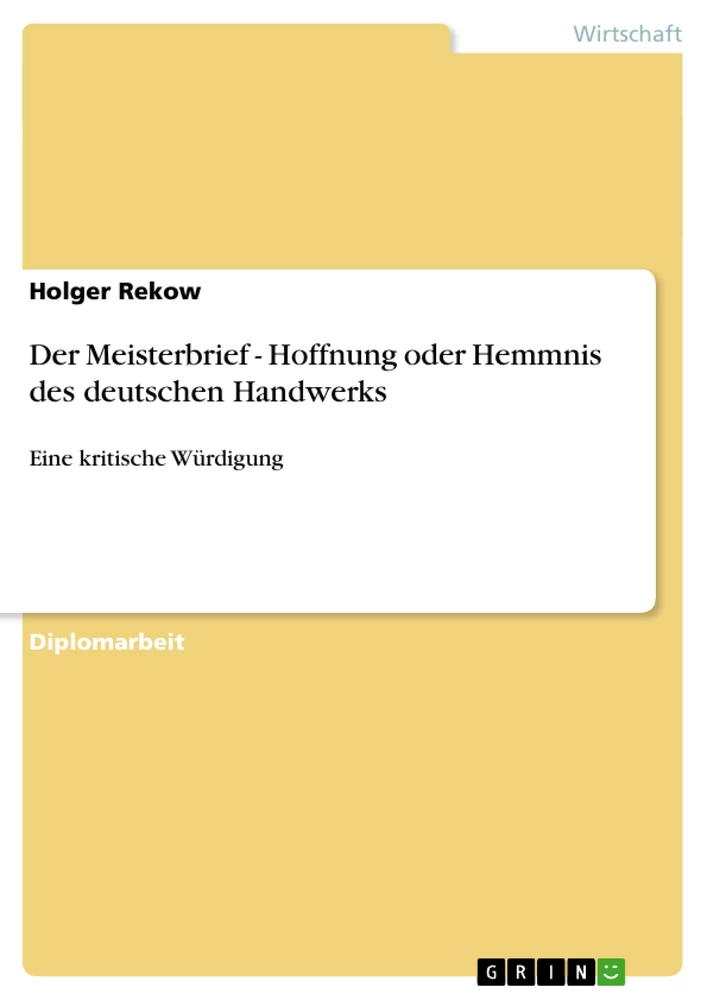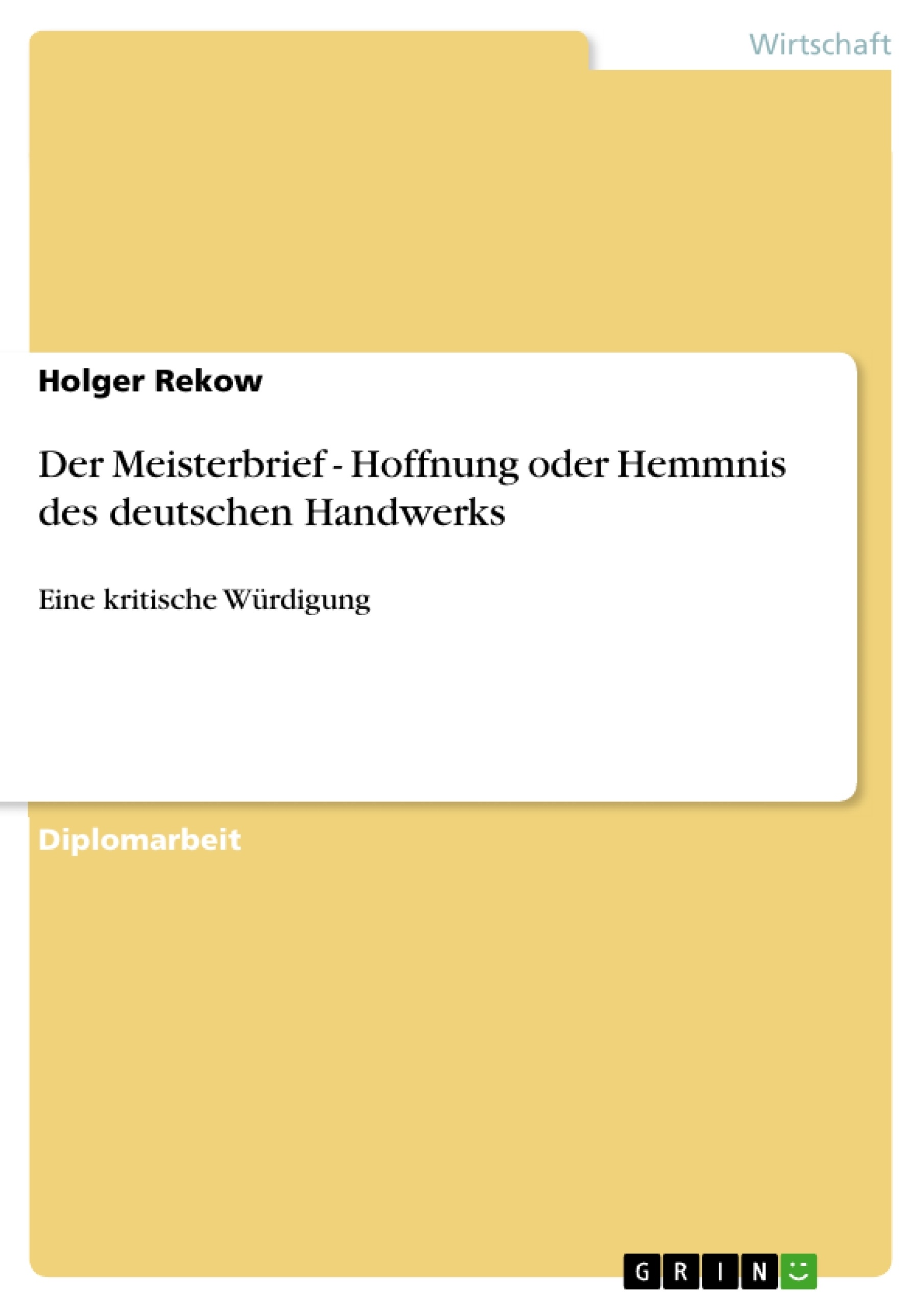1 Einleitung
Globalisierung und ein rascher technischer Wandel kennzeichnen heute Wirtschaftsländer weltweit. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren noch beschleunigt werden und den Wettbewerbsdruck untereinander verstärken. Der rasche technische Fortschritt beein-flusst die Wirtschaft weltweit, aber nicht nur positiv. Ständig besteht die Notwendigkeit einer Adaption an sich immer schneller ändernde Rahmenbedingungen.
Der Begriff der Flexibilität hat somit in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und ist nicht mehr nur ein Kann, sondern ein Muss für jeden Wirtschaftsbereich. Nur wenn eine Branche die Möglichkeit hat, sich permanent anpassen zu können, hat sie eine Chance, in dieser Zeit am Markt zu bestehen.
Starre Institutionen und Gesetze erschweren häufig die erforderliche Adaptionsfähigkeit oder machen sie schlichtweg unmöglich. Diese Tatsache wird aber meistens erst wahrge-nommen, wenn deutliche Wohlfahrtseinbußen spürbar werden.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass in Zeiten einer gesamtwirtschaftlichen Krise, von der in unseren Tagen wieder offen gesprochen wird, intensive Ursachenforschung betrie-ben wird. Regelmäßig melden sich in einer solchen Phase Experten zu Wort, die die vor-herrschenden Regulierungen des Staates dafür verantwortlich machen. Diese hindern ein Wirtschaftssystem daran, sich selber zu regulieren, Krisen zu bewältigen und so die Ge-samtwohlfahrt wieder zu maximieren.
Aus diesen Aussagen lässt sich auch der Umkehrschluss ableiten. Kann sich die Wirt-schaft eines Staates nicht mehr selber regulieren bzw. scheint die Wirtschaft zu „lahmen“, dann müssen die Eingriffe in den natürlichen Wirtschaftskreislauf zu massiv sein. Deregu-lierung ist dann das Schlagwort und jede große und starr wirkende Institution wird hinter-fragt und auf ihren Sinn und ihre Zeitmäßigkeit hin geprüft. Organisationen, die auch noch einen Pflichtmitgliedsbeitrag erheben, geraten besonders schnell unter Beschuss. Dabei fällt erst einmal nicht ins Gewicht, welche Leistungen von diesen Einrichtungen erbracht werden.
Eine Institution, die schon oft für eine bestehende wirtschaftliche Krise, wie es aktuell der Fall ist, verantwortlich gemacht wurde, ist die deutsche Handwerksorganisation und mit ihr das Gesetz zur Ordnung des Handwerks (HwO). Sie entspricht auf den ersten Blick einer die Volkswirtschaft „behindernden“ Institution und ist deshalb in der letzten Zeit erneut heftiger Kritik ausgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Abgrenzung des Handwerksbegriffes
- 2 Theoretische, rechtliche und inhaltliche Grundlagen
- 2.1 Historie
- 2.2 Organisation des Handwerks
- 2.3 Die Handwerksordnung
- 2.3.1 Aufbau und Inhalt
- 2.3.2 Die Handwerksrolle
- 2.4 Die Meisterprüfung
- 2.4.1 Zulassungsvoraussetzungen
- 2.4.2 Aufbau und Inhalt der Meisterprüfung
- 2.5 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Handwerks
- 3 Heutige Rahmenbedingungen des Handwerks
- 3.1 Globalisierung
- 3.2 Handwerk in Europa
- 3.3 Die EU-Osterweiterung
- 3.4 Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit
- 3.5 Deregulierung in Deutschland
- 3.6 Der industrielle Sektor
- 3.7 Finanzsituation in Deutschland
- 3.8 Zusammenfassende Beurteilung
- 4 Die retrospektive Betrachtung der Reformanbahnung der Handwerksordnung
- 4.1 Entstehung der aktuellen Diskussion
- 4.2 Die Kontrahenten der Diskussion
- 4.3 Die Argumente im Überblick
- 4.4 Argumente pro großen Meisterbrief
- 4.4.1 Sicherung der Qualifikation
- 4.4.2 Ausbilder Handwerk
- 4.4.3 Verbraucherschutz und Qualitätssicherung
- 4.4.4 Förderung der Wettbewerbsintensität
- 4.4.5 Vorbild für Europa
- 4.5 Argumente contra Meisterbrief
- 4.5.1 Meisterbrief verstößt gegen die Verfassung
- 4.5.1.1 Die Berufsfreiheit
- 4.5.1.2 Inländerdiskriminierung und Niederlassungsfreiheit
- 4.5.2 Der Kostenfaktor
- 4.6 Zusammenfassende Beurteilung der Diskussion
- 5 Die Novellierung der Handwerksordnung
- 5.1 Die große Novelle
- 5.1.1 Aufhebung des Inhaberprinzips
- 5.1.2 Die Altgesellenregelung
- 5.1.3 Erneuerung der Ausbildungsregelung
- 5.1.4 Kammerbeitragsbefreiung
- 5.1.5 Die „kleine\" Novelle
- 5.2 Mögliche wirtschaftliche und bildungspolitische Auswirkungen der Reform
- 5.2.1 Angebot und Nachfrage
- 5.2.2 Preise
- 5.2.3 Ausbildungsleistung
- 5.2.4 Meisterprüfung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der kritischen Analyse des Meisterbriefs im deutschen Handwerk. Ziel ist es, die Relevanz des Meisterbriefs im Kontext der heutigen Wirtschaft zu beleuchten und die Argumente für und gegen die Beibehaltung oder Abschaffung der Meisterpflicht zu analysieren.
- Die historische Entwicklung und die aktuelle Situation des Handwerks in Deutschland
- Die rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen der Handwerksordnung, insbesondere die Meisterprüfung
- Die Auswirkungen der Globalisierung und der Deregulierung auf das Handwerk
- Die Kontroverse um die Meisterpflicht und die verschiedenen Argumente der Protagonisten
- Die Novellierung der Handwerksordnung und die möglichen Folgen für das Handwerk
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, indem es die Problemstellung und das Ziel der Arbeit erläutert. Außerdem wird der Handwerksbegriff abgegrenzt. Kapitel 2 beleuchtet die historischen, rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen des Handwerks. Die Handwerksordnung, die Meisterprüfung und die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Handwerks werden detailliert dargestellt. Kapitel 3 analysiert die aktuellen Rahmenbedingungen des Handwerks, wie z.B. die Globalisierung, die Deregulierung und die Finanzsituation in Deutschland. In Kapitel 4 wird die Debatte um die Reform der Handwerksordnung untersucht. Die Argumente für und gegen die Beibehaltung der Meisterpflicht werden ausgewertet. Kapitel 5 befasst sich mit der Novellierung der Handwerksordnung und ihren möglichen Folgen. Die Kapitel 6 enthält ein Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des deutschen Handwerks, insbesondere mit der Rolle des Meisterbriefs. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind daher: Handwerksordnung, Meisterprüfung, Berufsfreiheit, Globalisierung, Deregulierung, Wettbewerb, Qualitätssicherung, Ausbildung, Wirtschaftspolitik und Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Meisterbrief ein Hemmnis für das deutsche Handwerk?
Kritiker sehen im Meisterbrief eine Marktzutrittsschranke, die Wettbewerb verhindert. Befürworter betonen hingegen die Sicherung von Qualität und Ausbildungsleistung.
Welche Argumente sprechen für die Beibehaltung der Meisterpflicht?
Wesentliche Argumente sind der Verbraucherschutz durch hohe Qualitätsstandards, die Sicherung der dualen Ausbildung und die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Qualifikation.
Was änderte die Novellierung der Handwerksordnung?
Die Novellierung (z. B. 2004) führte zur Aufhebung des Inhaberprinzips, der Einführung der Altgesellenregelung und der Reduzierung der zulassungspflichtigen Handwerke.
Verstößt der Meisterbrief gegen die Berufsfreiheit?
Dies ist ein zentraler juristischer Streitpunkt. Gegner argumentieren mit Art. 12 GG, während Befürworter die Gemeinwohlrelevanz (Ausbildung, Qualität) als Rechtfertigung für den Eingriff anführen.
Welche Rolle spielt die EU-Osterweiterung für das Handwerk?
Sie verstärkte den Wettbewerbsdruck und die Debatte um Inländerdiskriminierung, da EU-Ausländer oft unter anderen Bedingungen in Deutschland tätig werden können als einheimische Meister.
- Quote paper
- Holger Rekow (Author), 2004, Der Meisterbrief - Hoffnung oder Hemmnis des deutschen Handwerks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180145