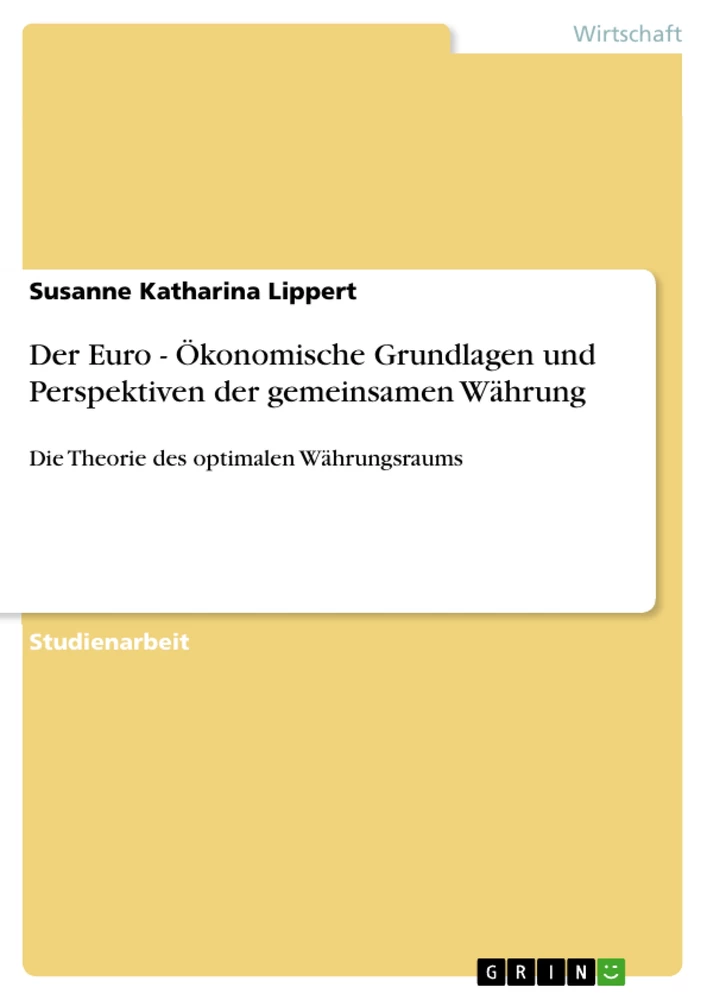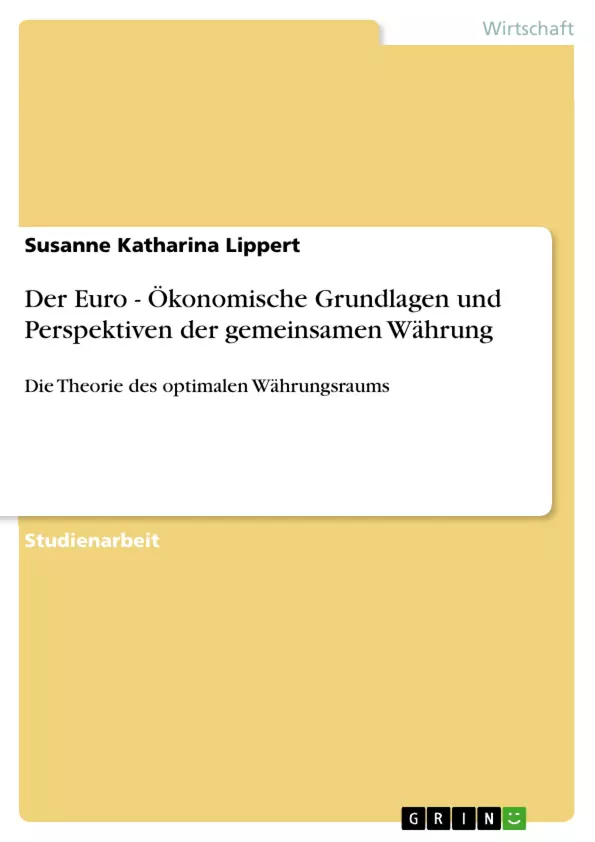Eine unabhängige Geldpolitik und die damit verbundene Möglichkeit des Ab- und Aufwertens der eigenen Währung, dient der Beseitigung von makroökonomischen Ungleichgewichten und dem relativ kostengünstigen Anpassungsprozeß aufgrund von Output- und Beschäftigungsveränderungen.
Bei Gründung einer Währungsunion muß ein Land seine nationale Währung aufgeben. Das bedeutet, daß es weder in der Lage ist eine autonome Geldpolitik zu betreiben, noch daß es auf das politische Instrument der Wechselkursänderung zurückgreifen kann.
Die „Theorie des optimalen Währungsraums“ analysiert unter welchen Bedingungen es für Länder trotzdem vorteilhaft sein kann, sich einer Währungsunion anzuschließen.
Denn das Instrument der Wechselkursänderung bringt, bei systematischer Anwendung zur Behebung von Ungleichgewichten, auch Gefahren mit sich, welche seine flexible Einsetzbarkeit einschränken.
Makroökonomische Instabilität und steigende Inflation, ohne Verbesserungen des Outputs und der Beschäftigung, können dann die Folge sein.
Zudem führen Anpassungsprozesse aufgrund von Wechselkursänderungen zu keinem stabilen wirtschaftlichen Gleichgewicht, da sie gesamtwirtschaftliche Mechanismen in Gang setzten, welche die anfänglichen Effekte wieder aufheben.
Trotzdem bleibt das Auf- und Abwerten einer Währung ein kraftvolles politisches Instrument, das einem Land bei außerordentlichen Störungen sehr nützlich sein kann. Der Verzicht darauf stellt Kosten einer Währungsunion dar.
Länder haben also abzuwägen, ob sich für sie eine Währungsunion wohlfahrtssteigernd oder wohlfahrtsmindernd auswirken wird.
Das ist von der wirtschaftlichen und politischen Situation aller einer Union beitretenden Länder abhängig.
Unter welchen Bedingungen Länder eine unabhängige Geldpolitik zu ihrem Vorteil aufgeben können, ob sich makroökonomische Ungleichgewichte auch ohne das Instrument der Wechselkursänderung beheben lassen können und wie die Dynamik gesamtwirtschaftlicher Anpassungsprozesse von der Wahl der genutzten politischen Instrumente abhängt, soll in der folgenden Arbeit aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen für einen optimalen Währungsraum
- Differenzen zwischen Ländern und deren Relevanz für eine Währungsunion
- Wie wahrscheinlich ist ein Nachfrageschock
- Unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Inflation und Arbeitslosigkeit
- Differenzen zwischen Institutionen des Arbeitsmarktes
- Differenzen zwischen Wachstumsraten
- Differenzen zwischen fiskalischen Systemen und das Inflationsproblem
- Effektivität von Wechselkursänderungen
- Abwertung, Zeitkonsistenz und Glaubwürdigkeit
- Die Kosten einer Währungsunion und die Offenheit von Ländern
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Voraussetzungen für einen optimalen Währungsraum und die Auswirkungen einer Währungsunion auf die makroökonomische Stabilität von Ländern. Sie untersucht, unter welchen Bedingungen es für Länder trotz des Verlusts einer unabhängigen Geldpolitik vorteilhaft sein kann, sich einer Währungsunion anzuschließen.
- Die Auswirkungen von Nachfrageschocks auf die Wirtschaft in einer Währungsunion
- Die Rolle von Lohnflexibilität und Arbeitsmobilität bei der Anpassung an makroökonomische Ungleichgewichte
- Die Bedeutung von fiskalpolitischen Instrumenten zur Stabilisierung der Wirtschaft in einer Währungsunion
- Die Kosten und Nutzen der Aufgabe einer unabhängigen Geldpolitik und der damit verbundenen Wechselkursflexibilität
- Die Dynamik gesamtwirtschaftlicher Anpassungsprozesse in Abhängigkeit von der Wahl der politischen Instrumente
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik einer Währungsunion und den Verlust der Möglichkeit zur unabhängigen Geldpolitik dar. Sie zeigt die Notwendigkeit der Analyse der Kosten und Nutzen einer Währungsunion auf.
- Voraussetzungen für einen optimalen Währungsraum: Dieses Kapitel beschreibt die Kriterien für einen optimalen Währungsraum, nämlich die Flexibilität der Löhne und die Mobilität der Arbeit. Es zeigt, wie diese Faktoren die Anpassung an makroökonomische Ungleichgewichte erleichtern können.
- Differenzen zwischen Ländern und deren Relevanz für eine Währungsunion: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Faktoren, die die Stabilität einer Währungsunion beeinflussen können, wie z.B. Unterschiede in den Nachfrageschocks, Inflationsraten, Arbeitsmärkten, Wachstumsraten und fiskalischen Systemen.
- Effektivität von Wechselkursänderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Wechselkursänderungen als Instrument zur Behebung von Ungleichgewichten und untersucht die damit verbundenen Risiken.
- Abwertung, Zeitkonsistenz und Glaubwürdigkeit: Hier wird die Problematik der Abwertung und deren Auswirkungen auf die Zeitkonsistenz und Glaubwürdigkeit der Wirtschaftspolitik untersucht.
- Die Kosten einer Währungsunion und die Offenheit von Ländern: Dieser Abschnitt beleuchtet die Kosten, die mit dem Verzicht auf eine unabhängige Geldpolitik verbunden sind, sowie den Einfluss der Offenheit von Ländern auf die Kosten einer Währungsunion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Währungsunion, optimalen Währungsräumen, makroökonomischen Ungleichgewichten, Lohnflexibilität, Arbeitsmobilität, fiskalpolitischen Instrumenten, Wechselkursänderungen, Zeitkonsistenz, Glaubwürdigkeit und Offenheit von Ländern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie des optimalen Währungsraums?
Diese Theorie analysiert die Bedingungen (wie Lohnflexibilität und Arbeitsmobilität), unter denen es für Länder vorteilhaft ist, ihre eigene Währung aufzugeben und einer Währungsunion beizutreten.
Welche Kosten entstehen durch den Beitritt zu einer Währungsunion?
Das Land verliert seine autonome Geldpolitik und das Instrument der Wechselkursänderung (Ab- oder Aufwertung), was die Anpassung an wirtschaftliche Schocks erschweren kann.
Warum sind Lohnflexibilität und Arbeitsmobilität wichtig?
Wenn Wechselkurse nicht mehr angepasst werden können, müssen wirtschaftliche Ungleichgewichte durch flexible Löhne oder die Abwanderung von Arbeitskräften in prosperierende Regionen ausgeglichen werden.
Wie wirken sich Nachfrageschocks in einer Währungsunion aus?
Ein asymmetrischer Nachfrageschock trifft ein Land härter, wenn es nicht mehr durch Abwertung reagieren kann, was zu höherer Arbeitslosigkeit führen kann, sofern keine fiskalischen Ausgleichssysteme bestehen.
Was bedeutet Zeitkonsistenz und Glaubwürdigkeit in der Geldpolitik?
Eine Währungsunion kann die Glaubwürdigkeit der Inflationsbekämpfung erhöhen, da einzelne Länder nicht mehr eigenständig Geld drucken oder abwerten können, um kurzfristige Ziele zu verfolgen.
- Quote paper
- Diplom Kauffrau Susanne Katharina Lippert (Author), 1999, Der Euro - Ökonomische Grundlagen und Perspektiven der gemeinsamen Währung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180154