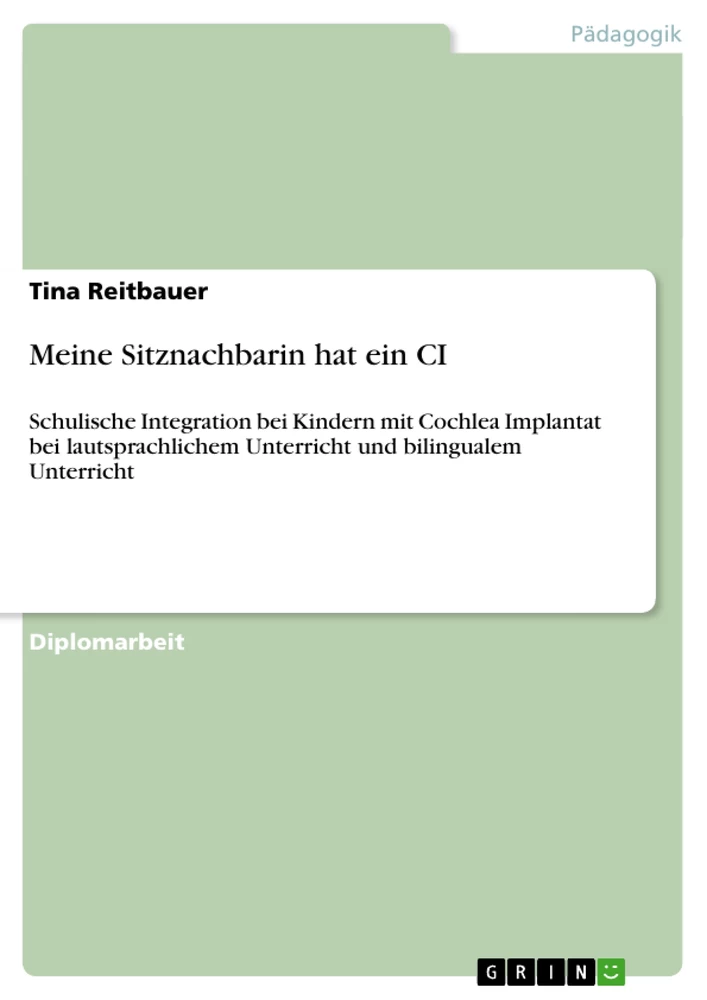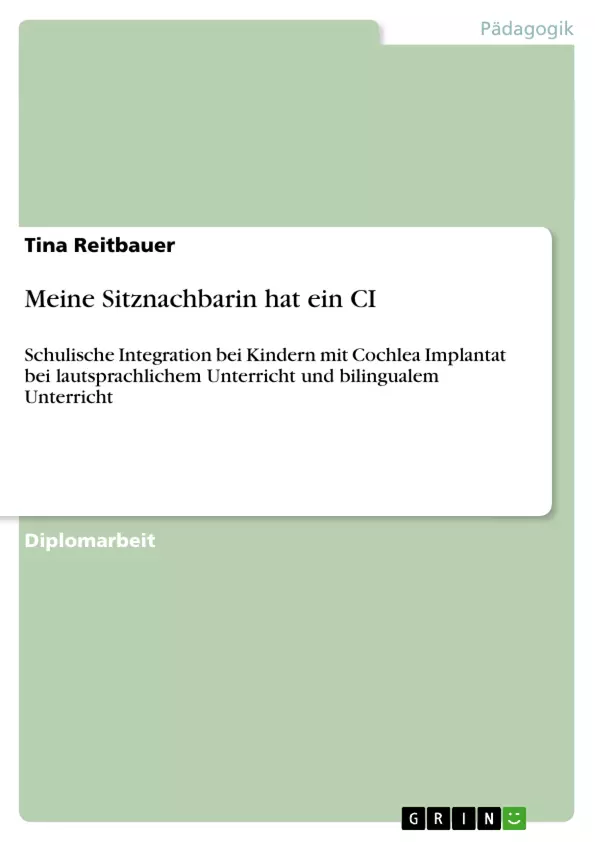Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Integration von Kindern mit Cochlea Implantat im schulischen Umfeld. Die Debatte ob hörbehinderte Kinder lautsprachlich oder laut- und gebärdensprachlich (bilingual) unterrichtet werden sollen, wurde in den vergangenen Jahrzehnten meist zugunsten eines rein lautsprachlichen Unterrichts entschieden. Vor allem von CI-Kindern wird eine gute Lautsprachentwicklung erwartet, zusätzliche Förderung durch Gebärdensprache wird meist abgelehnt. Es gibt aber auch Kritik seitens einzelner Eltern, LehrerInnen und HeilpädagogInnen an dieser Unterrichtspraxis – es wird ein bilingualer Unterricht gefordert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde herausgearbeitet inwieweit sich lautsprachlicher bzw. bilingualer Unterricht auf die soziale Integration von CI-Kindern im Klassenverband auswirkt. Durch teilnehmende Beobachtung und eine soziometrische Analyse wurden die Kommunikation, die sozialen Beziehungen und das schulische Wohlbefinden in zwei Vergleichsklassen untersucht. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2008). Im Wesentlichen konnte festgestellt werden, dass sich CI-Kinder in ihrer lautsprachlichen Kommunikationskompetenz stark voneinander unterscheiden und die Entscheidung für eine optimale Unterrichtspraxis nur individuell erfolgen kann. Für CI-Kinder mit schlechtem Hörvermögen und kaum oder nur geringen Lautsprachkenntnissen erwies sich das bilinguale Unterrichtsmodell als hilfreich für die soziale Integration. Aber auch bei gutem Hörvermögen und guten Lautsprachkenntnissen ist soziale Integration von CI-Kindern in einer Schulklasse nicht automatisch gewährleistet. Abschließend lässt sich festhalten, dass ein Ausbau an bilingualen Schulangeboten für hörbehinderte Kinder (mit/ohne CI) notwendig ist, um die heilpädagogische Aufgabe der sozialen Integration erfüllen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1 Begriffliche Abgrenzungen
- 1.1 Einteilung von Hörschädigungen
- 1.1.1 Klassifikation nach der Art der Hörschädigung
- 1.1.2 Klassifikation nach dem Ausmaß des Hörverlustes
- 1.1.3 Klassifikation nach der Ursache und dem Zeitpunkt des Eintretens einer Hörschädigung
- 1.1.4 Prä- und postlinguale Hörschädigung
- 1.2 Schwerhörig oder gehörlos/ertaubt?
- 1.3 Exkurs: Gebärdensprache als Teil der Gehörlosenkultur
- 1.4 Häufigkeit und Altersverteilung von Hörschädigungen
- 2 Das Cochlea Implantat
- 2.1 Was ist das CI?
- 2.2 Bestandteile und Funktion eines Cochlea Implantats
- 2.3 Voraussetzungen für die Implantation
- 2.4 Nachbetreuung von Cl-PatientInnen
- 2.5 Lautsprachentwicklung bei Kindern mit Cl
- 2.6 Ethische Bedenken gegenüber dem CI
- 3 Die Entwicklung der Gehörlosenbildung hinsichtlich lautsprachlichem und gebärdensprachlichem Unterricht
- 3.1 Institutionalisierte Bildung Gehörloser
- 3.2 Der ,,Methodenstreit''
- 3.3 Die Verallgemeinerungsbewegung
- 3.4 Derzeitige Schulsituation hörbehinderter Kinder in Österreich
- 3.4.1 Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen
- 3.4.2 Integrative Beschulung
- 3.4.3 Lautsprache versus Gebärdensprache
- 3.4.4 Bilinguale Integration
- 4 Schulische Integration von hörbehinderten Kindern und Jugendlichen
- 4.1 Soziale Integration
- 4.2 Soziale Beziehungen
- 4.3 Kommunikation
- 4.4 Schulisches Wohlbefinden
- 4.5 Entwicklung der Klassengemeinschaft
- 4.6 Zusammenfassung
- 5 Methodisches Vorgehen
- 5.1 Fragestellung
- 5.2 Auswahl der Schulklassen
- 5.3 Forschungsmethoden
- 5.3.1 Teilnehmende Beobachtung
- 5.3.2 Soziometrischer Test
- 5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse
- 6 Darstellung der Forschungsergebnisse
- 6.1 Schulischer Alltag und Beschreibung der Cl-Kinder
- 6.1.1 Beschreibung der Schulklassen
- 6.1.2 Beschreibung der Cl-Kinder
- 6.2 Soziale Beziehungen der Cl-Kinder
- 6.3 Kommunikation
- 6.4 Schulisches Wohlbefinden
- Resümee und Konsequenzen aus heilpädagogischer Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der schulischen Integration von Kindern mit Cochlea Implantat. Ziel ist es, die Auswirkungen des Cochlea Implantats auf die soziale Integration, die Kommunikation und das schulische Wohlbefinden dieser Kinder zu untersuchen.
- Die unterschiedlichen Arten von Hörschädigungen und die Bedeutung des Cochlea Implantats
- Die Entwicklung der Gehörlosenbildung und die Debatte um lautsprachlichen und gebärdensprachlichen Unterricht
- Die schulische Integration von hörbehinderten Kindern und Jugendlichen mit Fokus auf soziale Integration, Kommunikation und schulisches Wohlbefinden
- Die Forschungsmethoden und Ergebnisse der Untersuchung zur Integration von Kindern mit Cochlea Implantat
- Die Bedeutung der Ergebnisse für die heilpädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Begriffliche Abgrenzung von Hörschädigungen. Dabei werden unterschiedliche Klassifikationen von Hörschädigungen sowie die Begriffe Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit/Ertaubung erläutert. Außerdem wird die Bedeutung der Gebärdensprache als Teil der Gehörlosenkultur hervorgehoben.
- Das zweite Kapitel beleuchtet das Cochlea Implantat. Es wird auf die Funktionsweise, die Voraussetzungen für die Implantation und die Nachbetreuung von Cl-PatientInnen eingegangen. Zudem wird die Lautsprachentwicklung bei Kindern mit Cl diskutiert und ethische Bedenken gegenüber dem CI angesprochen.
- Das dritte Kapitel widmet sich der Entwicklung der Gehörlosenbildung. Hier werden die verschiedenen Ansätze in der Geschichte der Gehörlosenbildung, wie z.B. der Methodenstreit und die Verallgemeinerungsbewegung, beleuchtet. Darüber hinaus wird die derzeitige Schulsituation hörbehinderter Kinder in Österreich beschrieben.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der schulischen Integration von hörbehinderten Kindern und Jugendlichen. Es werden die Aspekte der sozialen Integration, der sozialen Beziehungen, der Kommunikation und des schulischen Wohlbefindens betrachtet.
- Das fünfte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Diplomarbeit. Es werden die Fragestellung, die Auswahl der Schulklassen und die verwendeten Forschungsmethoden erläutert.
- Das sechste Kapitel stellt die Ergebnisse der Forschungsarbeit dar. Es werden der schulische Alltag und die Cl-Kinder beschrieben, die sozialen Beziehungen der Cl-Kinder beleuchtet und die Ergebnisse zur Kommunikation und dem schulischen Wohlbefinden der Cl-Kinder präsentiert.
Schlüsselwörter
Hörschädigung, Cochlea Implantat, Schulische Integration, Lautsprache, Gebärdensprache, Soziale Integration, Kommunikation, Schulisches Wohlbefinden, Heilpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Cochlea Implantat (CI) und wie funktioniert es?
Ein CI ist eine elektronische Hörprothese für Gehörlose oder hochgradig Schwerhörige, die den Hörnerv direkt elektrisch stimuliert und so Höreindrücke ermöglicht.
Sollten CI-Kinder lautsprachlich oder bilingual unterrichtet werden?
Die Forschung zeigt, dass die Entscheidung individuell erfolgen sollte. Für Kinder mit geringeren Lautsprachkenntnissen kann ein bilinguales Modell (Laut- und Gebärdensprache) die soziale Integration fördern.
Garantieren gute Lautsprachkenntnisse die soziale Integration?
Nein, auch bei gutem Hörvermögen und guter Lautsprache ist die Integration in der Klassengemeinschaft nicht automatisch gewährleistet und bedarf pädagogischer Unterstützung.
Was versteht man unter prä- und postlingualer Hörschädigung?
Prälingual bedeutet, dass die Hörschädigung vor dem Spracherwerb eintrat, postlingual nach dem Erwerb der Sprache, was die Prognose für die Lautsprachentwicklung beeinflusst.
Welche ethischen Bedenken gibt es gegenüber dem CI?
Einige Kritiker aus der Gehörlosenkultur sehen im CI eine Bedrohung für die Gebärdensprache und die kulturelle Identität gehörloser Menschen.
- Citation du texte
- Tina Reitbauer (Auteur), 2010, Meine Sitznachbarin hat ein CI, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180177