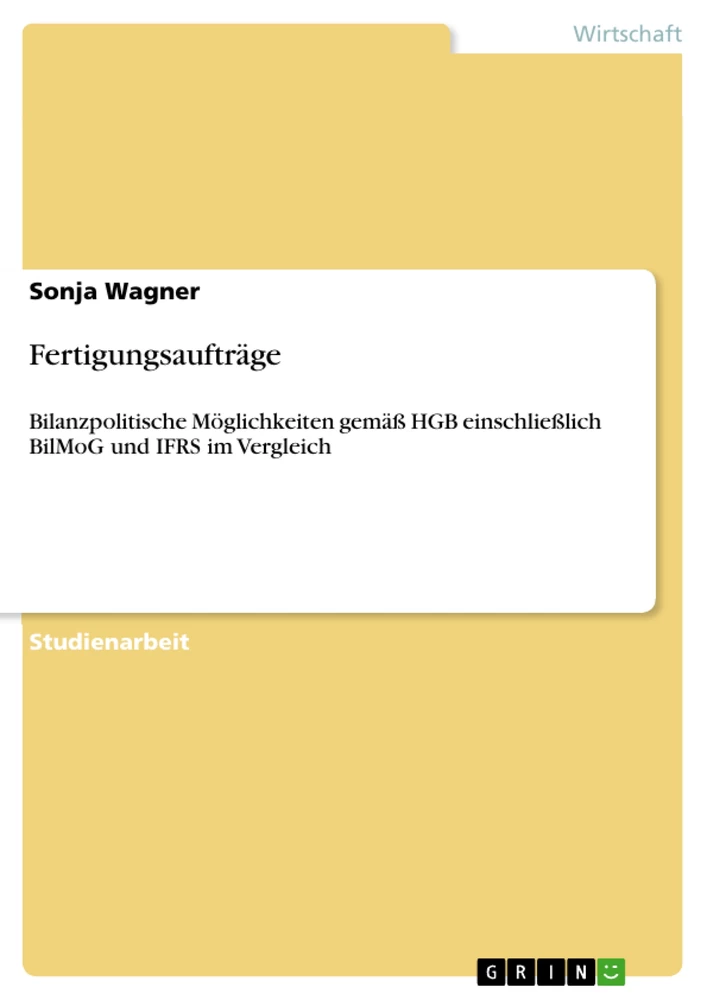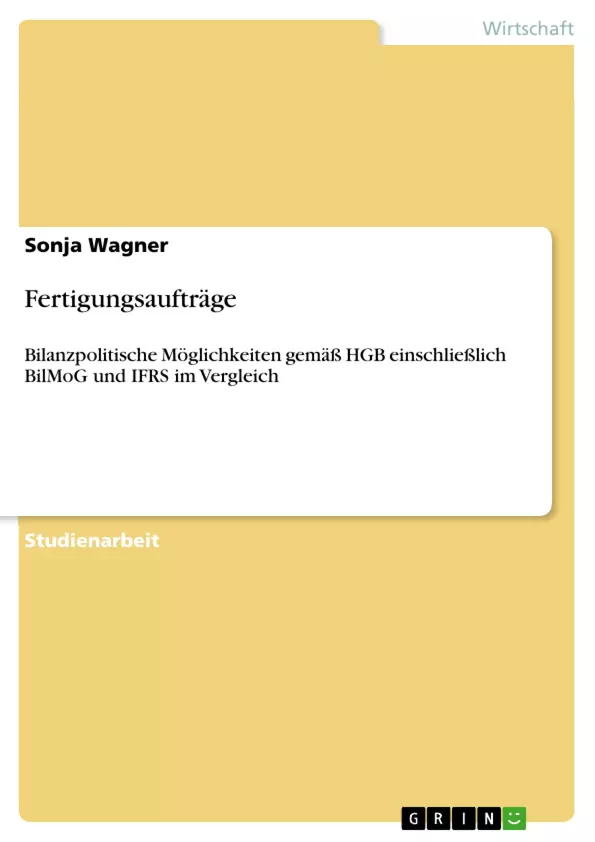Bei der Bilanzierung von Fertigungsaufträgen tritt folgendes Problem auf: Das Unternehmen erbringt möglicherweise über mehrere Jahre hinweg Leistungen, für die erst bei ihrer Fertigstellung ein Kaufpreis in Rechnung gestellt wird. Damit stellt sich die Frage, wie der Erfolg der entsprechenden Periode zugeordnet wird. Nach dem strengen Realisationsprinzip dürften der Umsatzerlös und der zugehörige Gewinn erst am Tag des Gefahrenübergangs an den Abnehmer ausgewiesen werden. Folge ist, dass der Ergebnisausweis in Abhängigkeit vom Fertigstellungszeitpunkt erheblichen Schwankungen im Zeitablauf unterliegt. Eine mögliche Problemlösung wäre eine Teilgewinnrealisierung, welche jedoch nicht dem Realisationsprinzip entspricht. Dabei wird der Gewinn bei Fertigungsaufträgen mit Gewinnaussichten nicht erst zum Zeitpunkt des Verkaufes, sondern anteilig in den vorangehenden Perioden der Fertigungsdauer berücksichtigt. Dieses Buch gibt Lösungen zu dieser Problematik gemäß HGB und BilMoG sowie IFRS.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition und Problematik von Fertigungsaufträgen
- 2. Bilanzierung gemäß HGB und BilMoG
- 2.1 Bewertung der Auftragskosten
- 2.2 Bilanzpolitische Methoden
- 2.2.1 Completed contract-Methode und deren Abwandlungen
- 2.2.2 Percentage of completion-Methode
- 2.3 Angaben im Anhang
- 3. Bilanzierung gemäß IFRS
- 3.1 Wahl der Bilanzierungsmethode anhand der Vertragstypen
- 3.2 Bewertung der Auftragserlöse und der Auftragskosten
- 3.3 Bilanzpolitische Methoden
- 3.3.1 Percentage of completion-Methode
- 3.3.2 Modifizierte completed contract-Methode
- 3.4 Angaben im Anhang
- 4. Abschließende Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Bilanzierung von Fertigungsaufträgen gemäß den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Er analysiert verschiedene Bilanzierungsmethoden und stellt die jeweiligen Vor- und Nachteile gegenüber.
- Definition und Problematik von Fertigungsaufträgen
- Bilanzierungsmethoden nach HGB und BilMoG
- Bilanzierungsmethoden nach IFRS
- Vergleich der Bilanzierungsmethoden
- Abschließende Würdigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition und Problematik von Fertigungsaufträgen
Dieses Kapitel definiert Fertigungsaufträge und beleuchtet die Herausforderungen, die sich bei ihrer Bilanzierung stellen. Der Text erklärt den Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Fertigungsaufträgen und skizziert die Relevanz von Grundsätzen wie dem Vorsichts- und Realisationsprinzip.
2. Bilanzierung gemäß HGB und BilMoG
Dieses Kapitel analysiert die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen gemäß den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Es stellt die verschiedenen Methoden vor, die für die Bewertung von Auftragskosten zur Anwendung kommen, darunter die Completed Contract-Methode, die Percentage of Completion-Methode und der Selbstkostenansatz. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dieser Methoden auf den Jahresabschluss erläutert.
3. Bilanzierung gemäß IFRS
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es erläutert die Auswahl der Bilanzierungsmethode in Abhängigkeit vom Vertragstyp und beleuchtet die Bewertung von Auftragserlösen und Auftragskosten. Das Kapitel behandelt außerdem die Percentage of Completion-Methode und die modifizierte Completed Contract-Methode im Kontext von IFRS.
Schlüsselwörter
Fertigungsaufträge, Bilanzierung, HGB, BilMoG, IFRS, Completed Contract-Methode, Percentage of Completion-Methode, Selbstkostenansatz, Auftragskosten, Auftragserlöse, Jahresabschluss, Bilanzpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem bei der Bilanzierung von Fertigungsaufträgen?
Da Leistungen oft über Jahre erbracht werden, stellt sich die Frage, wann der Gewinn ausgewiesen wird. Das Realisationsprinzip erlaubt dies eigentlich erst bei Fertigstellung, was zu schwankenden Ergebnissen führt.
Was ist die „Completed Contract-Methode“?
Bei dieser Methode werden Umsatzerlöse und Gewinne erst dann ausgewiesen, wenn der Auftrag vollständig abgeschlossen und die Gefahr auf den Käufer übergegangen ist.
Was bedeutet „Percentage of Completion“ (PoC)?
Die PoC-Methode erlaubt es, Gewinne anteilig nach dem Grad der Fertigstellung in den jeweiligen Perioden zu realisieren, was eine verstetigte Darstellung des Unternehmenserfolgs ermöglicht.
Wie unterscheiden sich HGB und IFRS in diesem Bereich?
Das HGB ist strenger am Vorsichtsprinzip orientiert und bevorzugt oft die Completed Contract-Methode. Die IFRS fordern bei verlässlicher Schätzbarkeit zwingend die Percentage of Completion-Methode.
Was änderte sich durch das BilMoG für Fertigungsaufträge?
Das BilMoG modernisierte das deutsche Bilanzrecht, hielt aber grundsätzlich am Realisationsprinzip fest, was die Teilgewinnrealisierung im Vergleich zu IFRS weiterhin einschränkt.
- Quote paper
- Sonja Wagner (Author), 2011, Fertigungsaufträge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180198