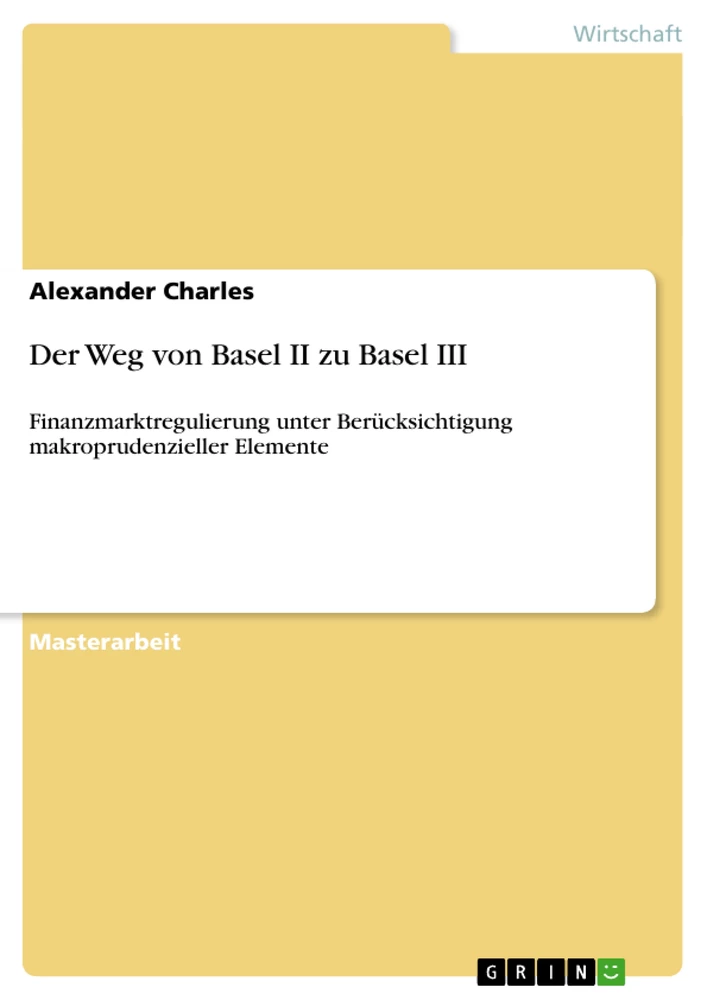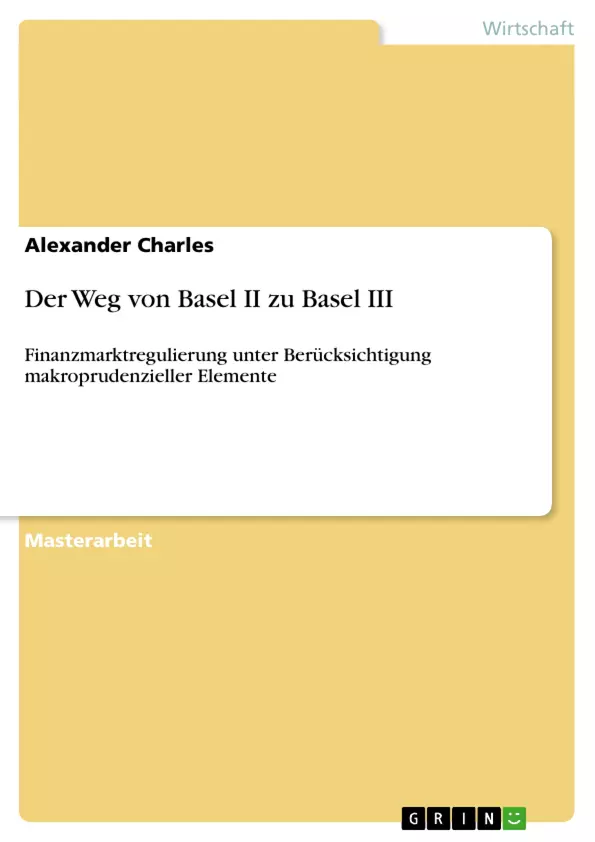Als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 besteht seit dem G20-Krisengipfel von Washington ein internationaler Konsens zur Reformierung des globalen Finanzsystems. Im Zuge der Krise wurden regulatorische Schwachstellen an Basel II ersichtlich. Seither arbeiten der BCBS sowie weitere Normengeber an Finanzmarktreformen, aus denen mitunter im Dezember 2010 die finale Fassung eines neuen Regulierungsrahmens hervorging: Basel III.
Innovativ an Basel III ist, dass erstmals ein internationales Regelwerk zur Bankenaufsicht und -regulierung mit einem Fokus auf das gesamte Finanzsystem angestrebt wird, ergänzend zu einer institutsbezogenen Betrachtung. Vorgesehen ist eine Kombination aus makroprudenziellen und mikroprudenziellen Elementen, zusätzlich Eigenkapitalanforderungen ergänzt um Liquiditätsstandards. Ziel ist es, eine nachhaltige Finanzstabilität unter Nutzung von Basel III zu gewährleisten.
Im Rahmen dieser Arbeit werden die makroprudenziellen Elemente, die auf dem Weg von Basel II zu Basel III ergänzt wurden, kritisch analysiert und bewertet. So werden zunächst Grundlagen sowie Schwachstellen des Basel II-Regelwerks erläutert, die als Basis für eine Untersuchung von Basel III dienen. In Kapital 3 werden der makroprudenzielle Ansatz sowie dessen Instrumentarium als potenzielle Maßnahme zur Förderung und Sicherung der Finanzstabilität beleuchtet. Darauf aufbauend werden in Kapitel 4 zunächst die Entwicklung von Basel II zu Basel III sowie die wesentlichen Ausgestaltungsmerkmale des neuen Regelwerks diskutiert. Anschließend erfolgen eine kritische Untersuchung sowie eine zusammenfassende Bewertung der in Basel III enthaltenen makroprudenziellen Elemente. Vervollständigend werden Implementierungsvorhaben sowie finanz- und realwirtschaftliche Auswirkungen von Basel III eruiert. Im Ausblick werden abschließend zum einen künftige Herausforderungen aufgezeigt.
Und zum anderen soll versucht werden, eine Antwort auf die Frage zu finden, die mit den Bemühungen um die Einführung von Basel III einhergeht: Kann Basel III zukünftige Krisen vermeiden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Basel II-Regelwerk und seine Schwachstellen im Lichte der Finanzmarktkrise
- Zielsetzung, Grundkonzept und Geltungsbereich von Basel II
- Die Schwachstellen von Basel II
- Prozyklizität im Finanzsystem
- Die Mindesteigenkapitalanforderungen
- Risikomessungen in Basel II
- Anzuwendende Bewertungspraktiken
- Systemrisiken im Finanzsystem
- Konzentrationen zusammenhängender Engagements
- Die Systemrelevanz von Instituten
- Das Leverage- und Liquiditätstrisiko
- Prozyklizität im Finanzsystem
- Der makroprudenzielle Ansatz
- Bedeutung und Merkmale
- Der Kern des makroprudenziellen Ansatzes
- Das makroprudenzielle Instrumentarium
- Instrumente unter dem Aspekt der Prozyklizität
- Instrumente unter dem Aspekt des Querschnittrisikos
- Basel III - Finanzmarktregulierung unter Berücksichtigung makroprudenzieller Elemente
- Der Weg zu Basel III
- Das Basel III-Regelwerk
- Makroprudenzielle Elemente in den Eigenkapitalvorschriften
- Elemente im Umgang mit dem aggregierten Risiko im Zeitverlauf
- Kapitalerhaltungspolster
- Antizyklische Kapitalpolster
- Höchstverschuldungsquote
- Elemente im Umgang mit dem Querschnittrisiko
- Der Umgang mit Kontrahentenrisiken und Vernetzungen
- Aktuelle Reformvorhaben systemischer Finanzinstitute
- Elemente im Umgang mit dem aggregierten Risiko im Zeitverlauf
- Makroprudenzielle Elemente in den Liquiditätsvorschriften
- Mindestliquiditätsstandard
- Strukturelle Liquiditätsquote
- Überwachungsinstrumente
- Zusammenfassende Bewertung der makroprudenziellen Elemente in Basel III
- Umsetzung und Übergangsregelungen von Basel III
- Eine Einschätzung der Auswirkungen von Basel III
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Weg von Basel II zu Basel III, der Finanzmarktregulierung unter Berücksichtigung makroprudenzieller Elemente. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Basel III-Regelwerks vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise zu untersuchen, die Schwächen des vorhergehenden Basel II-Regelwerks zu analysieren und die Integration makroprudenzieller Elemente in Basel III zu beleuchten.
- Die Schwachstellen von Basel II im Lichte der Finanzmarktkrise
- Der makroprudenzielle Ansatz und seine Bedeutung für die Finanzmarktregulierung
- Die Integration makroprudenzieller Elemente in Basel III
- Die Auswirkungen von Basel III auf das Finanzsystem
- Der Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Finanzmarktregulierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 widmet sich dem Basel II-Regelwerk und beleuchtet dessen Zielsetzung, Grundkonzept und Geltungsbereich. Im Anschluss werden die Schwachstellen des Regelwerks im Lichte der Finanzmarktkrise analysiert. Hierbei werden die Prozyklizität des Finanzsystems sowie die unzureichende Berücksichtigung von Systemrisiken im Fokus stehen. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem makroprudenziellen Ansatz, der als Reaktion auf die Finanzmarktkrise entstand. Es werden Bedeutung und Merkmale dieses Ansatzes sowie dessen Kern und Instrumentarium beleuchtet. Kapitel 4 behandelt das Basel III-Regelwerk und betrachtet die Integration makroprudenzieller Elemente in die Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften. Im Zentrum stehen die Auswirkungen auf das Finanzsystem und die zukünftige Entwicklung der Finanzmarktregulierung.
Schlüsselwörter
Finanzmarktregulierung, Basel II, Basel III, Finanzmarktkrise, makroprudenzielle Elemente, Prozyklizität, Systemrisiko, Eigenkapitalvorschriften, Liquiditätsvorschriften, Kontrahentenrisiko, Vernetzung, Systemrelevanz, Leverage, Liquidität, Rating, Risikomessung, Bewertungspraktiken, Bankenaufsicht.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die Entwicklung von Basel III?
Basel III entstand als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008, um regulatorische Schwachstellen von Basel II zu beheben und die globale Finanzstabilität zu stärken.
Was ist das Innovative am Basel III-Regelwerk?
Erstmals wird ein Fokus auf das gesamte Finanzsystem (makroprudenziell) gelegt, ergänzend zur Betrachtung einzelner Institute (mikroprudenziell).
Welche Schwachstellen hatte das Basel II-System?
Zu den Hauptschwächen gehörten die Prozyklizität des Finanzsystems sowie die unzureichende Berücksichtigung von Systemrisiken und Liquiditätsengpässen.
Welche makroprudenziellen Instrumente führt Basel III ein?
Dazu gehören Kapitalerhaltungspolster, antizyklische Kapitalpolster, eine Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio) und neue Liquiditätsstandards.
Kann Basel III zukünftige Krisen verhindern?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch im Ausblick, wobei das Ziel eine nachhaltige Finanzstabilität durch strengere Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften ist.
- Citar trabajo
- Alexander Charles (Autor), 2011, Der Weg von Basel II zu Basel III, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180234