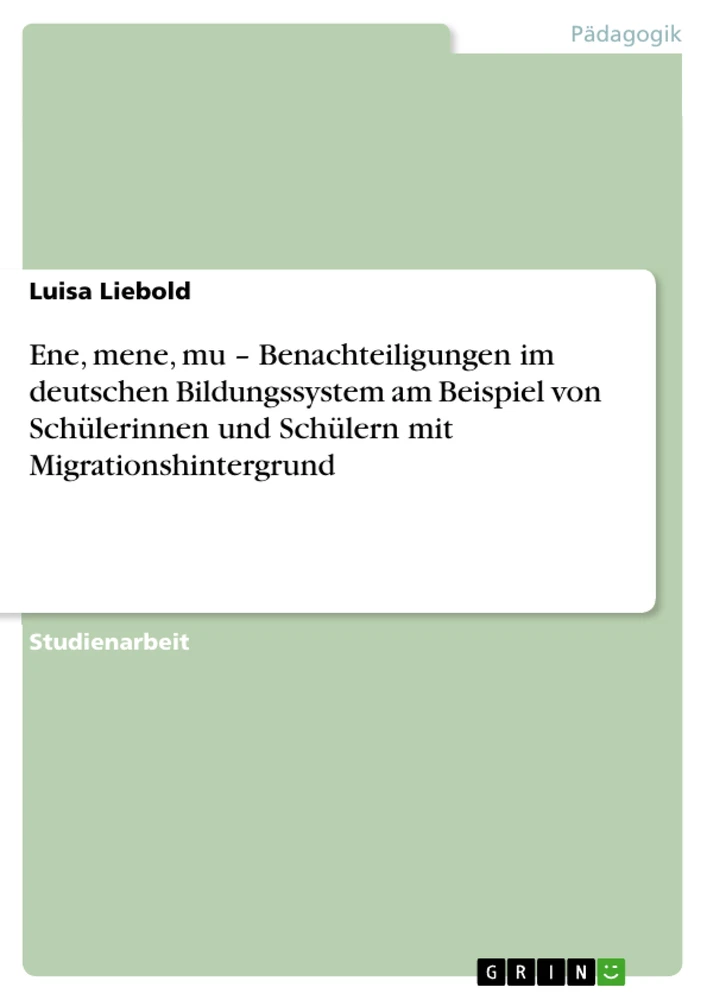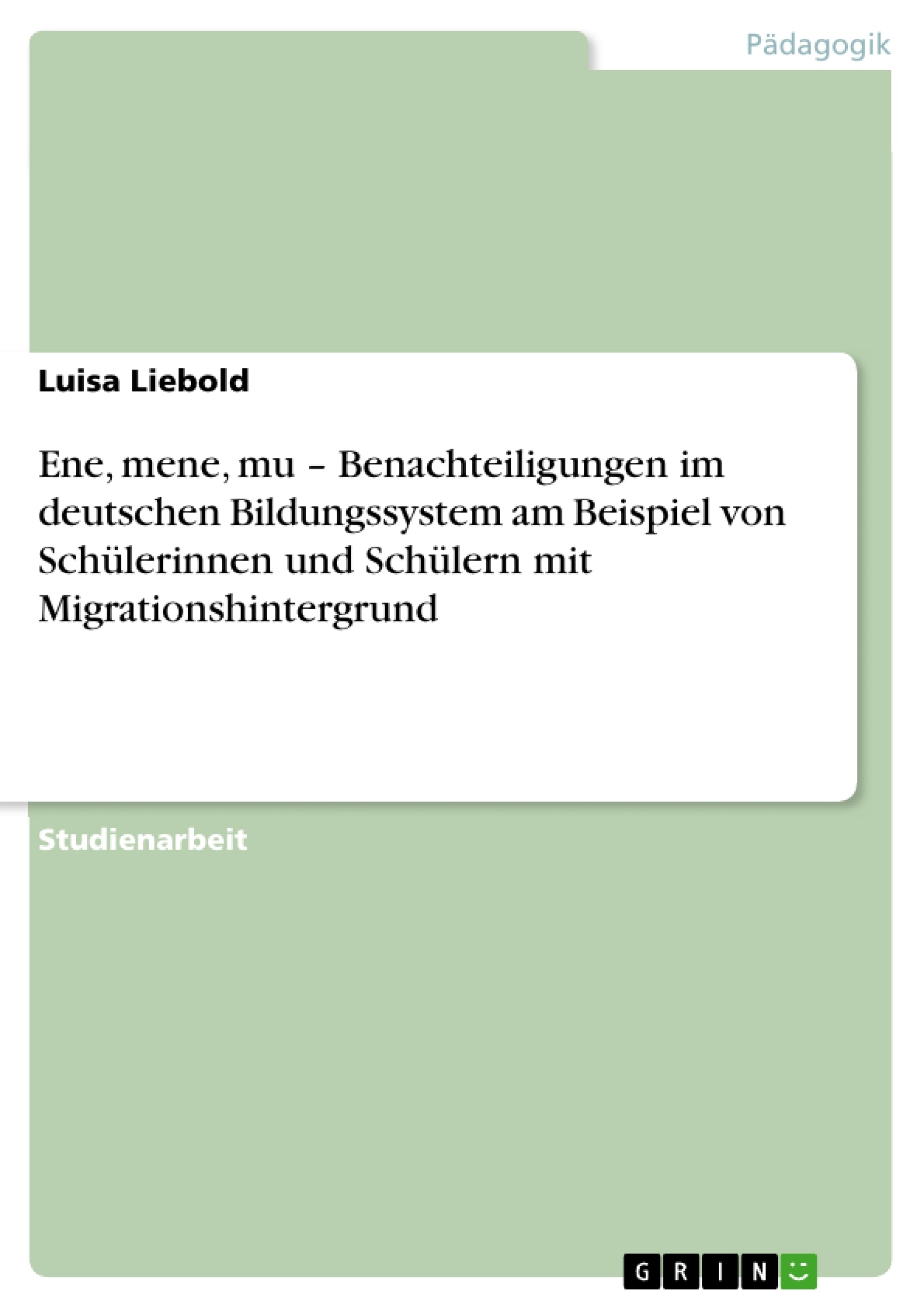Ene, mene, mu… - Willkürlich wie ein Kinderabzählreim scheint die Selektion im deutschen Schulsystem teilweise abzulaufen. Tatsächlich hat die Auslese jedoch etwas Systematisches. Nicht erst im Rahmen der bisherigen PISA-Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass im dreigliedrigen Bildungssystem einige Gruppen besonders benachteiligt werden, dass weder der Traum von der Leistungshomogenität erfüllt wurde noch Chancengleichheiten geschaffen worden sind.
Diese Seminararbeit stellt zunächst 1. Ungleichheiten im Bildungssystem dar. Anschließend wird der Fokus besonders auf Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gerichtet und aufgezeigt, welche 2. Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund produziert werden. Dabei wird herausgearbeitet, wie besonders sprachliche Defizite für Schwierigkeiten beim erfolgreichen Durchlaufen der Schule sorgen. Dass es der Schule dabei bisher nicht gelungen ist, entsprechend erfolgreiche Förderprogramme anzubieten, wird zum Anlass genommen, nach Möglichkeiten der sprachlichen Förderung im Vorschulbereich zu suchen. Dabei soll im letzten Teil dieser Arbeit 3. HIPPY – ein Lösungsansatz für mögliche Auswege aus dieser Situation bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ungleichheiten im deutschen Schulsystem
- 2. Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- 2.1. Ursachen für die Benachteiligung
- 2.1.1. Primäre und Sekundäre Herkunftseffekte
- 2.1.2. Diefenbachs Erklärungsansätze
- 2.1.3. Weitere mögliche Ursachen
- 2.1.4. Das Problem mit der Sprache
- 2.1. Ursachen für die Benachteiligung
- 3. HIPPY - ein Lösungsansatz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem und fokussiert dabei auf die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Sie analysiert die Ursachen dieser Benachteiligung, insbesondere den Einfluss von sprachlichen Defiziten. Abschließend werden Möglichkeiten der sprachlichen Förderung im Vorschulbereich mit dem HIPPY-Programm als Lösungsansatz präsentiert.
- Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem
- Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Ursachen für die Benachteiligung
- Sprachliche Defizite als Herausforderung
- HIPPY-Programm als Lösungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die ungleiche Selektion im deutschen Schulsystem, die besonders Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund benachteiligt. Kapitel 1 beschreibt die Struktur des dreigliedrigen Schulsystems und die damit verbundenen Ungleichheiten. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, analysiert die Ursachen, darunter primäre und sekundäre Herkunftseffekte, sowie die Rolle sprachlicher Defizite. Kapitel 3 stellt das HIPPY-Programm als Lösungsansatz zur Sprachförderung im Vorschulbereich vor. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Herausforderungen im Bildungssystem zu beleuchten und Lösungswege aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Bildungssystem, Ungleichheit, Benachteiligung, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, Sprachliche Defizite, HIPPY-Programm, Vorschulische Sprachförderung, Dreigliedriges Schulsystem.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem benachteiligt?
Die Benachteiligung resultiert aus systematischen Selektionsprozessen im dreigliedrigen Schulsystem, primären und sekundären Herkunftseffekten sowie unzureichenden Förderprogrammen für sprachliche Defizite.
Welche Rolle spielt die Sprache beim Schulerfolg?
Sprachliche Defizite gelten als eine der Hauptursachen für Schwierigkeiten beim erfolgreichen Durchlaufen der Schule, da das Bildungssystem stark auf sprachlichen Kompetenzen aufbaut und bisher kaum erfolgreiche Förderprogramme integriert hat.
Was versteht man unter primären und sekundären Herkunftseffekten?
Primäre Effekte beziehen sich auf die unmittelbare Abhängigkeit der Schulleistung vom sozialen Status, während sekundäre Effekte das Bildungsentscheidungsverhalten der Eltern beschreiben, das oft trotz gleicher Leistung je nach Schicht variiert.
Was ist das HIPPY-Programm?
HIPPY ist ein Lösungsansatz zur sprachlichen Förderung im Vorschulbereich. Es unterstützt Eltern dabei, ihre Kinder frühzeitig auf die Anforderungen der Schule vorzubereiten, um Bildungsbenachteiligungen entgegenzuwirken.
Bietet das deutsche Schulsystem echte Chancengleichheit?
Laut der Analyse der Seminararbeit und PISA-Untersuchungen wird das Ziel der Chancengleichheit bisher nicht erreicht, da die soziale Herkunft und der Migrationshintergrund weiterhin maßgeblich über den Bildungsweg entscheiden.
Was sind Diefenbachs Erklärungsansätze?
Diefenbach liefert wissenschaftliche Erklärungsmodelle für die Bildungsbenachteiligung von Migrantenkinder, die insbesondere die strukturellen Hürden und institutionelle Diskriminierung im deutschen Schulwesen beleuchten.
- Citar trabajo
- Luisa Liebold (Autor), 2011, Ene, mene, mu – Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem am Beispiel von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180305