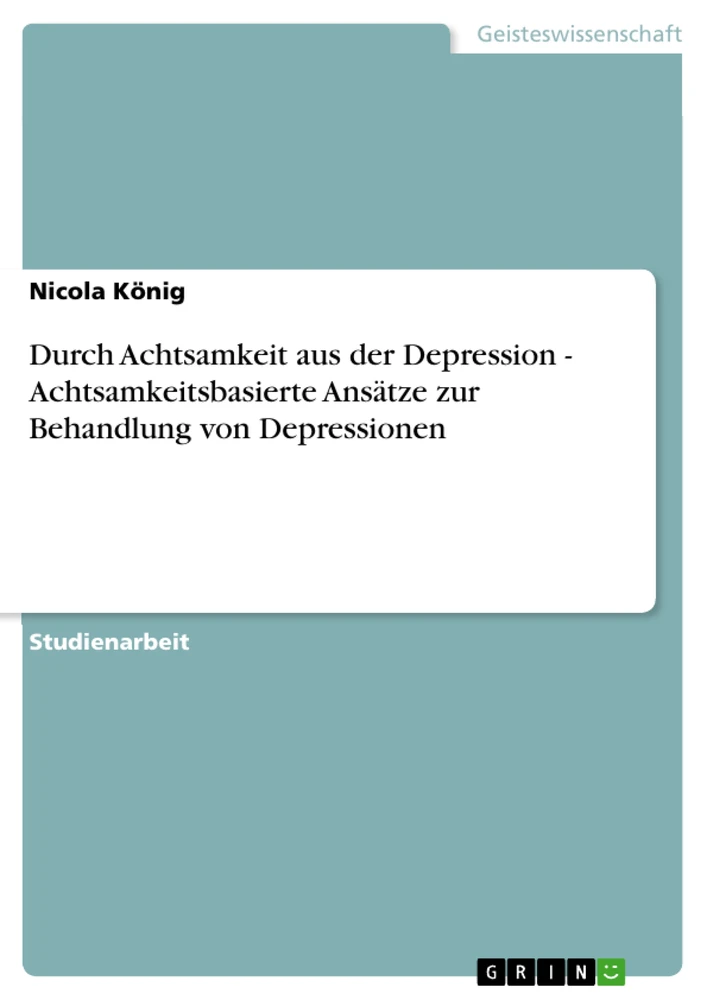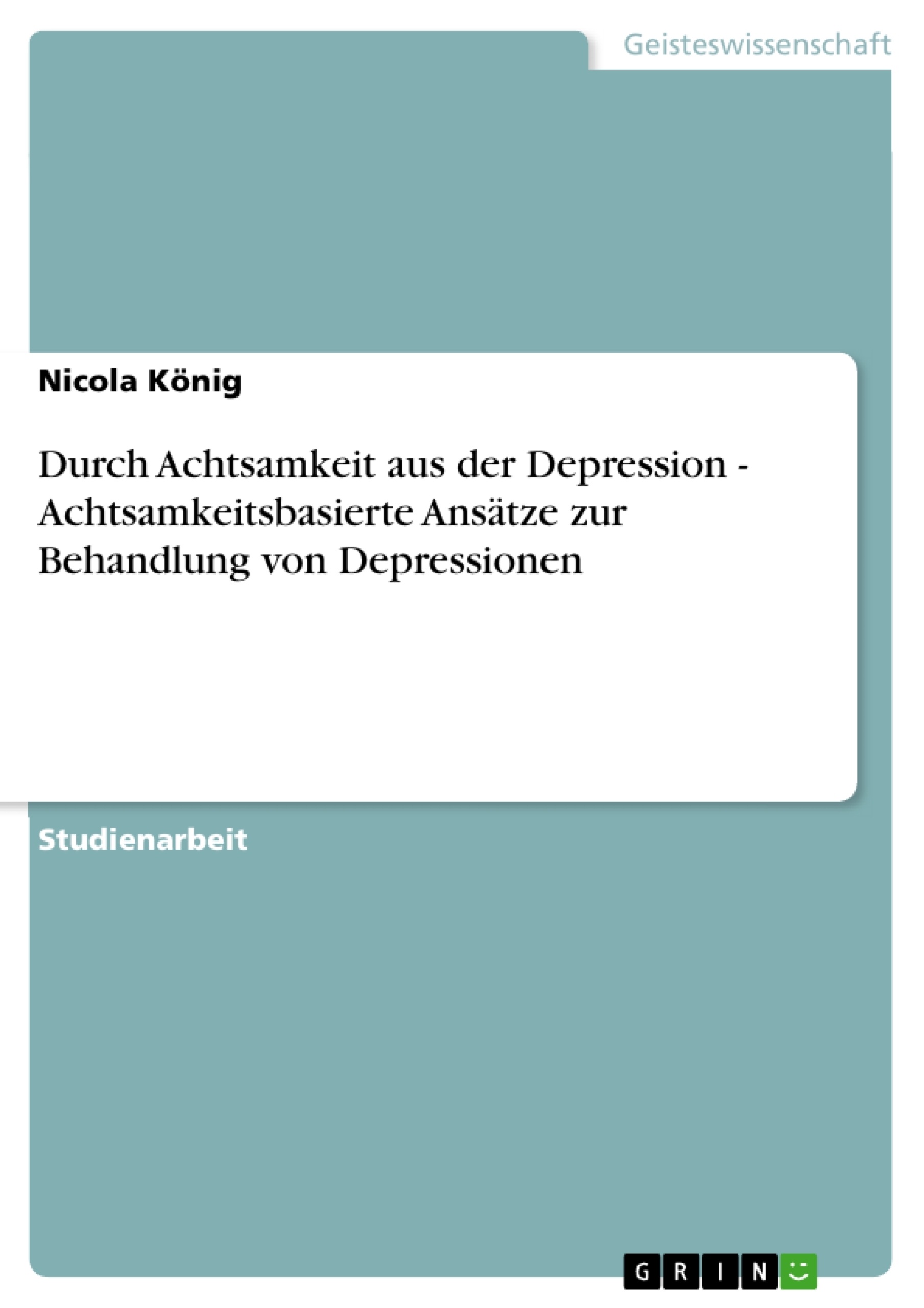Depressive Störungen sind weit verbreitet und gehören weltweit zu den wohl häufigsten Erkrankungen. Nach Schätzungen leiden in Deutschland mindestens 4 Millionen Menschen an dieser Diagnose.
Grob kann gesagt werden, dass sich bei etwa der Hälfte bis zwei Drittel derjenigen, bei denen die Erkrankung ausbricht, der Gesundheitszustand soweit bessert, dass sie wieder ihre Leistungsfähigkeit erreichen und das „alte“ Selbst wieder hervortritt, auch wenn einzelne Beschwerden oft weiter bestehen bleiben. Doch ist die Literatur zur Prognose der Krankheit uneinheitlich und es kann wegen der sehr heterogenen und methodisch wenig vergleichbaren Befundlage zu keiner klaren Aussage kommen, was den Ausgang der Depression betrifft. (Vgl. Mayer 2009) Dennoch gilt die Krankheit in der Regel als gut behandelbar und oft auch heilbar.
Der Behandlungsschwerpunkt liegt meist auf einer konstanten medikamentösen und psychotherapeutischen Ebene, welche derzeit die wichtigsten Säulen zur erfolgreichen Behandlung von Depressionen darstellen. (Vgl. Mayer 2009, Eberhardt-Metzger 2006) Doch gewinnt die Forschung immer neue Erkenntnisse über die Entstehung psychischer Erkrankungen und entwickelt damit auch neue Formen der Behandlung. So entstehen immer mehr alternative Behandlungsformen, die nicht alleine auf die medikamentöse Therapie abzielen, wie beispielsweise achtsamkeitsbasierte Ansätze.
Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit die aus der buddhistischen Tradition kommende Methode der Achtsamkeit als eine Behandlungsform bei Depressionen eine Rolle spielen und ob sie eine medikamentöse Therapie ersetzen kann.
Dazu werde ich darauf eingehen, welche Auswirkungen Achtsamkeit auf das psychische Wohlbefinden von Menschen hat und wie depressive Menschen im Hinblick auf ihre Gesundheit von ihr profitieren können. Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Achtsamkeit und seelischer Gesundheit von Menschen mit depressiven Störungen beschäftigen, sollen die Relevanz dieser alternativen Behandlungsform zeigen. Anschließend werde ich Möglichkeiten aufzeigen, wie die Soziale Arbeit sich dieser alternativen Methode in der Praxis bedienen kann und mit einem kurzen Fazit schließen.
Zunächst werde ich jedoch sowohl kurz in das Krankheitsbild Depression als auch in den Begriff der Achtsamkeit einführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Begrifflichkeiten
- Einführung in das Krankheitsbild Depression
- Definition, Symptome und Auswirkungen
- Epidemiologie
- Einführungen in den Begriff der Achtsamkeit
- Was ist Achtsamkeit?
- Achtsamkeit in unser Leben einbeziehen
- Einführung in das Krankheitsbild Depression
- Achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Bewältigung von Depressionen
- Ziele der Kultivierung von Achtsamkeit und die Bedeutung für das Wohlbefinden
- Die Anwendung dieser Erkenntnisse bei Menschen mit Depressionen
- Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion
- Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie
- Studienergebnisse zu MBSR und MBCT
- Wirksamkeit der MBSR
- Wirksamkeit der MBCT
- Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Achtsamkeit als Behandlungsform bei Depressionen. Das Ziel ist es, die Auswirkungen von Achtsamkeit auf das psychische Wohlbefinden von Menschen zu untersuchen und aufzuzeigen, wie depressive Menschen von dieser Methode profitieren können. Dabei werden Studien betrachtet, die den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und seelischer Gesundheit von Menschen mit depressiven Störungen beleuchten. Die Arbeit zeigt außerdem Möglichkeiten auf, wie die Soziale Arbeit achtsamkeitsbasierte Ansätze in der Praxis anwenden kann.
- Achtsamkeit als Behandlungsform bei Depressionen
- Auswirkungen von Achtsamkeit auf das psychische Wohlbefinden
- Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und seelischer Gesundheit
- Anwendungen von achtsamkeitsbasierten Ansätzen in der Sozialen Arbeit
- Studienergebnisse zu achtsamkeitsbasierten Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema Depressionen ein und beleuchtet deren weitverbreitete Natur. Sie stellt den Fokus der Arbeit auf die Frage nach der Rolle von Achtsamkeit bei der Behandlung von Depressionen dar. Die Einleitung stellt außerdem die wichtigsten Punkte der Arbeit und die Struktur der Kapitel dar.
Einführung in die Begrifflichkeiten
Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Krankheitsbild Depression und in den Begriff der Achtsamkeit. Es wird eine Definition von Depressionen gegeben, die Symptome werden beschrieben und die Auswirkungen auf die Betroffenen werden erläutert. Zudem wird die Verbreitung der Krankheit betrachtet. Im zweiten Teil des Kapitels wird der Begriff der Achtsamkeit definiert und erläutert, wie diese in den Alltag integriert werden kann.
Achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Bewältigung von Depressionen
Dieses Kapitel untersucht die Ziele der Kultivierung von Achtsamkeit und deren Bedeutung für das Wohlbefinden. Es beleuchtet, wie die Anwendung von Achtsamkeit bei Menschen mit Depressionen zum Einsatz kommt, insbesondere im Rahmen der Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR) und der Achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie (MBCT). Außerdem werden Studienergebnisse zu MBSR und MBCT vorgestellt, die die Wirksamkeit dieser Ansätze belegen. Schließlich wird die Relevanz von Achtsamkeit für die Soziale Arbeit hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Depression, Achtsamkeit, Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR), Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT), psychische Gesundheit, Wohlbefinden, Soziale Arbeit, Studienergebnisse, Wirksamkeit, Behandlungsformen.
Häufig gestellte Fragen
Kann Achtsamkeit eine medikamentöse Therapie bei Depressionen ersetzen?
Die Arbeit geht dieser Frage nach und untersucht, inwieweit achtsamkeitsbasierte Ansätze als ergänzende oder alternative Behandlungsform eine Rolle spielen können.
Was ist der Unterschied zwischen MBSR und MBCT?
MBSR (Stressreduktion) zielt allgemein auf den Umgang mit Stress ab, während MBCT (Kognitive Therapie) speziell entwickelt wurde, um Rückfälle bei depressiven Patienten zu verhindern.
Wie viele Menschen leiden in Deutschland an Depressionen?
Nach Schätzungen leiden in Deutschland mindestens 4 Millionen Menschen an einer depressiven Störung.
Welche Auswirkungen hat Achtsamkeit auf das psychische Wohlbefinden?
Achtsamkeit hilft, Grübeln zu reduzieren, die Selbstwahrnehmung zu verbessern und eine akzeptierende Haltung gegenüber schwierigen Emotionen zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei achtsamkeitsbasierten Ansätzen?
Die Soziale Arbeit kann diese Methoden in der Praxis nutzen, um Klienten bei der Krankheitsbewältigung und der Steigerung der Lebensqualität zu unterstützen.
- Quote paper
- Nicola König (Author), 2011, Durch Achtsamkeit aus der Depression - Achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Behandlung von Depressionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180373