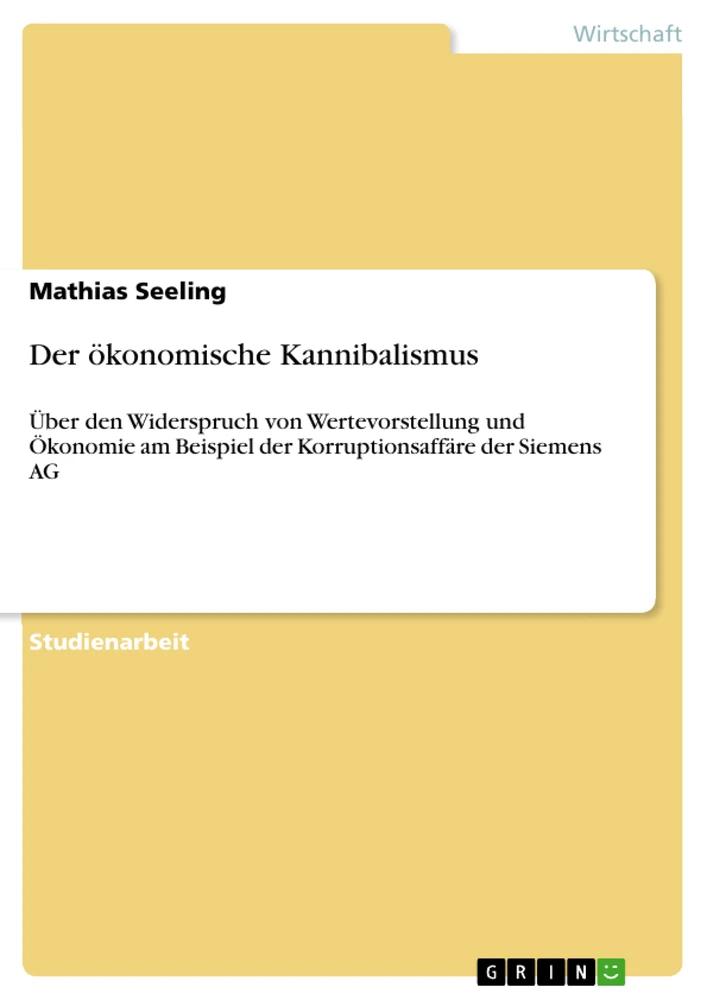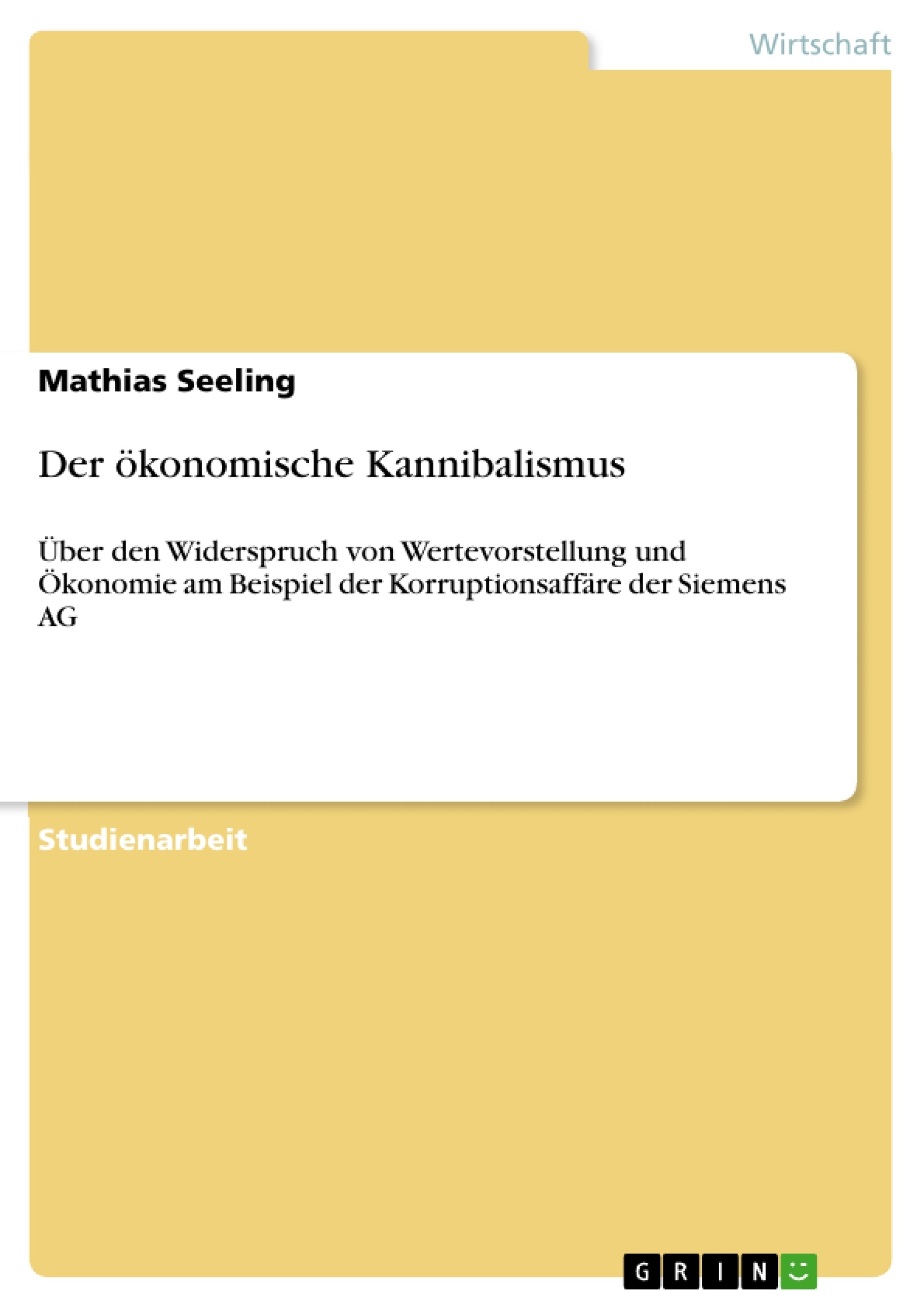Regeln und Verpflichtungen sind in unserer pluralistischen Gesellschaft wichtiger denn je.
Kriminelle Vorgänge im wirtschaftlichen Handeln waren dabei schon immer reizvoll, da sie der eigenen Vorteilslage einen enormen Gewinnzuwachs versprechen und somit die Hemmschwelle von immer mehr Geschäftsleuten senken. Allein durch diese Tatsache wird es schwierig, in einer solchen korrupten Wirtschaft mit ehrbaren, ausschließlich legalen Mitteln überleben zu können. Im modernen Wirtschaftszeitalter mit seinen globalen Vernetzungen und der damit verbundenen starken Konkurrenz untereinander, wird es für ein Unternehmen immer schwieriger, wichtige Aufträge zu erhalten. Zudem verschärft sich die Situation, wenn weltweit lokale Gesetzesunterschiede existieren, die zum Teil mit den Landesgesetzen des jeweiligen Unternehmenssitzes im Widerspruch stehen. In diesem Dilemma steht auch die Siemens AG: 'Bestechungsgelder'1 sind nach deutschen Wirtschaftsgesetzen eindeutig strafbar, seit einiger Zeit, aufgrund der Vorfälle in bis dato Grauzonen, auch für Bestechung im Ausland. In anderen Ländern, in denen das Unternehmen jedoch Großaufträge in Milliardenhöhe2 als unternehmerisch notwendige Tatsachen sieht, um eines der wichtigsten Wirtschaftsziele überhaupt, die Gewinnerzielung, erreichen und Konkurrent bleiben zu können. Oft ist es jedoch in anderen Ländern sogar üblich, sogenannte 'Motivationszahlungen' an Amtsträger zu zahlen, um an öffentlich ausgeschriebene Aufträge zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Zum Begriff Korruption
- 1.1 Funktion und Valenz im nationalen und internationalen Kontext
- 1.2 Der Kampf gegen Korruption und das Problem des individuell-rationalen Handelns
- 1.3 Ökonomischer Kannibalismus oder warum Unternehmen sich gegenseitig auffressen
- 2 Corporate Governance
- 2.1 Compliance
- 2.2 Verfolgung und Erfolg der Unterwelt
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den Widerspruch zwischen Wertevorstellungen und Ökonomie am Beispiel der Korruptionsaffäre der Siemens AG. Er analysiert die Funktionsweise und die Folgen von Korruption im nationalen und internationalen Kontext und befasst sich mit dem Problem des individuell-rationalen Handelns, das zu korrupten Verhaltensweisen führen kann. Der Essay beleuchtet auch die Rolle von Corporate Governance und Compliance bei der Verhinderung von Korruption und die Schwierigkeit, ein ethisches Verhalten in einem globalisierten und wettbewerbsorientierten Wirtschaftsumfeld zu gewährleisten.
- Der Widerspruch zwischen Wertevorstellungen und ökonomischen Interessen
- Die Funktionsweise und Folgen von Korruption im nationalen und internationalen Kontext
- Das Problem des individuell-rationalen Handelns in Bezug auf Korruption
- Die Rolle von Corporate Governance und Compliance bei der Korruptionsprävention
- Die Schwierigkeiten, ein ethisches Verhalten in einem globalisierten und wettbewerbsorientierten Wirtschaftsumfeld zu gewährleisten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Korruption in der Wirtschaft dar und zeigt auf, wie kriminelle Vorgänge im wirtschaftlichen Handeln die Hemmschwelle von Geschäftsleuten senken können. Der Essay fokussiert auf die Siemens AG und deren Korruptionsaffären, wobei insbesondere die Unterschiede zwischen deutschen und internationalen Gesetzen im Bereich der Bestechung betrachtet werden.
- 1 Zum Begriff Korruption: Dieses Kapitel behandelt den Begriff der Korruption und unterscheidet zwischen alltäglicher Korruption und einer globalen "Abart" einer Bakschisch-Wirtschaft. Es wird argumentiert, dass Korruption im Allgemeinen zu Lasten des Allgemeinwohls geht und dass auch Unternehmen, die korrupt handeln, langfristig negative Folgen tragen können.
- 1.1 Funktion und Valenz im nationalen und internationalen Kontext: Dieses Unterkapitel analysiert die Funktion und die unterschiedlichen Auswirkungen von Korruption in verschiedenen Ländern und Kontexten. Es wird argumentiert, dass Korruption in einem globalisierten Umfeld besondere Herausforderungen für Unternehmen schafft, da sie oft mit unterschiedlichen Gesetzen und Moralvorstellungen konfrontiert werden.
- 1.2 Der Kampf gegen Korruption und das Problem des individuell-rationalen Handelns: Dieses Unterkapitel befasst sich mit dem Problem des individuell-rationalen Handelns, das zu korrupten Verhaltensweisen führen kann. Es wird untersucht, wie Unternehmen und staatliche Stellen versuchen, Korruption zu bekämpfen, und welche Schwierigkeiten dabei auftreten können.
- 1.3 Ökonomischer Kannibalismus oder warum Unternehmen sich gegenseitig auffressen: Dieses Unterkapitel beschreibt, wie Korruption dazu führen kann, dass Unternehmen sich gegenseitig "auffressen", indem sie illegale Mittel einsetzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
- 2 Corporate Governance: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konzepten von Corporate Governance und Compliance und deren Rolle bei der Verhinderung von Korruption. Es wird argumentiert, dass Unternehmen klare Regeln und Vorschriften brauchen, um ethisches Verhalten zu fördern und Korruption zu vermeiden.
- 2.1 Compliance: Dieses Unterkapitel geht auf die Bedeutung von Compliance-Programmen für Unternehmen ein und zeigt, wie diese dazu beitragen können, die Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards zu gewährleisten.
- 2.2 Verfolgung und Erfolg der Unterwelt: Dieses Unterkapitel beschreibt die Schwierigkeiten, Korruption aufzudecken und zu verfolgen, und die Tatsache, dass die "Unterwelt" häufig erfolgreich ist, da sie mit illegalen Methoden arbeitet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind Korruption, Unternehmensethik, Corporate Governance, Compliance, individuell-rationales Handeln, globalisierung, Wettbewerb, Siemens AG, Bestechung, Bakschisch-Wirtschaft, Moral, Gesetz, Wertevorstellung, Ökonomie, Gewinnmaximierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „ökonomischer Kannibalismus“?
Der Begriff beschreibt ein Szenario, in dem Unternehmen illegale Mittel wie Korruption einsetzen, um Konkurrenten zu verdrängen, was langfristig dem Markt und dem Gemeinwohl schadet.
Welche Rolle spielt die Siemens AG in diesem Essay?
Die Siemens AG dient als Fallbeispiel für eine große Korruptionsaffäre, bei der Schmiergelder gezahlt wurden, um internationale Aufträge zu sichern, was zu massiven rechtlichen Konsequenzen führte.
Was ist der Unterschied zwischen Korruption und „Motivationszahlungen“?
In manchen Kulturen sind kleine Zahlungen (Bakschisch) üblich. Nach deutschem Recht und modernen Compliance-Regeln sind solche Zahlungen jedoch als Bestechung strafbar, auch wenn sie im Ausland erfolgen.
Warum ist Compliance für Unternehmen so wichtig?
Compliance stellt sicher, dass alle Mitarbeiter Gesetze und ethische Standards einhalten. Es schützt das Unternehmen vor Strafzahlungen, Imageverlust und dem Risiko des „ökonomischen Kannibalismus“.
Kann ein Unternehmen in einer korrupten Welt ehrlich überleben?
Das ist das zentrale Dilemma. Der Essay untersucht, wie der Druck zur Gewinnmaximierung ethisches Handeln erschwert, betont aber die Notwendigkeit von Corporate Governance zur langfristigen Stabilität.
- Citation du texte
- Baccalaureus Artium Mathias Seeling (Auteur), 2011, Der ökonomische Kannibalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180375