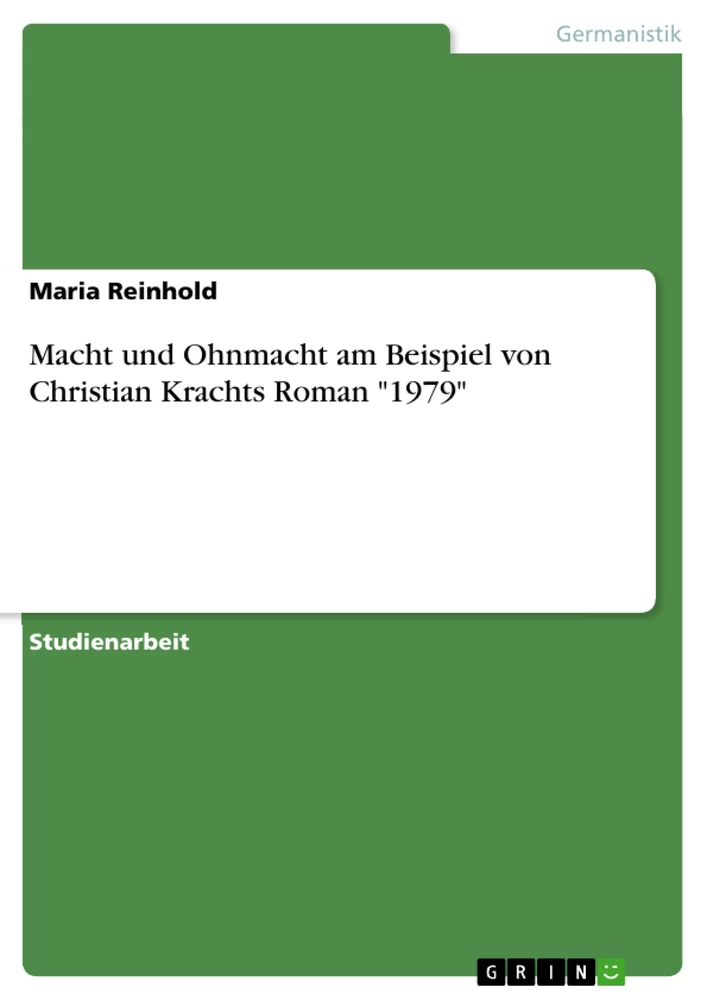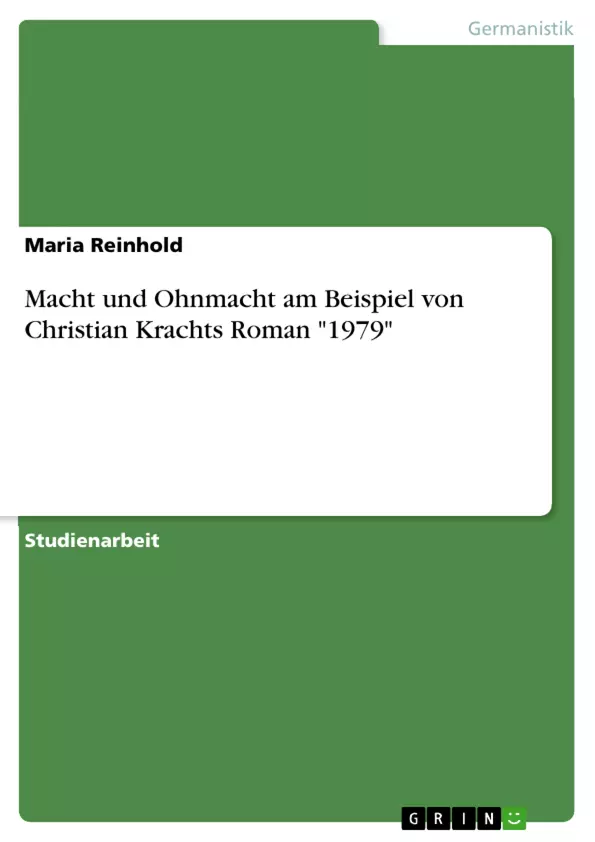Seit Christian Kracht, 1966 in Gstaad (Schweiz) geboren, 1995 den Roman
‚Faserland’ veröffentlichte, gilt er bei vielen Kritikern als Wegbereiter und
„Speerspitze“ der so genannten Popkultur.
Seine Werke zeichnen sich vor allem durch eine gewollte Distanz, einen trockenen,
aber eindringlichen Ton und einen beinahe schon grotesken Sinn für Ästhetik aus, so
auch in dem 2001 erschienen Roman ‚1979’, eine zutiefst zynische und trostlose
Abhandlung; eine Parodie auf die dekadente Gesellschaft der westlichen Zivilisation,
kollidierend mit dem Elend einer völlig fremden Welt.
Die Reise des namenlosen Ich-Erzählers, eines jungen, deutschen Innenarchitekten
und seines Freundes Christopher beginnt in Teheran, am Vorabend der islamischen
Revolution, und endet nach einer schicksalhaften Begegnung mit einem Rumänen
namens Mavrocordato und dem Tod Christophers mit einer Pilgerfahrt nach Tibet und
der Gefangennahme des Protagonisten. Die Geschichte einer Reise, wie sie seltsamer
nicht sein könnte, heiserer, verzweifelter Aufschrei nach einer Auflösung des Selbst,
nach Unterwerfung, Kasteiung, Auskostung der Angst.
Kracht thematisiert die Dekadenz und Orientierungslosigkeit einer gesamten
Generation durch die Auslassung von Hintergründen und einer sanftmütigen
Teilnahmslosigkeit, mit der der Protagonist diesen Albtraum nicht nur vorbeiziehen
lässt, sondern ihn auch bewusst miterlebt, gar genießt.
Diese Arbeit beschäftigt sich nun mit dem Verhaltensmuster des Ich-Erzählers
gegenüber seiner Umgebung, welches sich stets in den selben Bahnen bewegt, und
mit der Steigerung der Unterwerfung bis zur völligen Zerstörung. Als Textvorlage
dienen die Kapitel 1 – 7 sowie 10 – 12.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verhältnis zwischen Christopher und dem Protagonisten
- Die Begegnung mit Mavrocordato und der Tod Christophers
- Reformierung des Gedankensgutes oder das Ende in chinesischer Gefangenschaft
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhaltensmuster des Ich-Erzählers in Christian Krachts Roman "1979", insbesondere seine Unterwerfung gegenüber seinem Reisegefährten Christopher. Die Arbeit untersucht, wie der Protagonist die Dekadenz und Orientierungslosigkeit seiner Generation durch die Auslassung von Hintergründen und eine distanzierte Haltung gegenüber der Welt verkörpert. Dabei wird die Frage beleuchtet, inwieweit der Protagonist durch seine Selbstzerstörung eine Form von Sicherheit sucht.
- Die Beziehung zwischen dem Protagonisten und Christopher
- Die Rolle der Dekadenz und Orientierungslosigkeit
- Die Suche nach Sicherheit durch Unterwerfung
- Die Auswirkungen von Macht und Ohnmacht
- Die Selbstzerstörung des Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 – 7: Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung des Protagonisten als „moralisches und physisches Intelligenzvakuum", der sich hauptsächlich mit den Oberflächlichkeiten des Lebens beschäftigt. Die Dekadenz und Orientierungslosigkeit des Protagonisten werden durch seine Desinteresse an den politischen Ereignissen des Jahres 1979 und seine Konzentration auf Luxusgüter und Drogenpartys deutlich.
- Kapitel 10 – 12: Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen dem Protagonisten und Christopher, die durch ein Machtspiel geprägt ist, bei dem der Protagonist die Rolle des Gehorsamen und Christopher die des Befehlenden einnimmt. Die Arbeit analysiert die Abhängigkeit des Protagonisten von Christopher und die Rolle, die Christopher in der Konstruktion der Wirklichkeit des Protagonisten spielt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Dekadenz, Orientierungslosigkeit, Macht, Ohnmacht, Unterwerfung, Selbstzerstörung, sowie dem Verhältnis zwischen Protagonist und Christopher in Christian Krachts Roman "1979".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Christian Krachts Roman "1979"?
Der Roman ist eine zynische Abhandlung über die dekadente westliche Gesellschaft, dargestellt am Beispiel eines namenlosen Ich-Erzählers auf einer Reise durch Teheran während der islamischen Revolution bis hin zur Gefangenschaft in Tibet.
Welche zentralen Themen analysiert die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Macht und Ohnmacht, Unterwerfung, Dekadenz, Orientierungslosigkeit einer Generation und die bewusste Selbstzerstörung des Protagonisten.
Wie wird das Verhältnis zwischen dem Protagonisten und Christopher beschrieben?
Es handelt sich um ein Machtspiel, in dem der Protagonist die Rolle des Gehorsamen einnimmt und Christopher die des Befehlenden, was eine tiefe Abhängigkeit verdeutlicht.
Was symbolisiert die Figur des Mavrocordato?
Mavrocordato ist eine schicksalhafte Begegnung, die nach Christophers Tod zur Pilgerfahrt des Protagonisten nach Tibet und seiner späteren Gefangennahme führt.
Welche Rolle spielt die Dekadenz im Roman?
Die Dekadenz wird durch das Desinteresse des Protagonisten an politischen Umwälzungen und seine Konzentration auf Luxusgüter und Drogen inmitten von Elend und Revolution dargestellt.
Warum sucht der Protagonist Sicherheit durch Unterwerfung?
In einer Welt voller Orientierungslosigkeit bietet die totale Unterwerfung unter eine äußere Macht oder Person eine Form von perverser Stabilität und Auflösung des überforderten Selbst.
- Citar trabajo
- Maria Reinhold (Autor), 2009, Macht und Ohnmacht am Beispiel von Christian Krachts Roman "1979", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180394