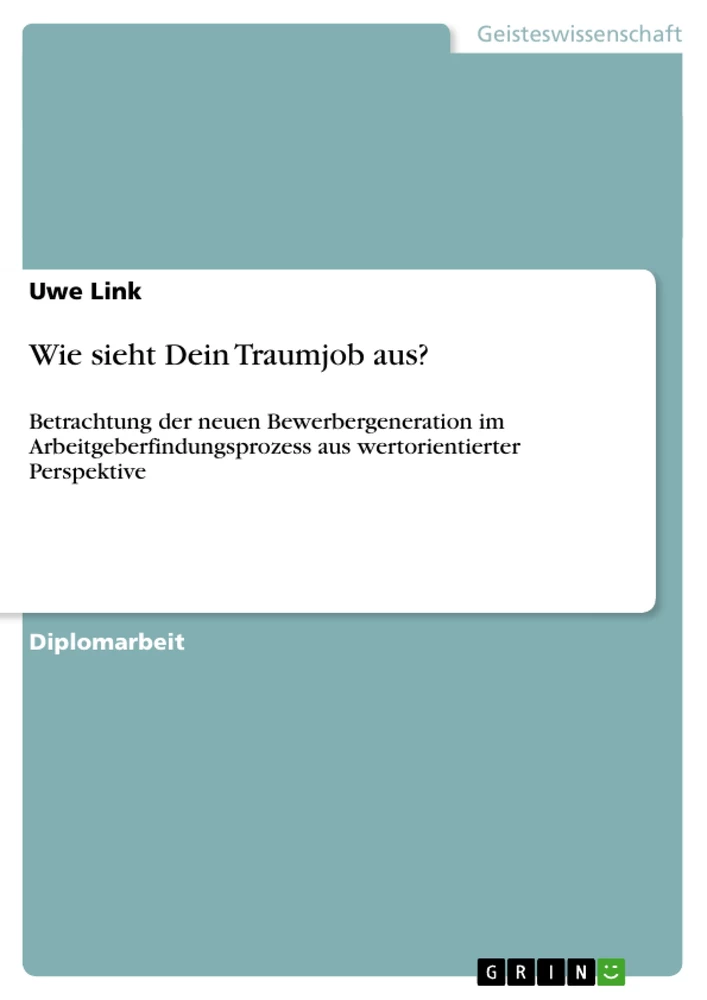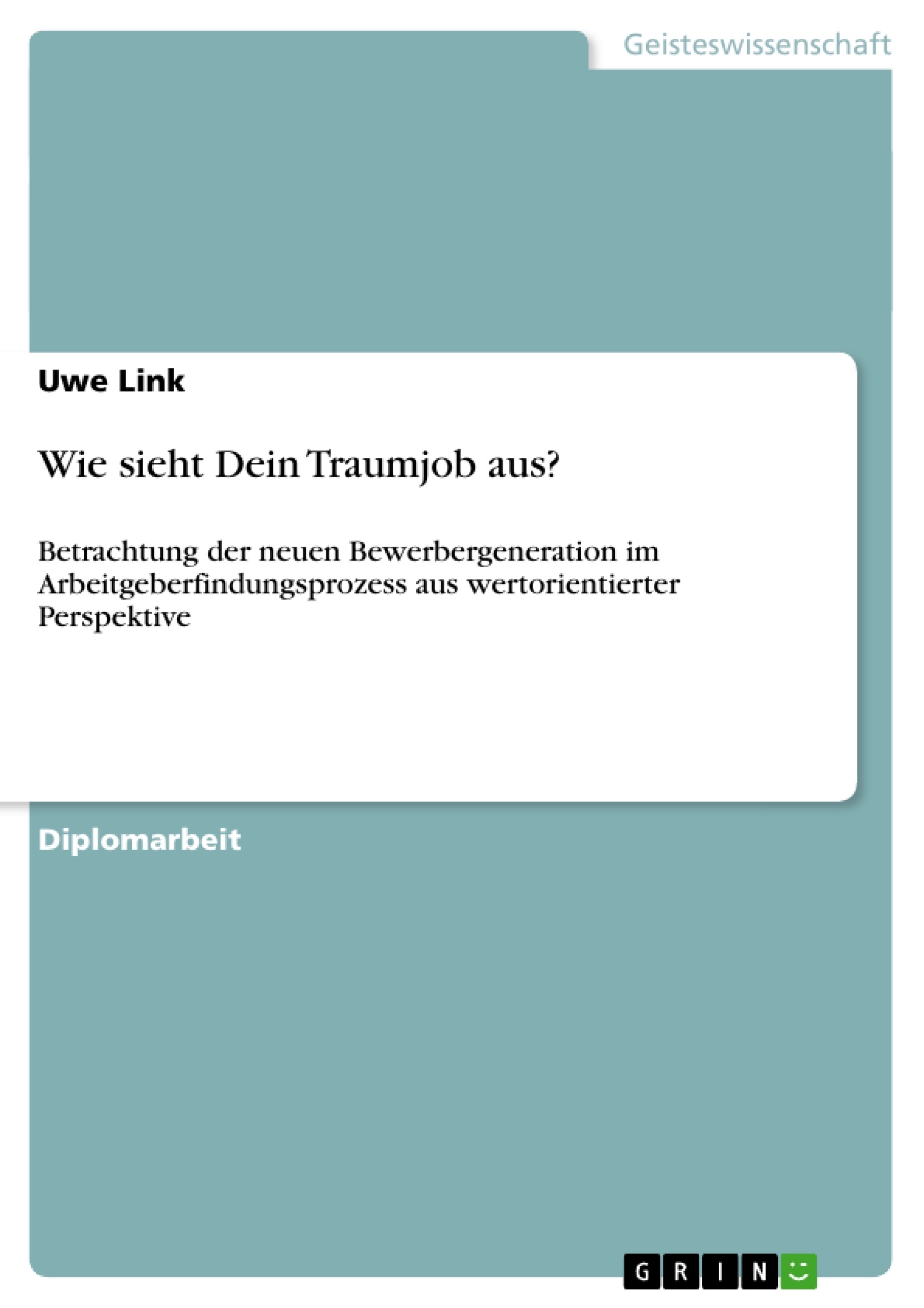In Zeiten des demografischen Wandels und des War for Talents ist es sowohl für Großunternehmen als auch Mittelständler von großer Bedeutung die Bedürfnisse und Anforderung der aktuellen Bewerbergeneration, welche ihnen unter dem Begriff Generation Y geläufig sein wird, zu kennen und entsprechende personalstrategische Entscheidungen einleiten zu können. Neben den oft eindimensionalen und stereotyp-behafteten Artikeln aus läufigen Fachzeitschriften existieren nur sehr teure und nicht wissenschaftlich, sondern wirtschaftlich getriebene Umfragen, die Einblicke in das Verhalten der Studierenden und Absolventen liefern sollen. Im Kontext meiner Diplomarbeit ist in Kooperation mit einem internationalem Chemie- und Pharmakonzern die folgende Studie entstanden, die auf Grundlage einer Umfrage unter 432 Studierenden (Fachgruppen Biologe und Chemie; jedoch stehen die Ergebnisse für die Bedürfnisse der gesamten Generation an Studierenden) folgende Einblicke liefert: ? Welche Kriterien spielen bei der Betrachtung von Stellenausschreibungen aus Bewerbersicht eine Rolle und wie werden diese priorisiert (Conjoint Analyse) ? Welche Inhalte müssen angesprochen werden um als attraktiver Arbeitgeber darzustehen (Semantische Differenzial-Analyse) ? Wie müssen Mitarbeiterprofile strukturell gestaltet werden, um generationskonforme Werte zu vermitteln und Studierende zu einer Bewerbung zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wertewandel aus der soziologischen Perspektive
- Begriffsdefinition und Funktion von Werten und Normen
- Wertewandeltheorie nach Inglehart
- Kritik und Modifikationen des Inglehart-Ansatzes
- Generation Y - Die aktuelle Generation?
- Wer ist die Generation Y
- Warum die Generation Y so ist wie sie ist
- Generationen im Kontext - Von X bis Y
- Der Arbeitsmarkt – Treffpunkt von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Allgemeine Arbeitsmarktsituation
- Arbeitsmarktsituation aus Arbeitnehmer-/ Bewerbersicht
- Arbeitsmarktsituation aus Arbeitgeber-/ Unternehmenssicht
- Besonderheiten des Arbeitsmarktes für Naturwissenschaftler
- Employer Branding – Verstehe ich Sie da richtig?
- Positionierung der Arbeitgebermarke
- Kommunikation der Arbeitgebermarke und der Unternehmenswerte
- Reputationsrisiken durch falsche Positionierung oder Kommunikation
- Forschungsdesign und Datenerhebung
- Empirische Befunde
- Ergebnisse des Inglehart-Index
- Ergebnisse des Conjoint-Design
- Ergebnisse des semantischen Differenzials
- Ergebnisse der Mitarbeiterprofilbewertung
- Diskussion – „Eine“ individualisierte Generation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Werten der jüngeren Generation, der sogenannten Generation Y, im Kontext des Arbeitgeberfindungsprozesses. Ziel ist es, die Werte dieser Generation zu analysieren und deren Einfluss auf die Suche nach einem Traumjob zu erforschen.
- Wertewandel in der Gesellschaft und dessen Auswirkungen auf die Generation Y
- Die Bedeutung von Werten für die Wahl des Arbeitgebers
- Employer Branding als Instrument zur Gewinnung von Nachwuchskräften
- Analyse der Präferenzen der Generation Y im Hinblick auf Arbeitgebermerkmale
- Diskussion der Ergebnisse und deren Implikationen für die Rekrutierungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Wertbegriff und dessen Bedeutung in den Sozialwissenschaften dar. Zudem werden die Herausforderungen des Arbeitgeberfindungsprozesses im Kontext des sich wandelnden Arbeitsmarktes beleuchtet.
- Kapitel 2 analysiert den Wertewandel aus soziologischer Perspektive, wobei die Theorie nach Inglehart im Mittelpunkt steht.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Generation Y, ihrem Wertemuster und ihrer Bedeutung im Kontext der heutigen Arbeitswelt.
- Kapitel 4 beleuchtet die Situation auf dem Arbeitsmarkt, sowohl aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeitgeberperspektive.
- Kapitel 5 beschreibt das Konzept des Employer Branding und dessen Bedeutung für die Gewinnung von Nachwuchskräften.
- Kapitel 6 erläutert das Forschungsdesign und die Methoden der Datenerhebung.
- Kapitel 7 präsentiert die empirischen Ergebnisse der Studie, die sich auf die Präferenzen der Generation Y im Hinblick auf Arbeitgebermerkmale konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen: Wertewandel, Generation Y, Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, Arbeitsmarkt, Rekrutierung, Präferenzen, Conjoint-Analyse, semantische Differenziale.
Häufig gestellte Fragen
Wer gehört zur "Generation Y"?
Die Generation Y umfasst die Alterskohorte, die heute als junge Bewerber und Absolventen in den Arbeitsmarkt eintritt. Sie zeichnet sich durch spezifische Werte und Erwartungen an das Berufsleben aus.
Was ist die Wertewandeltheorie nach Inglehart?
Inglehart beschreibt einen Wandel von materialistischen Werten (Sicherheit, Wohlstand) hin zu postmaterialistischen Werten (Selbstverwirklichung, Lebensqualität, Mitbestimmung).
Was versteht man unter Employer Branding?
Employer Branding ist der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, um im "War for Talents" qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden.
Welche Faktoren machen einen Arbeitgeber für Studierende attraktiv?
Wichtige Faktoren sind nicht nur das Gehalt, sondern auch weiche Kriterien wie Work-Life-Balance, Entwicklungsmöglichkeiten, Unternehmenskultur und die Vermittlung generationskonformer Werte.
Was ist eine Conjoint-Analyse im Kontext der Bewerberforschung?
Es ist eine Methode, um herauszufinden, welche Merkmale einer Stellenausschreibung (z. B. Standort, Gehalt, Aufgaben) für Bewerber am wichtigsten sind und wie sie diese gegeneinander abwägen.
- Citar trabajo
- Uwe Link (Autor), 2011, Wie sieht Dein Traumjob aus?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180395